Kategorie
- Begriffsregister (24)
- Literaturregister (25)
- Materialien (7)
- Miniaturen (7.401)
- Personen-S (2)
- Personenregister (126)
- Quellen (49)
- Verzeichnis der Quellen und Materialien (1)
Suche
Tags
-
Kategorien
- Begriffsregister (24)
- Literaturregister (25)
- Materialien (7)
- Miniaturen (7.401)
- Personen-S (2)
- Personenregister (126)
- Quellen (49)
- Verzeichnis der Quellen und Materialien (1)
Stichworte
Suche
-
Spitzweg, Siegmund Hellfried
Veröffentlicht unter Miniaturen
Verschlagwortet mit S
Kommentare deaktiviert für Spitzweg, Siegmund Hellfried
Dehn-Rotfelser [Dhen, Dehnaw, Dähn, Dähne, Dühne, Dehm, Dehme, Dyherrn], Moritz Adolf von
Dehn-Rotfelser [Dhen, Dehnaw, Dähn, Dähne, Dühne, Dehm, Dehme, Dyherrn], Moritz Adolf von; Generalwachtmeister [um 1580-1639]
Moritz Adolf von Dehn-Rotfelser [Dhen, Dehnaw, Dähn, Dähne, Dühne, Dehm, Dehme, Dyherrn] [um 1580-1639] stand zuletzt als Generalwachtmeister[1] in kursächsischen Diensten.
Er war ein Sohn des Ernst von Dehn-Rotfelser [1.11.1573-1645] und dessen Ehefrau Eva von Allenpeck. Außer seiner strengen Erziehung im reformierten Glauben[2] ist über Kindheit und Jugend Dehn-Rotfelsers wenig bekannt. Seine militärische Laufbahn begann er als Musketier.[3] Im Januar 1627 lag er in Hirschberg[4] und unterrichtete Melchior von Hatzfeldt,[5] damals noch Obristleutnant,[6] von seinen Versorgungsschwierigkeiten.[7] Im März dieses Jahres war er als Rittmeister[8] mit äußerst schwierigen Werbungen[9] beschäftigt, wie er ihm am 5.3.1627 aus Hirschberg mitteilte: „Es sei hohe Zeit, der letzte des Monats rücke näher, und noch sei wenig geworben. Bei dem Herrn Schaffgotsch[10] bin ich seitdem noch nicht gewesen, will aber bis Sonntag oder Montag mich zu ihm begeben. Als will ich verrichten, was mir der Herr Oberstlieutenant befohlen hat; ist aber wegen der Reiter bei ihm wenig zu hoffen, denn die schlimmsten Kerle keine Lust unter uns zu reiten haben. Ich werde zu thun haben, daß ich die bekomme, die er mir versprochen hat“.[11] In diesem März ging es in ihrer Korrespondenz auch um die Lieferung von Feuerrohren[12] aus Schmiedeberg.[13] In Schweidnitz[14] lag er im Juli dieses Jahres: Dabei ging es um Kontributionszahlungen,[15] die Verwundung von Franz Albrecht von Sachsen-Lauenburg[16] und den Abmarsch mehrerer Kompanien[17] Dehn-Rotfelsers von Frankfurt a. d. Oder[18] zu dem Obristen[19] Hans Georg von Arnim.[20] Vom September 1627 datiert ein Schreiben Dehn-Rotfelsers an Franz Albrecht von Sachsen-Lauenburg über ein Gefecht bei Bützow.[21] Dehn-Rotfelser berichtete Hatzfeldt in diesem Monat auch aus Sternberg[22] über den schlechten Zustand der Truppen, die Verhandlungen mit Herzog Johann Albrecht II. von Mecklenburg-Güstrow[23] und sein Zusammentreffen mit Franz Albrecht von Sachsen-Lauenburg. Aus Schaan[24] hatte er Hatzfeldt über die Belagerung Bützows sowie die Disziplinlosigkeit französischer Truppen[25] unterrichtet und ihn um Hilfe gebeten.[26] Arnim selbst hatte nach der Einnahme Bützows die bischöflichen Wertsachen geplündert und Silbergeschirr, bischöflichen Ornat etc. mitgenommen.[27]
Im Juni 1628 lag Dehn-Rotfelser im dänischen Bangsbo[28] – in Frederikshaven[29] selbst war eine von den Kaiserlichen errichtete Schanze – und informierte Hatzfeldt über die Ankunft einer Flotte von über 100 Schiffen aus Richtung Skagen[30] und Läso[31] sowie die Gefahr einer Truppenlandung. Zudem ging des um die Bewachung der Küste von Skagen bis nach Hals.[32] Dehn-Rotfelser berichtete ihm in August über die Pulvermühle in Elling[33] sowie über die Aburteilung des Werbers Hans Lotsmann von Schreibersdorf.[34] Die Beschießung der Küste bei der Ellinger Schanze[35] durch mehrere Schiffe war Gegenstand ihrer Korrespondenz im September, im Oktober wies er Hatzfeldt auf die mangelhafte Bewachung der Fladschanze hin.[36] Im Dezember unterrichtete er ihn von der Strandung eines großen Schiffes von etwa 80 Tonnen bei den kleinen Holmen und von der Zuweisung von zwei kleinen Höfen bei dem Huteloffkloster.[37]
Im Mai 1629 war er noch immer in Bangso einquartiert.[38] Es ist anzunehmen, dass er nach dem Frieden von Lübeck[39] Dänemark verlassen hat.
Zu 1632 wird berichtet: „Daraufhin griffen die [schwedisch-sächsisch-brandenburgischen; BW] Verbündeten Steinau[40] an, wo 18.000 Kaiserliche lagen. Mit der Eroberung der Stadt fiel am 5. September 1632 auch die strategisch wichtige Oderschanze an die Sachsen. Um die Kaiserlichen wirksamer zu bekämpfen, wurde die Armee geteilt. Während die sächsische Infanterie sowie die schwedische[41] und brandenburgische Kavallerie vor Breslau[42] blieben, brach der Feldmarschall[43] mit seiner Reiterei in der Nacht zum 9. September nach Ohlau[44] auf, wo bereits die Kaiserlichen lagen. Um die Verbündeten am Übergang der Oder zu hindern, traf Schaffgotsch mit weiteren Truppen an. Trotzdem war es Moritz Adolph von Dehn-Rothfelser gelungen, die Oder zu überschreiten. Beim Eintreffen der Nachricht über die Fertigstellung der Brücke von Ohlau flüchteten die etwa 8.000 Kaiserlichen in Richtung Brieg.[45] Die Sachsen zogen ihnen auf dem rechten Oderufer entgegen und brachten ihnen am 10. September bei Namslau[46] eine vollständige Niederlage bei. Über 1.200 wurden gefangen genommen,[47] die restlichen flüchteten nach Oppeln,[48] Jägerndorf[49] und Troppau.[50] Arnim folgte jedoch nicht und quartierte seine Truppen in Brieg und Schweidnitz[51] ein“.[52]
Die Bestallung Dehn-Rotfelsers zum Obristen eines kursächsischen Reiter-Regiments[53] erfolgte am 11.2.1633.[54] In diesem Jahr wurde er zum Kommandanten von Brieg ernannt.
„Nach Beendigung des Waffenstillstandes ließ Wallenstein[55] verbreiten, über Zittau[56] durch die Oberlausitz im Meißner Land einfallen zu wollen. Piccolomini[57] wäre schon aufgebrochen, um Torgau[58] oder einen anderen wichtigen Elbübergang zu besetzen. So zog Arnim von Kant[59] ab, wo die Armee ohnehin nicht mehr länger versorgt werden konnte und verließ Schlesien nach Sachsen. Zurück ließ er Thurn mit 5.000 Mann, die in Groß-Glogau,[60] Brieg, Liegnitz,[61] Oppeln[62] und Breslau[63] verteilt lagen. Unterstützung sollte ihm Oberst Moritz Adolph von Dehn-Rothfelser geben.
Inzwischen hatten die Schweden ihr Lager bei Steinau aufgeschlagen und beschlossen, den Sachsen zu folgen. Arnim, der schon weit in Sachsen stand, wollte nicht umkehren. So unterbrach Wallenstein seinen Zug und rückte in Eilmärschen auf die 3.500 Schweden bei Steinau vor“.[64]
Am 11.10.1633 stand Dehn-Rotfelser mit seinem Regiment unter dem Befehl des Grafen Heinrich Matthias von Thurn[65] der Armee Wallensteins gegenüber. „Thurn war am 11. früh noch ‚in stockfinsterer Nacht und bei großem Wind und Regen in die Schanze gekommen. Dort erzählte ihm ein adeliger Landsaß,[66] daß der Feind in der vergangen Nacht ‚unaufhörlich mit großem Antreiben gezogen, darunter auch Fußvolk und schwere Wagen gewesen‘. Der Graf berief jetzt eiligst Duval[67] aus dessen benachbartem Dorfquartier und beide beschlossen den Kaiserlichen ungesäumt Reiterei entgegenzuwerfen. Noch war der Tag nicht recht angebrochen, als Oberst Bayer[68] und der Oberstlieutenant des Krakauischen[69] Regiments in der Gesamtstärke von nur 300 Pferden sich auf den Weg machten. Die Obersten von Fels[70] und Dehn [?] folgten mit zusammen 650 Pferden: sie nahmen auch von den im ganzen 360 Mann zählenden Dragonern[71] mit, was an der Hand war. Fast eine Meile[72] von der Schanze kamen ihnen die unterdeß von Schaffgotsch geworfenen Reiter Oberst Stößels[73] in voller Flucht entgegen. Fels brachte sie ‚mit großem Ernst und Tapferkeit‘ zum Stehen und trieb die Verfolger eine Strecke zurück.
Es war nun so hell geworden, daß man deutlich wahrnehmen konnte, wie die Kaiserlichen mit einigen tausend Mann die Oder überschritten, auch gegen 1200 Dragoner bei sich hatten, die bald von den Rossen sprangen und mannhaft auf die Verbündeten losgingen. Thurn gedachte sie anfangs mit seinen an Zahl viel schwächeren Dragonern aufzuhalten; allein da diese gleich anfangs von den besser gewappneten Kaiserlichen in Unordnung gebracht wurden, wollten sie sich trotz alles Ermahnens und Zuredens – auch der brandenburgische Oberst Burgsdorf[74] feuerte sie mit scharfen Worten an – zu keiner weiteren Gegenwehr verstehen, verließen nicht einmal ihre Rosse, sondern wandten diese nach der Schanze zurück. Darauf wurden die Obersten Bayer und Stößel ‚ermahnt sich zu stellen‘; doch auch deren Compagnien schlossen sich dem Strom der Flüchtigen an, prallten unter die hinter ihnen stehenden Schwadronen[75] des Baron von Sirot[76] (200 Pferde) und brachten sie gleichfalls in Unordnung. Vergebens beschwerte sich ihr Kommandeur darüber bei Oberst Stößel; Sirots Reiter waren nicht mehr verwendbar, nicht mehr an den Feind zu bringen. Das nun vorrückende Felssche Regiment wich ‚ebenermaßen‘ vor der Übermacht dreier kaiserlicher, aus Kürassieren[77] und Arkebusieren[78] (2) bestehender Regimenter. Fels und Sirot gerieten bei diesem Angriffe, der vornehmlich den linken Flügel der Schweden und Sachsen traf, in Gefangenschaft.[79] Dabei mag auch Jacob Duwal in die Hände des Freiherrn gefallen sein; er hatte den Kummer des Augenblicks durch reichlichen Weingenuß zu vergessen gesucht und war bei seiner Gefangennahme ‚so voll, daß er fast nicht reden gekonnt‘. Besser als die links fechtenden Schweden hielt sich der rechte, aus den Reiterregimentern der Obersten Dehn, Rauchhaupt[80] und Krakau (etwa 900 Sachsen) bestehende Flügel der Verbündeten, bis er von zwei starken feindlichen Schwadronen, die dem weichenden linken Flügel der Verbündeten nachsetzten, umgangen wurde. Oberst Dehn sank schwerverwundet im Handgemenge, Krakau und die Reiter des nicht beim Treffen anwesenden Obersten Rauchhaupt schlugen sich nach drei- und viermaligen tapferen Attaken mit dem größten Teil ihrer Reiter durch, ‚daß es der Herzog von Friedland hoch rühmet‘“.[81] In seiner gedruckten Rechtfertigungsschrift schrieb Thurn: „Damit aber dennoch meinem Gräfflichen Stande und Namen nichts vngleiches oder verkleinerliches zugeleget / dem gemeinen Manne / in mangel vollstendigen Berichts / viel vngleiche Gedancken vnd Skrupel benommen / auch dem allgemeinen Wesen / so es zum theil mit berühret / durch vnzeitige Vorvrtheil nichts nachtheiliges zugezogen: Die Gemüther in solchem Verdacht nicht verwirret / sondern mehr schädliche Einbildungen mögen verhütet werden: Hierumb so habe ich den warhafften Verlauff vnd gründtliche erzehlung des erfolgten Vnglücksfall in Schlesien / in offenen Druck abgebē sollen.
Welcher hierauff beruhet: Daß / als die ChurSächs. Meißnische Lande an Kriegsvolck sehr entblößet / haben J. Excell. Herr ReichsCantzler[82] / inhabendenden plenipotentz vnd auffgetragenen Direction des evangelischen Wesens in Deutschland / zu vernommener ankunfft des Feindes vnd Fürsten von Wallensteins / etc. Herrn General Leutenanden[83] Arnheim schrifftlich erinnert / vnd vermittelst dero hochvernünfftigen Bedenckens vnd einverleibter erheblicher Vrsachen wolmeinendlich gesonnen / gestalten Sachen / vnd jetzigen des Reichs Beschaffenheiten nach / einen solchen Anstalt zu machen / daß die ChurSächs. Lande mehrers gesichert / der Oderstrom erhalten / vnd die vberbliebene Ort vnd Fürstenthumb in Schlesien manutenirt[84] vñ geschützet werden könten. Da haben Herr General Leutenandt mir solch an Sie abgangen Schreiben zu verlesen ertheilet / auch darauff eine vermeinte Diversion,[85] so speciös vnd lieblich anzuhören gewesen / für sich zu Werck zu setzen / gute vertröstliche Vorschläge gethan: Daß Sie nemlichen den General Gallas[86] in Böhmen vmb Leutmeritz[87] liegende / besuchen / demselben / vermittels verleihung des Allmächtigen / einen guten Streich geben / vnd vermittelst solchen Diversion, den Fürsten von Wallenstein an sich ziehen wollten. Sind also Sonnabends / den 21. Sept. mit dero vnterhabendem Volck / aus Schlesien abgezogen / als Dienstages acht Tage hernacher / nemblichen den ersten Octobris der Vberfall / leider / erfolget.
Nach demal Ich nun / was diß falß Herrn General Leutenant gefallen / ein gut ding seyn lassen / auch mit Gott / der aller Menschen wege weiß / auch alles in seinen Händen hat / den ich auch bey meinen Gräfflichen Ehren vnd gutem Gewissen vergeblich nicht zum Zeugen einführe) erhalten kann / daß vnsere sämtliche Meynung dahin gangen / es werde Herr General Leutenant Arnheim / einen guten theil der Wallensteinischen Armee an sich ziehen / auch wohin der gantze Schwalch vnd Corpus deß FeindsArmeen sich wende / sein Rücksehens haben / angesehen die Oerter vmb die Steinawer Brücken / gantz vnd zumahl verderbt vnd verwüstet / daß man in die Harre[88] daselbst Quartier zuhalten) eine wahre Vnmöglichkeit / vnd nicht angemutet werden können / ohne / daß auch deß Feinds Kriegsheer / der eingerissenen Seuche vnd Pest[89] halber der Orten vermuthlichen sich nicht verhalten würde; Gestaltsam dann auch der Fürst von Wallenstein mit dero gantzen Kriegsmacht / schon vber den Haan hinauß gangen war / da hab ich nach einkommenen Kundschafft / daß Herr Schaffgotsch / General des Feinds Cavallerie / mit zehen oder zwölff tausent Mann in Schlesien verbleiben würde / da hingegen ich nur geringe Anzahl / vnd gleichsam eine Hand voll Volcks / wiewol sonsten gute vnd redliche Befehlshaber / die ihre Regimenter zwar würden ergentzen / bey mir hette: Solche Mängel Herrn General Leutenandt Arnheim / als deme sie ohne das bekannt / zu gemüthe geführet / auch beweglich zu erkennen geben / daß ich dißfalß in höchster Gefahr vnd Vnsicherheit / so leichtsam zu Abbruch / oder auch verschmälerung meines so lang rühmlich hergebrachten Namens vnd Lebens / außschlagen vnd gerathen können / Nichts destoweniger aber / alldieweiln ein standhaffter Mann allen fürfallenden Sachen vnd Händeln / allerdings kein Rath vnd Ordnung geben: Sondern viel mehr von demselben / nach Gelegenheit / Rath vnd Ordnung nehmen vnd lernen / vnd sich in die Zeit schicken vnd richten mus / ich auch durch Gottes Gnade vnd Rettung / anderer Orten in dergleichen Gefahr mehr vnd vnerschrocken gewesen / der guten Zuversicht vnd Welt Erfahrenheit / daß in allen Waffen / mehr an Dapfferkeit / als an Vielheit vnd Menge der Völcker gelegen / vnter vielen auch in Zeiten die wenigsten den Feind schlagen vnd treffen: So hab ichs im Namen Gottes wagen / der Abrede gemäs / bey der Steinawer Brücken verharren / auch mich vmb die Lignitz[90] mit der Reuterey sehen lassen / vnd des General Schaffgotschen / als welcher der kundschafft nach / in Schlesien verbleiben würde / bey gemeldter Brücken erwarten / ihme auch / der Verfassung gemäs (welches Herr Baron de Sire vnd Rittmeister Steinbach[91] aus einem Munde bekundschafften können) mit darschickung der reuterey vmb Lignitz ein Nachdencken machen wollen / damit der Feind Herrn General Leutenant Arnheim mit aller vnd völliger Macht nicht in den Eisen liegen[92] / vnd in seinem Vorhaben / den Gallas zu besuchen / vmb so viel wenigers verhindern könne / sondern auch in Schlesien zuverbleiben gereitzet / vnd angetrieben würde / daß auch auff solche Art die Besatzung in Lignitz gebracht / welche sie auffzunehmen sich anfänglich geweigert / aber doch angenommen haben / vnd daß auch durch solch Mittel die Fürstliche Personen in Schlesien / bey dero Land vnd Leuten erhalten / vnd dero gentzliches Verderben möchte verhütet werden.
Dann was würde dieses für ein ansehen gehabt haben / daß Herr General Leutenandt Arnheim mit so viel tausend Mann den Krieg in ein ander Land zu pflantzen / vnd den General Gallas in Böhmen anzugreiffen fortgezogen / Da der Fürst von Wallenstein mit dem gantzen Hauffen seines Heers schon allbereit vber 8. oder 9. Meilen von vns vor der Steinawer Brücken / im Nachzug gewesen / solchen Ort zu verlassen / vnd also den Feind von aller Rücksorge in Schlesien zu befreyen ?
Zuvoraus / weil der Ort vmb die Steinawer Brücken also beschaffen gewesen / daß wir mit vnserm wenigen Volck / welches den mehrern theil in der Reuterey bestanden / es were dann / daß wir vns dem Feind gleichsam selbst vorsetzlich darliefern / vnd zu seinem Vorthel an die Hand gehen wollen / auch wegen der Fütterung so schleunig nicht abziehen / vns in die feste Städte / welche mit keiner Nothwendigkeit versehen / sondern das Getreidig vnabgeschnitten / da man eher ein Wildpret denn einen Bawer zusehen gekriegt / im Felde stehen blieben / vnd vns in die Städte begeben köñen / wie solches alles Landkündig / vnd keiner / der sich der Orten befunden / verneinen vnd abredig seyn / sondern gern gestehen wird / daß General Schaffgotsch die Besatzung deren in Schlesien annoch hinterstellig verbliebenen Oerter / als die Liegnitz / Brieg / Großglogaw[93] vnd Oppeln / welche mir mit geringer Mannier / vnd zu vnzeiten zu vertheidigen hinterlassen / angesehen / die mehrere Plätze vnd Fürstenthumb in Schlesien / als nemlich Neusse[94] / Münsterberg[95] / Franckenstein[96] / Reichenbach[97] / Schweinitz[98] / Jauer[99] / Lemberg[100] / Buntzlaw[101] / Hirschberg[102] / das Berghaus Fürstenstein[103] / Bolckenheim[104] / Newmarckstadt[105] vnd Streelen[106] / von Herrn Gen. Leut. Arnheim schon vorhin quittiret vnd verlassen / mit so einem geringen Hauffen vnd Hand voll Volcks zu schützen / auff den Hals geschoben / zuvoraus Herr Schaffgotsch den Vorthel schon ersehen / so leicht nicht würde nachgegeben haben.
Und wann Herr General Leutenand Arnheim / wie er verlassen / eilends auff den General Gallas zugangen / vnd denselben besuchet hette / ehe vnd zuvorn ihn der Fürst von Wallenstein können entsetzen / würde er gewiß den grössern Hauffen des Feindes aus dem Lande gezogen / vnd wir vnser verharren bey der Steinawer Brücken / bis wir nach gelegenheit andere Abtheilung machen können / nach aller Menschen Vrthel zuversichtiglich nicht vbel angelegt haben.
Als aber Herr General Leutenant Arnheim seinen Vorsatz vnd Reyse naher Böhmen gewendet / vnd der Fürst von Wallenstein / vnangesehen er schon weit von vns gewesen / sich gewendet / mit grosser eyl in Tag vnd Nacht vber acht Meil gereiset / vnd vnsern geringen Hauffen angefallen / da bin ich ohn mein Verschulden / in solche Enge vnd Gedränge gerathen / daß mich kein ander Mittel / alß des Feinds Macht vnd belieben / darauß können retten vnd vertretten. Dann / in dem wir vermeinet vnd entschlossen allein mit Herr General Schaffgotschen / so zum wenigsten mit 8000. Mann in Schlesien hinterlassen (wie dañ auch wir vnsers theils die Besatzung in Lignitz gebracht /vnd der Obriste Linsen[107] / daselbsten commendirend / sich Mannlich vnd vnerschrocken erzeiget) auff solche Statt ein versuch gethan / davon wider abgezogen / vnd bey Lieben[108] / so nur zwo Meylen von der Steinawer brücken sich gelagert gehabt / vnser Heyl zuversuchen / vnd Ich vnd Herr Commendant Dubalt auff dessen Vorhaben gute Achtung gegebē / hin vnd her wieder Kundschafter außgeschickt / vnd alle Strassen fleissig bereiten lassen / aber durch die Gefangene / deren Rittmeister Scheppel[109] den Abend zuvor / als folgenden Tags die vrplötzliche Vberfallung beschehen / noch dreyen eingebracht / ein mehrers nicht vernehmen können / als daß sie einhellglich nur von Herrn General Schaffgotschen Armeen bey Lieben meldung gethan / vnd von den Fürsten von Wallenstein etc. vnd dessen Kriegsheer gantz keine kundschafft gehabt / wie dann ebenmässig auch andere Gefangene / so denselben Abend ein Stund in die Nacht einkommen / mit einem Mund außgesaget / vnd von der Wallensteinischen Armee kein einiges Wort zu sagen gewust.
So haben sich der Fürst von Wallenstein mit dero gantzen vnd mit aller Notwendigkeit wolversehenen Armee / morgens den 1. Oct. bey der Steinawer Brücken disseits der Oder / vnd General Schaffgotsch mit der seinen an der andern Seiten des Strombs (durch welchen er bey so versiegenē Wasser hauffen weiß setzen / ja auch mit beladen Wägen fast aller Orten fahren können) in völliger Schlachtordnung sich erzeiget. An jetzt bemeltem Ort vnd biß zu der Steinawer Brücken / hab ich auß meinem Quartier / Wischitz[110] genand / eine ziemliche Meilwegs gehabt / vnd bin vormals jeder zeit vmb 7 . oder 8. Vhren frühe dahin kommen / diesen Tag aber / den 1. Oct. war ich so zeitlich auff / daß ich vor Tags / da es noch finster / großer Wind vnd Regen war / in die Schantze kam / da kompt ein Adelicher Landsaß / vnd vermeldet mir / daß der Feind zu Abends in der verschienenen Nacht / vnauffhörlich mit grossem Antreiben gezogen / darunter auch Fußvolck und schwere Wägen gewesen. Derowegen hab Ich eylends nach Herrn Commendanten Dubalden / der nicht weit von der Schantze in einem Dorffe die Nacht vber gewesen / geschicket / vnd darauff beyde geschlossen / vngesäumet Reuterey dorthin gegen den Feind abzuordnen / ist auch ehe der Tag recht angebrochen / der Oberst Bayer vnd der Obriste Leutenant deß Krackowischen Regiments / kein Augenblick zu feyren / geschickt worden / bald hernach ist gefolget der Oberste von Fels / auch Obrister Dehne / dieselbe haben die Trajoner eines theils / so viel an der Hand waren / mit sich genommen / nahet auff eine Meylwegs von der Schantze. Als wir nun allda ankommen / waren deß Obristen Stössels Compagnien in völliger Flucht / in dem kompt der Obrist von Felß / treibet mit grossem Ernst vnd Dapfferkeit den Feind wider zurück / vnd macht die Flüchtigen wider stehen. Da man auch das Werck angesehen / so war der Feind mit etlich tausenden vber den Paß / stellet sich in gute Ordnung / vnd hatte bey 1200. Tragoner / die stiegen ab von ihren Pferden / als redliche Soldaten / nahmen ihren Vortheil ein / vnd thaten das ihrige.
Die Parthey war sehr vngleich / vnd der Feind weit stärcker als wir an wolgewapnetem Volck vnd guten Tragonern / mit den selben treib er vnsere Tragoner in Vnordnung / welche sich auff mein vnd der Befehlshaber vielfaltiges anmahnen (inmassen dann auch der Obriste Burcksdorff an seinem Fleiß vnd Ermahnung / ja auch scharpffen antreiben / nichts lassen ermanglen) gantz vnd gar zu keiner Gegenwehr versehen / sondern sich auch eher von Rossen schlagen lassen wollen.
Hierauff ist der Obriste Bayer vnd Obrister Stössel ermahnet worden / sich zustellen / so bald sie aber gesehen / daß die Tragoner geflohen / der Feind mehr vnd mehr nachgerückt / haben sie auch die Flucht genommen / darüber der Obrist Baron de Syre fortgesetzt / als aber seine Reuter wargenommen / daß die Flüchtigen dem Obristen Baron de Syre vnter seine Reuter kommen / vñ ihm die seinigen mit in Vnordnung gebracht / massen er sich dessen mündlich gegen Obristen Stössel beschweret / darauff deß Obristen von Felß Regiment getroffen / auff welche / als ihnen zugleich 1. Regiment Curassirer vnd 2. Regiment Archibussirer begegnet / seyn dieselbe ebener massen außzuweichen gedrungen worden / deß Obristen Krakow / Obristen Dehnens vnd deß Obristen Rauchhaupts[111] Regimenter / nach dem der lincke Flügel in die Flucht kommen / haben gleichfals den Rücken gekehrt.
Es seyn aber bey dieser Gelegenheit nachfolgende Regimenter zu Roß auff vnser Seiten zugegen gewesen.
Der Obriste von Felß. 150
Der Obriste Krackaw. 200
Baron de Syre. 200
Stössel. 140
Beyer. 80
Dehn. 500
Obrister Rauchhaupt. 200
Tragoner. 360
Summa in allen 2020.
Das Volck / so mir Herr General Leutenant Arnheimb hinderlassen / ist dieses.
Cavalleria.
Obrister Dehn. 500
Obrister Gerßdorff.[112] 200
Obrister Rauchhaupt bey 200
Summa 900
Obrister Kötteritz[113] 300. Knecht zu Fuß / welche nicht beym Treffen gewesen.
Daß nun gleichwohl wir bey diesem leydigen Vnfall gegen einen so mächtigen Feind / mit deme zu schlagen / wir doch zu enig gewesen / vns vertiefft vnd hierinn den zeitlichen Abzug verlohren haben / ist dahero kommen / weil man sich einer so starcken Vbersetzung vber die Oder / auch gantze Regimenter vnd Hauffenweiß / nicht versehen / vnd vber diß der Obriste Stössel mit sicher Auffsicht vnd habender Wacht an diesem Ort gefehlet / vnd als weñ er den Feind wiederumb zurück vber das Wasser getrieben hatte / sehr vbel berichtet hat. Da ich nun das Vnglück vnd Gefahr gesehen / hab ich mich keines auffhaltens vnterstehen dörffen / war darzu auch keine Mögligkeit vorhanden / sondern hab nach der Schantz geeilet / die Reuter vnd Tragoner / deren ich viel alldar gefunden / auß den Bagagi-Wägen[114] gegen den Feind sich zustellen / heraußgetrieben. In all dieser Flucht nam mein Cammerdiener einen Kürassier gefangen / von dem ich zum ersten vernommen / daß der Fürst von Wallenstein mit seiner gantzen Armee vnd Stücken[115] jenseits der Oder / oben in der Höhe / hinter vnserer Schantz in der Schlachtordnung gestanden / mit vermelden / wir würden bey so beschaffenen Sachen / einen schlechten Marckt haben / vnd gegen einer so mächtigen Armee vbel bestehen können. Vnd als ich vber die Brücken / oben in die Höhe / in die Schantze kommen / hab ich den Feind also stehend gefunden. Bald schicket mir Herr Graff Tritschka[116] einen verschlossenen Brief einen verschlossenen Brief (den gab ich Herrn Duwalden / so ihn noch beyhanden) dieses einigen Inhalts / Ihr Fürstl. Gn. von Wallenstein beghre mit mir zu reden / betreffend meine Person / so ich nicht trawete / were man geneigt / Geissel herüber zuschicken / darauff ich gemeldet / der Kriegsbrauch were mir wol bekand / vnd nicht weniger Ihrer Fürstl. Gn. Person / Ich wollte ohne Bedencken zu deroselben hinreiten / etc. Ihre Fürstl. Gn. haben mich freundlich empfangen auch von vorigen Sachen vil geredet / vnd darbey bethewerlich genommen / wann ich nicht zur stell were / die vnsere müsten alle seine Gefangne seyn / dann er glaubte nicht / daß bey einem solchen vnvollkommenen schlechten / vnd nur angehebtem Retranchement[117] / so sich mit so wenigem volck nicht lassen bearbeiten / man sich würde vnterstehen / dasselbe zuverthätigen / sintemal sie alle Mängel wüsten / auch vergewissert wären / daß die Knechte[118] (deren in der Schantze bey 8. oder 900. waren) in der Gefahr nicht fechten würden. Vnd weil nun die Knechte nicht fechten wollen / auch darmit nichts dañ der Todt zu gewinnen gewesen / hab ich dieses den meinigen wieder zurück gebracht / vnd hierinnen deren Beystandt vnd Hülff zu leisten sie angemanet.
Als ist zu der handlung der Obriste Beyer / Obriste Stössel vnd der Obriste Leutenant Schaffmann[119] genommen[120] / vnd der Accord[121] dergestalt / daß die Stück vnd die Fähnlein vbergeben / daß der gemeine Soldat zu Roß vnd Fuß zu dienen genöthiget[122] / vnd allein die Befehlichshaber auf freyen Fuß gestellet werden sollten / auß eusserster Noth (welche kein Gesetz hat) wie vngerne auch der Schluß vnd Bejahung genommen.
Aber daß wir auch solten verwilliget haben / die fünff Plätze in Schlesien gutwillig zu vbergeben / wie der Fürst von Wallenstein aus des Obristen Beyers Bericht angenommen / vnd mit hoher Verpfändung vnd beschweren / so wir vnserm Zusagen kein Genügen theten / daß er vns vor den Städen vnd Vestungen zustücken hawen lassen wolle / auch letztlichen Herrn Duwald das Hencken angeboten: Solches haben wir / als Gefangene / vnd die in solchem Standt die Auffgebung der anvertrawten Plätze / den Obristen nicht anbefehlen können / bey vnsern Ehren / Leiblichen Eyden / vnd guten Gewissen widersprochen / widersprechens auch noch / vnd haben / was der Fürst von Wallenstein vns anthun lassen wolte / dahin gestellet lassen seyn müssen. Dann einmal zwar wahr vnd vnlaugbar / daß wegen Vbergebung der festen Plätze vnd Städte / im Rath / als in geheim / Rede vnd Gegenrede gepflogen / der Commendant Duwald auch für sich erwehnet / Er hielte darfür / man solte es bey Herrn ReichsCantzlern wol können verantwort / wann man vff die Erhaltung des Volcks gedächte / daß sie mit einem ehrlichem Accord vff Landsberg[123] vnd Franckfurt[124] abzögen / vnd die plätz erhielten / worauff ich gemeldet / Gott verhüte / daß diese Gedancken der Feind wissen solte / meldete auch außdrücklich / daß es nur im Rathe geredet / vnd man bey Leib von diesem schweigen müste / habe aber hernacher von Herrn GeneralWachtmeister Sparren[125] vernommen / daß er davon Wissenschaft gehabt / habe auch eben die klare Worth / so im Rathe gesprochen / angehöret.
Wie redlich nun vnd rühmlich gedachter Beyer / hierinnen gehandelet / daß er aus dem Rathe geschwetzet / welches doch die andern Obristen nicht geständig seyn wollen / solches gebt man der gantzen Welt / neben dem / daß er nun mehr dem Gegentheil dienet / vnd als ein Obrister wirbet[126] / was darvon zu halten / vernünfftiglich zuerkennen anheimb. In Ansehung dessen wir / als Gefangene / die sonsten in solchem Stande / die Auffgebung der anvertraweten Vestungen / den Obristen nicht anbefehlen können / desto härter angehalten / gleichwol aber nach ihrer Pfeiffen tantzen / vnd in allem ihres gefallens thun vnd lassen müssen.
Vnd haben sonsten solche vermeynte Bedräuungen vnd Schrecken / Mich in meinem hohen Alter / weniger als nichts angefochten / als der Ich / wie ein Soldat / auff solche Arth nicht anders / denn sehr rühmlich were gestorben / vnd in ewige Ruhe vnd Lob / aus diesem zergänglichem mühseligen Leben geschieden were.
Wie ich dann sampt Herrn Duwald will teglich vns in den Tod gegeben / auch darumb gebeten. Es haben vns aber die Obristen vnd andere Befelchshabere / wie auch Adeliche Persohnen flehentlich gebeten vnd ermahnet / daß wir mit solchem Todt / dem gemeinen Wesen keinen Nutzen / sondern vielmehr Schaden thun können / inmassen kein vernünfftiger Befehlchshaber sich finden lassen würde / der auff eines gefangenen Generaln vnd Commandeurn Ordinanz pariren sollte / weil er hiermit sich nimmermehr gegen seinen König vnd Herrn / daß er oboedirt hette / würde entschuldigen können / so müste imgleichen diß ein Sinnloser vnd vnvernünfftiger Mensch seyn / der solches / daß diß ein genötigt vnd gezwungen Werck sey / nicht mercken noch verstehen solte. Sonsten were mir für meine Person das Leben zu fristen vnd einsam außzusetzen ein leichtes Ding / aber gegen Gott vnd der Welt nicht zuverantworten gewesen.
Wunderlich vnd gnädig hat mich Gott der Allmächtige biß dahero in meinem geführten Kriegswesen / Thun vnd lassen / regieret vnd geführet / daß sich niemaln einiger Mensch vnterstanden / mir eintzigen Fehler offentlich oder mit geferbten Worten mit Bestand / anzuschmitzen.[127]
Daß ich aber in dergleichen Occasionen / vnd eussersten darstehenden Gefahr des Kriegswesens mehr gestecket / aber durch Verleihung des Allmächtigen / vnd meinen (ohne vepigen Ruhm zu melden) getraudten Fleiß vnd Sorgsamkeit wunderlich darauß errettet worden / habe ich hiemit rühmlich beyzubringen / daß als ich newlicher Zeit in der Kön. Maj.[128] in Dennemarck Diensten gewesen / vnd bey Boytzenburg[129] an der Elben / beyde die Wallensteinische und Tyllische[130] Armeen / deren für meiner Ankunfft daselbsten gemachten Schantzen vnd Schiffbrücken sich zu bemächtigen uff mich der Ich mit einer geringen Anzahl gegen beyden Armeen zu schützen hinterlassen / vnd plötzlich ankommen / habe Ich mit Hülff Monsieur Traitorens[131] die Schantz in höchster eyl dermassen ansehnlich vnd nützlich erbawet vnd verbessert / auch kein Bedencken genommen / als FeldMarschalck[132] eygener Person darinn zuverbleiben / gegen dem Feind / so es mit Macht angegriffen / von Tag zu Tagen vertheidiget vnd auffgehalten[133] / mich auch bey Altenaw verbawet / damit vff höchstgedacht Ihr Kön. Maj. die Gewalt zu eylends nicht ankom̃en könne / bin ich vmb vesper Zeit / als man mir der erlangten Kundschafft vnd des Feindes gemachten Schlusses nach / folgenden Tages einen guten Morgen bieten wollen / mit Ruhm vnd Ehren abgezogen / auch das Volck vnd alles was mir anvertrawet / gantz vnverletzt abgeführet / darzu aber keinen Magister vnd Schulmeister / so mir / was zu thun / Gesetz vnd Ordnung geben / bey mir gehabt habe.
Anjetzo aber bey diesem ohn mein Verschulden entstandenem Vnheil / verstehe ich eusserlich / daß sich Leute finden / das jenige / was entweder zuverhüten / oder anders zuvermitteeln / vnmüglich gewesen / an mir vngeschewet zu tadeln / ohnangesehen Ich heute es gemacht / vff was weise vnd Gestalt andere ex post facto[134] nun mehr philosophiren / so war es dannoch verlohren / vnd hette ich auch in den festen Orthen / als welche mit keiner Nothwendigkeit versehen / für des Feindes Macht / müssen secundiret worden / so durch diesen vorgenommenen Abzug nacher Meissen[135] / schwerlich vnd langsam können erfolgen / dessen sich auch die Commendanten Obrister Boom[136] vnd andere ihres getroffenen Accords halber ihrer Entschuldigung vermuthlichen werden gebrauchen.
Wan dann auß oberzehltem bestendigem Bericht / des in Schlesien erfolgten Vnheils vnd Trennung des Königl. Schwedischen Volcks alle rechtschaffene Cavallier vnd getrewe Christliche Hertzen mit Grunde der Warheit zuvernehmen / wie es mit oberzehltem Treffen eygentlich bewandt / vñ vernünfftiglich zuerachten / ob mir oder jemandt vnsers Mittel die Schuld zuzulegen / daß / da Herrn General Leutendt Arnheimb die vorgeschlagene diversion gefehlet / den Feind nicht nach sich gezogen / welcher mit der gantzen Armee / daß wir einseitig / ohne hülff vnd Succurs die mangelhaffte / vnd aller Orthen sehr verderbte Plätze nicht erhalten / vnd des Feindes grossen Macht mit vnserm wenigen Volcke vnd 3000. Mann Bastant[137] seyn können: Zu diesen instehenden Kriegszeiten aber fast nichts gemeiners / dann künlich vnd frey zu tadeln / zu beschuldigen vnd vnzeittig zu straffen / was andere thun vnd verrichten / dardurch derselbe entweder vorsetzlich vnd vermessentlich hin vnd wider an Ehren vnd Namen verunglimpffet / mit Schimpff vnd Afterreden[138] wider die Liebe des Nechsten hintergangen / oder auch der Parthey / deren sie mit Affecten verwandt / nicht wenigers dann mit Tapfferkeit der Waffen mit bösem Geschrey ein Vortheil erjagen / oder auch in gemein zu mehr frewdigern An- vnd Fortsetzung Hertz vnd Muth benehmen wollen: Als wolle demnach ein jedweder nach dem löblichen Spruche Tertulliani die Sache im Grundt / ohne passionirte Affecten recht zu Hertzen nehmen / vnd hierinnen nicht nach den Personen / sondern von den Personen nacht der Sachen vnd befundenen Beschaffenheit vrtheilen vnd schliessen. GOtt mit vns“.[139]
Der Rückzug Dehn-Rotfelsers mit seinen Soldaten nach der Schlacht bei Steinau[140] nach Breslau scheiterte jedoch am Widerstand des Rats: „In Breslau waren Abteilungen des bei Steinau zersprengten Dehnschen Regiments zur höchsten Überraschung der Einwohner am Morgen des 12. Oktober auf dem Elbing[141] eingetroffen. Sie führten zunächst noch das große Wort. Seind vorhabens sich wieder zu sammeln und begehren inmittel Vivres,[142] vermeinende, [daß] nicht sonderer Importanz sei und würde sonderlich von den aus der Mark anziehenden neuen Regimentern ersetzt werden können. Der Rat verweigerte zwar den Flüchtigen den erbetenen Einlaß, unterstützte jedoch in seinem Bestreben es mit keiner der hadernden Parteien ganz zu verderben die schwedisch-sächsische Besatzung auf der Dom-Insel[143] unter dem Oberstlieutenant des Schwalbachischen[144] Regiments August Adolf von Trandorf[145] mit Proviant und Munition“.[146] Es blieb ihnen aber der Rückzug nach Brieg. „Der Graf Schaffgotsch war nach dem Steinauer-Siege in Schlesien geblieben, um das Land vollends von den Schweden und Sachsen zu befreyen, welche den Dom und Sand zu Breßlau unter dem Oberst-Lieutenant Trandorff, Oppeln unter dem Obersten Schneider,[147] und Brieg unter dem Obersten Dähn annoch besetzt hielten. Die Stadt Olau bekam Schaffgotsch mit Accord, welchen er aber nicht hielte, sondern den tapfern Commandanten Bonitz[148] gefangen nahm und seine Soldaten untersteckte. Er machte sich hierauf an Brieg, bekam aber schlechte Antwort, ja die Besatzung, so 3000. Mann starck und mit 500. Centner Pulver und anderm Vorrath versehen war, bot ihm sogar im Felde die Spitze“.[149]
Am 29.11.1633 wandte sich Wallenstein aus Neumarkt[150] an Schaffgotsch wegen Dehn-Rotfelsers und der anderen kursächsischen Offiziere, die in kaiserliche Dienste treten wollten. Besonders sollte sich Schaffgotsch dabei um den Übertritt Dehn-Rotfelsers bemühen.[151]
Anfang 1634 kam es der Einquartierung, genauer der Logis wegen, zum heftigen Streit zwischen dem schwedischen Generalleutnant[152] Herzog Wilhelm IV. von Sachsen-Weimar[153] und Dehn-Rotfelser. „Herzog Wilhelm gab sich die größte Mühe, ‚alle Inkonvenientien[154] zu verhüten’, sandte zur Beaufsichtigung der Truppen Kommissare[155] in die einzelnen Fürstentümer, konnte aber nicht hindern, daß es zu dauernden Zwistigkeiten kam, besonders da in manchem Fürstentum Sachsen und Schweden nebeneinander quartierten. Der kursächsische Oberst von Dehn ließ gegen den Herzog ‚ziemliche Bedrohung verlauten’, so daß ihn Wilhelm zur Ruhe verwies, sonst werde er ‚Gegenanstalt machen’. Außerdem schickte der Oberst dem Residenten[156] ein ‚anzügliches Schreiben’, auf das dieser ‚der Meriten nach’ antwortete“.[157]
Bei Dehn-Rotfelsers Einmarsch ins Anhaltische entstanden die gleichen Probleme mit Fürst Ludwig I. von Anhalt-Köthen.[158] Das Regiment Dehn-Rotfelser wurde am 10.5.1634 vor Ranstadt[159] gemustert.[160] Am 1.5.1634 bereits war Obrist Rochow[161] zu seinem Nachfolger bestellt worden.
Allerdings wird noch unter dem Oktober 1634 festgehalten: „Nunmehr suchte Colloredo[162] erneut das Erzgebirge heim. Über das Preßnitztal[163] und Frauenstein[164] erreichte er am 28. Oktober Freiberg.[165] Da die Stadt seine Forderung nach einer Übergabe ablehnte, ließ er mehrere Vorwerke[166] und 44 Häuser in der Vorstadt abbrennen. Wegen heftiger Gegenwehr zogen sich dann die Kaiserlichen aber wieder zurück. Eine Woche später hatte der kaiserliche Oberst Abraham Schönnickel[167] (ein gebürtiger Chemnitzer) mit 5.000 Mann Zwickau[168] erreicht und dessen Übergabe verlangt. Erneut äußerte sich der Rat, nicht ohne Befehl des Kurfürsten handeln zu können. Als die Truppen dann am 6. Oktober abzogen, brannten sie sechs Dörfer in der Umgebung nieder, trieben alles Vieh zusammen und nahmen es über das Preßnitztal und Reitzenhain[169] nach Böhmen mit. Doch ließen die Kaiserlichen von Sachsen nicht ab und brannten am 3. November Glashütte[170] vollständig nieder. Um Raub und Feuer Einhalt zu gebieten, berief Johann Georg I.[171] mehrere Garnisonen[172] aus Böhmen u. a. die zu Tetschen[173] zurück. Davon schickte er vier Regimenter unter Dehn-Rothfelser nach Zschopau.[174] Zehn Tage später zog er in die Gegend von Marienberg[175] und Annaberg.[176] Zwar konnten die Kaiserlichen vorerst abgedrängt werden, doch bekämpften sich beide Parteien mit wechselndem Erfolg weiter. Da beide Seiten überall Kontributionen[177] und Lebensmittel verlangten, wurde das obere Erzgebirge noch mehr ausgesaugt.
Schließlich suchte Colloredo die Entscheidung. Am 1. Dezember brach er bei Marienberg auf und überfiel die in Zschopau liegenden sächsischen Regimenter. Die Stadt wurde geplündert und durch Schönnickel in Flammen gesetzt. Wer ihnen in die Hände fiel, wurde niedergemacht oder mitgeschleppt, um das Geraubte zu tragen, Frauen zu Tode vergewaltigt.[178] Tags darauf kehrten die Kaiserlichen über Marienberg nach Böhmen zurück. Wenig später erreichte Dehn-Rothfelser mit den restlichen Truppen Freiberg.
Weil sich Johann Georg I. in Wien bei Ferdinand II.[179] über Colloredos Raubzug beschwerte, erhielt dieser einen Verweis. Der Oberst selbst rechtfertigte sich wenig glaubhaft damit, nichts vom Waffenstillstand gewusst zu haben“.[180] Im November war Dehn auch in Leisnig[181] einquartiert gewesen: „Im November quartirten sich hier 4. Regimenter zu Pferde in diese Stadt ein, nemlich der Oberste Unger,[182] Dähne, und Schleinitz,[183] so auch der Oberste Trautsch,[184] als Sächsische Völker, welche zu Zschopa geschlagen waren, lagen 3. Wochen allhier, was nun Schönnickel übrig gelassen, das spolirten diese vollends aus“.[185]
Nach dem Prager Friedensschluss (1635)[186] diente Dehn-Rotfelser weiter als Generalwachtmeister in der kursächsischen Armee.[187]
Der Pfarrer Jacob Möser [um 1570-1644][188] in Staßfurt[189] erinnert sich: „Den 6. [16.9.; BW] wird das Churfürstliche Lager bei Barby[190] geschlagen und desselbigen Abends um 10 Uhr wird allhier Lärm u. Sturm geschlagen, weil die zwei Compagnien Dragoner, so Aschersleben[191] verlassen, und auch nach Magdeburg[192] gewollt, vorm Wasserthore halten, in Meinung, es wäre die Compagnie ihres Volkes noch hierinnen, so sie einnehmen wollten, wie einer von ihnen, den sie gefangen hereinbracht, berichtet hat. Denn unsere sächsischen Reiter, derer 26 unter dem Commando eines Wachmeisters[193] vom General-Major Dehnen zur Guardi[194] hereingeschickt u. frühe nach 8 Uhr ankommen waren, sitzen alsbald zu Roß, halten in beiden Thoren, denen die Bürgerschaft mit ihrem Gewehr beistehet, u. also der eine von etlichen unserer Leute ertappt wird, so sich zu nahe ans Thor gemacht. Wäre die abgezogene Compagnie[195] noch hier gewesen u. die beide dazu kommen, hätte es ohne Plünderung wohl schwerlich dürfen abgehen. Unser Vieh auf der Weide, so man doch so gar weit nicht treiben dürfen, zu bewahren, haben 2 Reiter alsobald begleiten müssen, dafür zwei Thlr. gegeben worden jeden Tag, u. hernach ists aufs 1 ½ Thlr. kommen, da wir uns doch der Schwedischen halben nichts zu befürchten gehabt, sondern nur der Churfürstlichen wegen. Den 7. [17.9.; BW] bringt ein Cornet[196] mit 10 Pferden Assignation[197] vom General-Quartiermeister[198] Fernow.[199] Den 8. Septbr. [18.9.; BW] wird des Herrn General Majors, so sein Hauptquartier zu Güsten[200] hat, Leib-Compagnie[201] hereinlogirt, u. muß die Stadt ihnen 150 Thlr. dazu geben, sonst hätte er drei Compagnien hereingelegt. Werdensleben[202] u. Legat[203] müssen ihm dazu viel an Essen und Getränk für seine Küche schaffen. Der Müller hat müssen geben dem Regimentsquartiermeister[204] 6 Thlr. dem Fourier[205] 2 Thlr. dem Capitain Lieutnant[206] 12 Thlr. haben ihn heftig tribuliret,[207] und auch die Schmiede, Balbirer, Bader, Apotheker geschatzet, haben wieder auch mir den 11. Septbr. [21.9.; BW] angemuthet, Recompens-Geld[208] zu geben dem Fourier, so ich aber verweigert, auch mich dessen entbrochen.[209] Man hat sie auch sonst nicht genug tractiren können, da doch große Noth ums liebe Brot gewesen, als noch bishero nicht geschehen, weil das Wasser klein, und unsicher anderweit zu mahlen, auch wohl fast ein 8 oder 9 Dorfschaften Bauersvolk hierinnen liegt, so ganz ausgeplündert gewesen, die auch essen wollen, sind hin u. wieder viel Leute hierum Hungers gestorben,[210] maßen denn der Pfarrer zu Förderstädt schon 4 Personen, wie er mich berichtet, begraben, aus Mangel des lieben Brots.
Haben es die Schwedischen grob gemacht mit Rauben u. Plünderung, so ist’s durch diese viel ärger worden, auch mit Schändung des Weibesvolks, was ihnen vorkommen, und sonderlich mit Beraubung der Kirchen.[211] Ich habe mich nicht, nur in meinen Garten wagen dürfen, habe müssen um eine Bedeckung bitten, wenn jemand begraben worden, weil’s wegen Verschüttung des Ascherslebischen Thores weit hinausgewesen nach dem Gottesacker. Und das wohl zu denken, so nimmt ein Soldat, so die Junkergasse hinaus reitet, einem von Adel, so vor der Thür stehet, die Handschuh u. Hut mit Gewalt weg, die er in der Hand hat, so gar unverschämt war das Rauben. In Barby, da doch Ihre Churfürstl. Durchlaucht ihr Quartier gehabt, sind die Häuser, darinnen meistentheils die hohen Offiziere gelegen, weil das ganze Lager da herum gewesen, mit Noth vertheidiget, über viel Ställe und Scheunen eingerissen worden.
Den 16. [26.9.; BW] nehmen Quartier allhier Herr Feldmarschall Vitzthum,[212] General-Major Taube[213] u. General-Major Dehne, u. wohnen diesen und den andern Tag der Musterung[214] bei, weil etliche Regimenter vom Weimarischen Volke gemehret, theils zusammengestoßen worden zu Roß.
Den 25. Septbr. [5.10.; BW] wird eine Corporalschaft[215] von 24 Pferden herein kommandirt, u. bricht den 26. [6.10.; BW] hergegen die Leib-Compagnie zu Mittage wieder auf, und muß die Stadt dem General-Major Dehnen wöchentlich 200 Thlr. geben. […] Den 6. Octob. [16.10.; BW] räumen die 24 Reiter mit ihrem Corporal hier das Quartier, und wird vom General-Quartiermeister ein Cornet[216] mit 12 Pferden hineingeleget den 7. Octob. [17.10.; BW]. Den 13. Oct. [23.10.; BW] wird er mit seinen Reitern wieder abgefordert“.[217]
Im „Theatrum Historiae Vniuersalis“ ist festgehalten: „Weil auch der bißhero gewesene ChurSächsische General Leutenant Arnheim / auß mißfallen deß FriedenSchlusses / wie man vorgab / seine Charge resigniret, als haben Ihre Churfürstliche Durchläuchtigkeit die hohen Officien vnd Officirer wieder bestellet / vnd Herrn Baudiß[218] zum General Leutenant angenommen / Obristen Dehnaw zum General Major vber die Cavallery / vnd Obristen Tauben zum General vber die Infanteria geordnet / auch etliche Obristen mit stattlichen Ketten[219] / Brustbildern vnd Præsenten begabet“.[220] „Nun also war es soweit, dass Johann Georg I. auf Rat des kaiserlichen Gesandten Kurz[221] am 16. Oktober 1635 die Schweden öffentlich zu Feinden erklärte. In seinem ‚Blutbefehl’ von Aschersleben erhielt Baudissin die Order, gegen die Schweden vorzugehen, wenn sie sich nicht entsprechend des Prager Friedens ergeben, sondern im Reich noch weiter Unruhe stiften würden. Der Kurfürst teilte seine Armee: Dam Vizthum und Dehn-Rothfelser schickte er in die Altmark[222] und zog selbst Baudissin die Elbe abwärts“.[223]
Zur Unterstützung der Sachsen war der nicht besonders befähigte Morzin[224] abgeordnet worden. „Am 8. Dezember 1635 war Morzin von Pommern aufgebrochen und über die Oder gegangen, um den Sachsen zu helfen, die Schweden an die Ostseeküste zu drängen. Baner[225] beschloss, Johann Georg I. bei Parchim[226] noch vor Morzins Ankunft zu überfallen. Davon in Kenntnis gesetzt, gab der Kurfürst sein Lager auf und marschierte nach Havelberg.[227] Von hier schickte er Dam Vizthum und Dehn-Rothfelser nach Kyritz,[228] um Morzin entgegenzukommen, der bereits bei Ruppin[229] stand. Als Baner von Gefangenen davon erfuhr, rückte er nach und schlug beide am 17. Dezember in die Flucht“.[230]
„Der Kurfürst von Sachsen ging mit dem Gros seiner Armee auf Jerichow[231] zurück in der Absicht, hier über die Elbe zu gehen und dann auf Magdeburg zu marschieren, das sich noch immer im Besitz der Schweden befand. Als er in Jerichow ankam, stellte es sich heraus, dass ein Übergang über die Elbe wegen des herrschenden starken Eisganges unmöglich war. Deshalb machten die Sachsen kehrt und zogen am 22. Dezember [1635; BW] nach Rathenow,[232] wo alles in Rattenaw, die Mußquetierer[233] aber auf die nächsten Dörfer logiret worden. Nur einige Reiterabteilungen unter dem Obristlieutenant Unger ritten dem Heere nach Fehrbellin[234] vorauf und besetzten dort die Schanze. Den 23. [Dezember] seind Ihre Durchl. [Kurfürst von Sachsen] wiederumb aufgezogen und nachher Jarlitz [Garlitz[235]] marchiret, der General von der Cavallerie und General-Major Dähne sind in Rattenow blieben. Da kam aus Fehrbellin die Nachricht, das der Obl. Unger die Schanze zu Fereberlin [Fehrbellin] wieder verlaßen müssen, denn der Feind zu starck auf ihn gesetzet. Wieder war es Morzin, der den in Fehrbellin hart bedrängten Sachsen mit etzlichen Regimentern unverzüglich zu Hilfe eilte. Als jedoch Morzin in Fehrbellin ankam, hatte das Banérsche Leibregiment[236] unter dem Obristlieutenant Schlange,[237] das den Angriff ausgeführt hatte, bereits von den über den Rhin ins Havelland gejagten Dragonern des Obristleutnants abgelassen und war auf Bötzow[238] marschiert, welchen Paß es am 24. Dezember ohne einen Schuß einnahm. Die in Bötzow befindliche 200 Mann starke brandenburgische Besatzung erhielt freien Abzug nach Brandenburg“.[239] Unter dem 21.11./1.12.1635 findet sich bei Möser folgender Eintrag: „wird des Obersten Wachtmeisters Moritz Adolph Dehnen Leiche, so von den schwedischen erschossen, hier her bracht, und in die Kirche gesetzet“.[240] Allerdings verwechselte Möser ihn hier mit seinem Neffen.[241]
Dehn wurde im Januar 1636 von dem schwedischen Obristen Johan Wachtmeister[242] vernichtend geschlagen. Der schwedische Hofhistoriograph Bogislaw Philipp von Chemnitz [9.5.1605 Stettin-19.5.1678 Hallsta, Gem. Västerås] berichtet zum Januar 1636 über Banérs Unternehmungen: „Brach also in aller Geschwindigkeit mit der Armée auf vnd marchirte / nachdem Er eine Partey in fünnfhundert starck auf vier oder funff meile / ümb des Feindes contenance[243] in acht zunehmen / zur wacht hinter sich gelassen / gerade gegen Havelberg vnd Werben[244] zu: Woselbsthin Er die meiste reuterey / damit Er ümb so viel weiniger durch die übersetzung aufgehalten würde / vnter Gen. Lieutenant[245] Rüdwen[246] / vnd Gen. Major[247] Axel Lillie[248] über die Havel disseits gegen der Magdeburger brücke zugehen / voraus commendiret / vnd nur das fus volck vnd artoleri[249] / sambt zwey Regimentern zu pferde / als sein eigen vnd des Obristen Pfuls[250] / bey sich behalten hatte.
Welche Er[251] den zwelfften tag Jenners / vnd folgende nacht / sambt der pagage,[252] bey Werben / da Er die Schantze mit dreyhundert mußquetirern / fünffzehen Winspel[253] Mehl / etliche tausendt pfund Brot vnd Fleisch versehen / vnd dem Major von Gen.-Major Axel Lilliens OstGothen Regiment / Thomas Bancken[254] anvertrawet / über die Elbe setzen lassen: In willens / bey Magdeburg sich wiederumb mit der reuterey zuconjungiren / vnd / nachdem Er die gelegenheit würde ersehen können / auff die brücke zu Wittenberg[255] / wie auch zu Torgaw / ümb sie zuverderben / einen versuch zuthun / oder sonst sich der Saal / so hoch hinauff / als immer müglich / bis gar an Naumburg[256] / oder weiter zubemächtigen.
Gemeldte beyde Generale machten in der marche nicht viel federlesens / sondern erwiesen mit beyhabender sich so eylfertig; Daß Sie von Zechlin[257] aus / über Havelberg vnd Jerichow / inner drey tagen das Städtlein Burg[258] erreichten: In hoffnung / Obristen Hanaw[259] mit seinem Regiment vnd den Streinischen[260] übrigen trouppen / so alhie vnd zu Möckern[261] gelegen / zuertappen. Allein selbige waren ihrer ankunfft zeitlich vom Landvolck avisiret / kurtz zuvor außgerissen: Daß Sie nur etliche davon erwischen können. Giengen damit / ohne verseumnuß / auff Magdeburg fort: Von dannen Sie zur stund von Obristen / Hans Wachtmeister / nacher Wanßleben[262] geschicket: Welcher daselbst des Gen-Major Dähnens Regiment angetroffen / geschlagen / vnd gantz ruiniret. Sie aber avancirten stracks / nebenst etlichen commendirten knechten / aus der Magdeburgischen guarnison; weiter den Elbstrom hinauff bis an Barby: Worin der Obriste Mitzlaff[263] gelegen / vnd / da man Ihn auffgefordert / der übergabe sich geweigert. Derhalben Sie den ort mit der reuterey vmbringet gelassen: Fürtters auff die pässe / Calbe[264] / worin eine compagnie von Mitzlaffs Regiment / vnd Bernburg[265] gerücket / vnd / deren sich meister gemachet / auch dem FeldMarschalck alles zuwissen gethan.
Dieser nachdem Ihme / vngeachtet alles angewandten fleisses / wegen der Knechte / wie auch der artoleripferde grossen müdigkeit / vnmüglich gefallen / ehe zukommen / arrivirte erst / den sechszehenden tag Jenners ümb mittagszeit / zu Magdeburg mit fußvolck vnd Stücken. Nahm hieselbst das Stralendorffische[266] vnd Lohausische[267] / als wolaußgeruhete / starcke Regimenter / heraus / vnd legte den Obristen Draken[268] hinein. Eilete / solchem nach / stracks gegen Barby zu: Ümb den Obristen Mitzlaff aus seinem neste zuheben. In der marche ertappete der Obriste Lieutenant von des FeldMarschalcks Regiment zu pferde in Stendal[269] einen Capitän mit einer Compagnie newgeworbener knechte: Wie imgleichen ein Capitain mit sechszig Man dem Obristen Pful[270] zu Newen Haldensleben[271] sich ergeben. So waren auch der Obriste Brincke[272] / vnd dessen Obriste Lieutnant / NewMan[273] / mit ihrem vnterhabenden volcke zeitig von Halberstadt[274] entwichen / vnd accordirte bald hernach die guarnison zu Garleben[275] / so meist von den gezwungenen[276] Schweden aus der Werber-Schantze bestand: Wovon der Capitain abzog / die Schwedische knechte aber wieder nach Magdeburg zu ihrem Regiment gesandt wurden“.[277]
„Anfang 1636 lag die weiterhin von Johann Georg I. geführte sächsische Armee um Bernau.[278] Aus seinem Hauptquartier bei Templin[279] beorderte der Kurfürst Morzin nach Berlin, um Baner näher zu sein. Der Feldmarschall rückte überraschend am 21. Januar mit seiner Armee auf Havelberg und Werben vor. Die meiste Reiterei ließ er unter Ruthven und Lilie über die Havel zur Brücke bei Magdeburg[280] vorausgehen. Von hier beorderten sie Hans Wachtmeister nach Mansleben,[281] wo er Dehn-Rothfelsers Regiment schlug und in die Flucht trieb. Mit einem Teil der Besatzung Magdeburgs zogen Lilie und Ruthven dann nach Barby.[282] Da Mitzlaff der Aufforderung, die Stadt zu übergeben, nicht nachkam, ließen sie einige Reiterei zurück und gingen nach Bernburg.[283]
Nunmehr kam Baner nach Barby vor. Doch auch seiner Aufforderung zur Übergabe stand Oberst Mitzlaff ablehnend gegenüber. Deshalb befahl er zwei Tage später die Erstürmung der Stadt. Mitzlaff wurde gefangen genommen und nach Stralsund[284] gebracht, von wo aus ihn der Reichskanzler[285] zur Haft nach Schweden überführen ließ. Durch Bestechung der Wachen gelang es dem Dänen, wenig später zu fliehen.
Als Johann Georg I. vom Anmarsch der Schweden an die Elbe erfuhr, brach er mit der ganzen Armee nach Wittenberg auf. Nach ihrem Eintreffen am 30. Januar wollten sich die Sachsen mit Proviant und Geschützen aus Leipzig[286] verstärken. Da aber die Schweden vor ihm da waren, fiel ihnen das meiste in die Hände. Ungeachtet dessen rückte Johann Georg I. zur Entsetzung der Moritzburg[287] nach Halle.[288]
Baner hatte am 3. Februar das von den Verbündeten verlassene Halle eingenommen, in dem Fabian von Ponickau[289] die Moritzburg verteidigte. Als der Kurfürst heranrückte, zogen sich die Schweden über die Saale zurück und verbrannten hinter sich die Brücke. Sie nahmen Naumburg[290] ein und zerstörten die Brücken von Merseburg[291] und Weißenfels[292] durch Feuer“.[293]
In der Chronik des Dorfes Schönermark[294] bei Angermünde[295] heißt es unter 1636: … „850 rt den 7. März, als Oberst Dühne sich mit seinem ganzen Regiment auf dem Hof und im Garten einquartiert, und, weil die Untertanen im Dorf ruiniert, seinen Unterhalt für sich und seine Völker allein vom Hof gesucht und gelegen bis zum 21. April, alles Vieh, klein und groß, was vorhanden gewesen, geschlachtet, das Korn aus den Scheunen gestreckt, verfüttert, vertan und zunichte gemacht, worauf sofort am 21. April, als er abgezogen, das Schleimische[296] Regiment wieder dahin gelegt und was noch übrig aufgerafft“.[297]
Im „Theatrum historiae universalis“ ist festgehalten: „Weil auch der bißhero gewesene ChurSächsische General Leutenant Arnheim / auß mißfallen deß FriedenSchlusses / wie man vorgab / seine Charge resigniret, als haben Ihre Churfürstliche Durchläuchtigkeit die hohen Officien vnd Officirer wieder bestellet / vnd Herrn Baudiß[298] zum General Leutenant angenommen / Obristen Dehnaw zum General Major vber die Cavallery / vnd Obristen Tauben zum General vber die Infanteria geordnet / auch etliche Obristen mit stattlichen Ketten[299] / Brustbildern vnd Præsenten begabet“.[300]
„Inzwischen [August 1636; BW] war Dehn-Rothfelser mit starken Regimentern in Perleberg[301] angekommen, wo sich Johann Georgs I. Hauptquartier befand. Daraufhin änderte Baner sein Vorhaben und wollte den Generalmajor von der Armee abschneiden, um die Verbündeten mit ihrem Hauptheer zum Entsatz und einer Schlacht zu veranlassen. Bald musste er jedoch erfahren, das Morzin und Hatzfeld mit ihren Truppen bereits in Perleberg[302] standen und sich auch Dehn-Rothfelser in Sicherheit befand“.[303]
„Am 30. Dezember 1636 verließ Johann Georg I. unter Zurücklassung einer von Oberst August Adolph von Trandorf geführten Besatzung Leipzig und zog nach Torgau. Als Baner davon hörte, brach er vier Tage später in Thüringen auf und zog über Naumburg[304] und Leipzig ebenfalls dorthin. Auf seinem Weg ließ er Stalhandske[305] bei Eilenburg[306] Dehn-Rothfelsers Truppen überfallen“.[307]
Im August 1637 lag Dehn-Rotfelser bei Lüchow[308] und korrespondierte mit Hatzfeldt wegen einer Beurteilung Sporcks.[309] Zugleich erfolgte eine Beurteilung der Lage in der von einer schwedischen Garnison gehaltenen Stadt Lüneburg[310] und an der Weser. „Der größte Theil der Schwedischen Armee unter Baner befand sich nun in Pommern. Der Kurfürst von Sachsen wollte (wie Götz[311] früher an Georg[312] geschrieben hatte,) diese Entfernung der Schweden benutzen, seine ruinirten Regimenter auf Kosten der Braunschweig-Lüneburgischen Fürsten in Stand zu setzen. Im Juli rückte der Kursächsische General-Major von Dyherrn mit acht sehr schwachen Cavallerie-Regimentern in’s Lüneburgische. Diese Sachsen hauseten dort übler als die Schweden. Ein Lüneburgischer Beamter verglich in seinem Berichte an den Herzog von Celle[313] die Sächsischen Soldaten mit hungrigen Wölfen. Die Herzöge August der Jüngere,[314] Friedrich und Georg wandten sich an den Kaiser mit der Bitte, das Lüneburgische von der drückenden Kursächsischen Einquartierung zu befreien. Georg bat den Kaiser in einem besondern Schreiben, ihm die zur Armee des Gallas[315] geschickten zwei Cavallerie-Regimenter baldigst zurück zu senden, weil er selbige zur Vertheidigung der eigenen Länder bedürfe. Die Antwort des Kaisers vom 28. August N. St.[316] war überaus gnädig: »er habe dem Kurfürsten von Sachsen befohlen, seine Truppen aus dem Lüneburgischen zurück zu fordern. Auch solle der Herzog seine beiden Regimenter zurück erhalten, wenn das Hauptwerk in Pommern vollendet sey. Er beabsichtige ein Truppen-Corps nach der Weser zu senden«“.[317] Allerdings war es nicht nur um die Wiederherstellung der sächsischen Regimenter gegangen, es hatte auch ein Hilfeersuchen gegeben, die schwedische Besatzung der Stadt Lüneburg aufzuheben. „Während die Stadt Lüneburg sich ohne die Genehmigung des Herzogs von Celle und Georgs an den Kurfürsten von Brandenburg um Hülfe wandte, hatte sein Bruder Herzog Friedrich von Celle ebenfalls ohne Georgs Wissen den Kurfürsten von Sachsen gebeten, die Schweden aus Lüneburg zu vertreiben. Auch der Magistrat der Stadt Lüneburg hatte sich mit der nämlichen Bitte an diesen Kurfürsten gewandt. Der Kursächsische General-Major Dyherrn war, wie früher bemerkt ist, mit acht Cavallerie-Regimentern in’s Lüneburgische gerückt. Unter dem Vorwande, der Requisition[318] Herzog Georg Friedrichs Genüge zu leisten, ward nun auch noch der General-Lieutenant von Vitzthum mit mehren Infanterie-Regimentern von der Kursächsischen Armee nach dem Lüneburgschen geschickt. Vitzthum schrieb am 26. August an den Herzog Friedrich von Celle: »er sey seinem Verlangen gemäß bis Kloster Meding[319] vorgerückt, und hoffe die Stadt Lüneburg bald von der schwedischen Garnison zu befreien; es sey aber nöthig, daß der Herzog ihn auf’s schleunigste mit Proviant versehe; auch ersuche er ihn, alle seine in Celle habenden Truppen zu ihm stoßen zu lassen«“.[320] Wegen der raschen Übergabe Lüneburgs an Georg von Braunschweig-Lüneburg am 9.9.1637, ohne auch nur einen Schuss abgegeben zu haben oder einer Gewalt ausgesetzt gewesen zu sein, wurde der Kommandant Stammer[321] am 27.11.1637 in Stettin[322] hingerichtet.[323]
Der schwarzburg-sondershausische Hofrat Volkmar Happe [1587-nach 1642][324] hält in seiner „Thüringischen Chronik“ die Bewegung der Regimenter fest: „Den 26. September [6.10.; BW] Billeben[325] und Rockensußra[326] von den Dehnischen und Rorhauwischen [im Original (falsche) Korrektur aus Rochauischen] geplündert worden“.[327] „Den 27. September [7.10.; BW] Holzsußra[328] von diesen Völckern geplündert worden. Eodem [die] habe ich noch sechs Roshauwische Reuter zu Guarden bekommen. Eodem [die] auch einen Ungerischen[329] Corporal[330] mit zehen Reutern zur Guardia bekommen. Den 28. September [8.10.; BW] sind die zwey Regimenter, das Demische und Rorauwische[331] in das Amt Tonna[332] gezogen“.[333] „Den 11. November sind die churfürstlichen Dehnischen Regimenter von Kelbra[334] und Badra[335] in die Grafschaft Hohenstein[336] gezogen“.[337] „Den 15. November [25.11.; BW] sind die zwey churfürstlich sächsischen Regimenter, als das Dehnische und Rohauwische wieder aus der Grafschaft Hohenstein umb Sondershausen,[338] als zu Hachelbich,[339] Berka,[340] Jecha[341] und Bebra[342] ankommen. Den 16. [26.11.; BW] sind diese zwey churfürstliche Regimenter in der Nacht unversehens in das Amt Keula[343] kommen, haben gelegen zu Großbrüchter,[344] Kleinbrüchter,[345]Toba[346] und Urbach,[347] auch theils zu Schlotheim.[348] Den 17. [27.11.] sind diese Regimenter an denen Orten stille gelegen. Den 18. [28.11.; BW] Commissarius Fischer mit dem Jungen Wolf Schneidern anhero kommen. Eodem [die] sind diese Regimenter in das Amt Volkenroda[349] und in die Heylingen,[350] theils auch nach Bothenheilingen[351] gezogen“.[352] „Eodem [die] [24. 11./2.12.; BW] ein Rittmeister vom Dehnischen Regiment anhero kommen, deme wir vorspannen sollen, hat Krackeel[353] geben. Eodem [die] hat auch der Obriste Rochaw Soldaten anhero geschicket und Vivers[354] und Fourage[355] begehret. Eodem [die] die Dehnischen und Rachauwischen zu Peukendorf[356] eingefallen und Meinem Gnädigen Herrn[357] Getreide genommen. Eodem [die] [24.11./2.12.1637; BW] haben wir einen Guarden[358] nach Peukendorf gesandt. Eodem [die] [25.11./5.12.; BW] Rockensußra von den Demischen und Rochauwischen geplündert. Eodem [die] in der Nacht auch Peukendorf geplündert“.[359] Jonitz[360] und Vockerode,[361] Törten[362] und Mosigkau[363] waren in diesem Jahr von Dehn’schen Truppen ausgeplündert worden.[364]
In der Thomas-Chronik heißt es zu den Kriegsereignissen um die freie Reichsstadt Mühlhausen:[365] „Den 28. Nov. [8.12.1637; BW] sind die beiden kursächsischen Regimenter zu Pferde, als das Dehnische und Rochauische,[366] nachdem sie 10 ganzer Tage in den Mühlhäusischen Dörfern Quartier gehabt, wieder abgezogen, haben teils die Gebäude aus den Dörfern, weil die armen Leute nicht bei ihnen bleiben können, sondern entlaufen müssen, umgehauen und verbrannt“.[367] Happe hält weiter fest: „Den 8. Dezember [18.12.; BW] etzliche reuberische Diebe von den Demischen und Rohauwischen über dreyßig Schweine alhier zu Ebeleben[368] genommen. Darunter ich eine schöne Sau und 2 Schweine mit verlohren“.[369] „Den 22. [1.1.1638; BW] haben die Demischen und Rohauwischen Bothenheilingen geplündert. Den 23. [2.1.1638; BW] sind diese Regimenter aufgebrochen und nach der Naumburg gezogen“.[370] Ende 1637 gab Dehn-Rotfelser, wahrscheinlich aus gesundheitlichen Gründen, seine militärischen Ämter auf und unterstellte sein Regiment dem Obristen Hans von Rochow.
Um den 6.2.1638 war Obristleutnant Christian Ernst von Knoch[371] im Auftrag von Fürst Ludwig I. von Anhalt-Köthen in diplomatischer Mission in Dresden.[372] Bei der Gelegenheit nahm Knoch auf Wunsch von Fürst Ludwig I. Dehn-Rotfelser in die „Fruchtbringende Gesellschaft“ auf. Knoch verlieh ihm den Gesellschaftsnamen „der Geschickte“ und als Motto „wider Hitz‘ und Gift“. Im Köthener Gesellschaftsbuch findet sich Dehn-Rotfelsers Eintrag unter der Nr. 318.
Im Mai 1638 sollte er nach den Vorstellungen des Kurfürsten die Besatzungen in Mecklenburg ablösen, die ergänzt und reorganisiert werden sollten.
1639 starb Dehn-Rotfelser unverheiratet als kursächsischer Hauptmann der Ämter Stolpen[373] und Radeberg.[374]
Um weitere Hinweise unter Bernd.Warlich@gmx.de wird gebeten !
[1] General(feld)wachtmeister [schwed. generalmajor]: Bei den hohen Offizierschargen gab es in der Rangfolge „Generalissimus“, „Generalleutnant“, „Feldmarschall“, „Generalfeldzeugmeister“, auch den „General(feld)wachtmeister“, den untersten Generalsrang im ligistischen Heer. In der Regel wurden Obristen wegen ihrer Verdienste, ihrer finanziellen Möglichkeiten und verwandtschaftlichen und sonstigen Beziehungen zu Generalwachtmeistern befördert, was natürlich auch zusätzliche Einnahmen verschaffte. Der Generalwachtmeister übte nicht nur militärische Funktionen aus, sondern war je nach Gewandtheit auch in diplomatischen Aufträgen tätig. Der Generalfeldwachtmeister entsprach rangmäßig dem Generalmajor. Der Generalmajor nahm die Aufgaben eines Generalwachtmeisters in der kaiserlichen oder bayerischen Armee war. Er stand rangmäßig bei den Schweden zwischen dem Obristen und dem General der Kavallerie, bei den Kaiserlichen zwischen dem Obristen und dem Feldmarschallleutnant. Die Bezeichnung ergab sich aus seiner ursprünglichen Aufgabe, der Inspektion der Feldwachen und dem Überwachen der Aufstellung der Brigaden und Regimenter im Felde und beim Marsch.
[2] reformierter Glaube: „Die reformierten Kirchen teilen mit den übrigen Kirchen der Reformation wesentliche Prinzipien wie das Priestertum aller Gläubigen und die vier evangelischen Grundsätze sola scriptura (allein die Schrift), solus Christus (allein Christus), sola gratia (allein durch Gnade) und sola fide (allein durch Glauben). Wie in den meisten übrigen protestantischen Kirchen erkennen die Kirchen der reformierten Tradition mit Taufe und Abendmahl zwei Sakramente an. Im Unterschied zur lutherischen Tradition wird in reformierten Kirchen das Abendmahl jedoch als reines Gedächtnismahl verstanden. Die Vorstellung einer Realpräsenz wird abgelehnt. Brot und Wein gelten dementsprechend als Zeichen für die reale Präsenz Jesu Christi, nicht jedoch als Materialisierung dieser Präsenz. Eine Wandlung der Elemente Brot und Wein in Leib und Blut wird nicht geglaubt. Statt eines Altars befindet sich in reformierten Kirchen in der Regel ein Abendmahlstisch. Auch die lutherische Zwei-Reiche-Lehre wird in reformierten Kirchen nicht gelehrt. Im Unterschied zu einigen evangelischen Freikirchen praktizieren die reformierten Kirchen die Kindertaufe. Ein besonderes Merkmal der reformierten Kirchen ist die Betonung der Gleichgewichtigkeit des Alten und des Neuen Testamentes. Aus dem Alten Testament erklärt sich auch die Hervorhebung des Bilderverbotes, was sich in der relativen Nüchternheit reformierter Kirchengebäude wiederfindet. Kruzifixe oder größere Ausschmückungen werden in der Regel abgelehnt. Die reformierte Liturgie ist ebenfalls relativ schlicht und auf die Predigt bzw. Verkündigung des Wortes Gottes zugeschnitten. Entsprechend ist die Kanzel in den meisten reformierten Kirchengebäuden zentral angebracht. Kennzeichnend sind auch die schlicht gehaltenen sogenannten Genfer Psalter. Wechselgesänge gibt es in der Regel nicht. Die reformierten Kirchen im deutschsprachigen Raum sind meist presbyterial-synodal organisiert. Die Pfarrstellen werden nicht von Kirchenleitungen, sondern direkt durch die Gemeinden oder die Gemeindevorstände besetzt“ [wikipedia].
[3] Musketier [schwed. musketerare, musketör, dän. musketeer]: Fußsoldat, der die Muskete führte. Die Muskete war die klassische Feuerwaffe der Infanterie. Sie war ein Gewehr mit Luntenschloss, bei dem das Zündkraut auf der Pulverpfanne durch den Abzugsbügel und den Abzugshahn mit der eingesetzten Lunte entzündet wurde. Die Muskete hatte eine Schussweite bis zu 250 m. Wegen ihres Gewichts (7-10 kg) stützte man die Muskete auf Gabeln und legte sie mit dem Kolben an die Schulter. Nach einem Schuss wichen die Musketiere in den Haufen der Pikeniere zurück, um nachladen zu können. Nach 1630 wurden die Waffen leichter (ca. 5 kg) und die Musketiere zu einer höheren Feuergeschwindigkeit gedrillt; die Schussfolge betrug dann 1 bis 2 Schuss pro Minute (vgl. BUßMANN; SCHILLING, 1648, Bd .1, S. 89). Die zielfähige Schussweite betrug ca. 300 Meter, auf 100 Meter soll die Kugel die damals übliche Panzerung durchschlagen haben. Die Treffsicherheit soll bei 75 Metern Entfernung noch 50 % betragen haben. Die Aufhaltewirkung war im Nahbereich sehr hoch, die Getroffenen sollen sich förmlich überschlagen haben. Je nach Entfernung sollen jedoch im Normalfall nur 5-7% aller abgegebenen Schüsse eine Wirkung im Ziel gehabt haben. Vgl. WALLHAUSEN, Kriegskunst zu Fuß. Zudem rissen sie auf etwa 10 Meter Entfernung etwa dreimal so große Wundhöhlen wie moderne Infanteriegeschosse. Ausführlich beschrieben wird deren Handhabung bei ENGERISSER, Von Kronach nach Nördlingen, S. 544ff. Eine einfache Muskete kostete etwa 2 – 3 ¼ Gulden, die qualitativ besseren Suhler Waffen das Doppelte, so dass seine Ausrüstung nicht so kostenintensiv war. Die Muskete löste das Handrohr ab. Die ab 1630 im thüringischen Suhl gefertigte schwedische Muskete war etwa 140 cm lang bei einer Lauflänge von 102 cm und wog etwa 4,5 – 4,7 kg bei einem Kaliber von zumeist 19,7 mm. Sie konnte bereits ohne Stützgabel geschossen werden, wenngleich man diese noch länger zum Lade- und Zielvorgang benutzte. Die Zerstörung Suhls durch Isolanos Kroaten am 16./26.10.1634 geschah wohl auch in der Absicht, die Produktionsstätten und Lieferbetriebe dem Bedarf der schwedischen Armee endgültig zu entziehen. BRNARDÍC, Imperial Armies I. Für den Nahkampf trug er ein Seitengewehr – Kurzsäbel oder Degen – und schlug mit dem Kolben seiner Muskete zu. In aller Regel kämpfte er jedoch als Schütze aus der Ferne. Deshalb trug er keine Panzerung, schon ein leichter Helm war selten. Eine einfache Muskete kostete etwa 3 ¼ Gulden, die qualitativ besseren Suhler Waffen das Doppelte, so dass seine Ausrüstung nicht so kostenintensiv war. Im Notfall wurden die Musketiere auch als Dragoner verwendet, die aber zum Kampf absaßen. MAHR, Monro, S. 15: „Der Musketier schoß mit der Luntenschloßmuskete, die wegen ihres Gewichtes [etwa 5 kg] auf eine Gewehrgabel gelegt werden mußte. Die Waffe wurde im Stehen geladen, indem man den Inhalt der am Bandelier hängenden hölzernen Pulverkapseln, der sog. Apostel, in den Lauf schüttete und dann das Geschoß mit dem Ladestock hineinstieß. Verschossen wurden Bleikugeln, sog. Rollkugeln, die einen geringeren Durchmesser als das Kaliber des Laufes hatten, damit man sie auch bei Verschmutzung des Laufes durch die Rückstände der Pulvergase noch einführen und mit Stoff oder Papier verdämmen konnte. Da die Treffgenauigkeit dieser Musketen mit glattem Lauf auf die übliche Kampfentfernung von maximal 150 Metern unter 20 Prozent lag, wurde Salvenschießen bevorzugt. Die Verbände waren dabei in sog. Treffen aufgestellt. Dies waren Linien zu drei Gliedern, wobei das zweite Treffen etwa 50 Schritt, das dritte 100 Schritt hinter der Bataille, d. h. der Schlachtlinie des ersten Treffens, zu stehen kamen, so daß sie diese bei Bedarf rasch verstärken konnten. Gefeuert wurde gliedweise mit zeitlichem Abstand, damit für die einzelnen Glieder Zeit zum Laden bestand. Ein gut geübter Musketier konnte in drei Minuten zwei Schuß abgeben. Die Bleigeschosse bis zu 2 cm Kaliber [vgl. auch GROTHE, Auf die Kugeln geschaut, S. 386, hier 16, 8-19,5 mm] verformten sich beim Aufprall auf den Körper leicht, und es entstanden schwere Fleischwunden. In den Kämpfen leisteten Feldscherer erste Hilfe; doch insgesamt blieb die medizinische Versorgung der Verwundeten mangelhaft. Selbst Streifschüsse führten oft aufgrund der Infektion mit Tetanus zum Tode, erst recht dann schwere Verletzungen“. Der Hildesheimer Arzt und Chronist Dr. Jordan berichtet 1634, dass sich unter den Gefallenen eines Scharmützels auch ein weiblicher Musketier in Männerkleidern gefunden habe; SCHLOTTER, Acta, S. 194. Der Bad Windheimer Chronist Pastorius hält unter 1631 fest; PASTORIUS, Kurtze Beschreibung, S. 100: „1631. Den 10. May eroberte der General Tylli die Stadt Magdeburg / plünderte sie aus / eine Jungfrau hatte ihres Bruders Kleider angezogen / und sich in ein groß leeres Weinfaß verstecket / ward endlich von einem Reuter gefunden / der dingte sie für einen Knecht / deme sie auch drey Monat treulich die Pferde wartete / und als in einem Treffen der Reuter umkam / und sie von denen Schweden gefangen gen Erffurt kam / ließ sie sich für einen Musquetirer unterhalten / dienete fünff Jahr redlich / hatte in etlichen Duellen mit dem Degen obsieget / wurde endlich durch eine Müllerin / wo sie im Quartier lag / verrathen / daß sie ein Weib wäre / da erzehlete sie der Commendantin allen Verlauff / die name sie zu einer Dienerin / kleidete sie / und schenckte ihr 100. Ducaten zum Heyrath-Guthe“. Weiter gibt es den Fall der Clara Oefelein, die schriftliche Aufzeichnungen über ihren Kriegsdienst hinterlassen haben soll. Allerdings heißt es schon bei Stanislaus Hohenspach (1577), zit. bei BAUMANN, Landsknechte, S. 77: „Gemeiniglich hat man 300 Mann unter dem Fenlein, ist 60 Glied alleda stellt man welsche Marketender, Huren und Buben in Landsknechtskleyder ein, muß alles gut seyn, gilt jedes ein Mann, wann schon das Ding, so in den Latz gehörig, zerspalten ist, gibet es doch einen Landsknecht“. Bei Bedarf wurden selbst Kinder schon als Musketiere eingesetzt (1632); so der Benediktiner-Abt Gaisser; STEMMLER, Tagebuch 1. Bd., S. 181f.; WALLHAUSEN, Kriegskunst zu Fuß, S. 43ff., über die Bedienung; BRNARDÍC, Imperial Armies I, S. 33ff.; Vgl. KEITH, Pike and Shot Tactics; EICKHOFF; SCHOPPER, 1636, S. 59ff.
[4] Hirschberg [Jelenia Góra]; HHSSchl, S. 189ff.
[5] Melchior Reichsgraf Hatzfeldt v. Gleichen [20.10.1593 Crottorf-9.11.1658 Schloss Powitzko bei Trachenberg/Schlesien], kaiserlicher Feldmarschall.
[6] Obristleutnant [schwed. Överstelöjtnant, dän. oberstløjtnant]: Der Obristleutnant war der Stellvertreter des Obristen, der dessen Kompetenzen auch bei dessen häufiger, von den Kriegsherrn immer wieder kritisierten Abwesenheit – bedingt durch Minderjährigkeit, Krankheit, Badekuren, persönliche Geschäfte, Wallfahrten oder Aufenthalt in der nächsten Stadt, vor allem bei Ausbruch von Lagerseuchen – besaß. Meist trat der Obristleutnant als militärischer Subunternehmer auf, der dem Obristen Soldaten und die dazu gehörigen Offiziere zur Verfügung stellte. Verlangt waren in der Regel, dass er die nötige Autorität, aber auch Härte gegenüber den Regimentsoffizieren und Soldaten bewies und für die Verteilung des Soldes sorgte, falls dieser eintraf. Auch die Ergänzung des Regiments und die Anwerbung von Fachleuten oblagen ihm. Zu den weiteren Aufgaben gehörten Exerzieren, Bekleidungsbeschaffung, Garnisons- und Logieraufsicht, Überwachung der Marschordnung, Verproviantierung etc. Der Profos hatte die Aufgabe, hereingebrachte Lebensmittel dem Obristleutnant zu bringen, der die Preise für die Marketender festlegte. Um all diese Aufgaben bewältigen zu können, waren umfangreiche Kenntnisse und Erfahrungen notwendig. Nicht selten lag die eigentliche Führung des Regiments in der Verantwortung eines fähigen Obristleutnants, der im Monat je nach Truppengattung zwischen 120 [nach der „Ordnung Wie es mit der verpflegung der Soldaten“ (1630)] und 150 fl. bezog – in besetzten Städten (1626) wurden z. T. monatlich 400 Rt. erpresst (HEIMATMUSEUM SCHWEDT, Die Uckermark, S. 15 – , in der brandenburgischen und dänischen Armee Armee sogar 300 fl. Nach Wallensteins Verpflegungsordnung (1629) standen ihm bei der Infanterie 320 Rt. monatlich zu; KRAUSE, Urkunden 1. Bd., S. 460. Voraussetzung war allerdings in der bayerischen Armee die richtige Religionszugehörigkeit. Maximilian I. hatte Tilly den Ersatz der „unkatholischen“ Offiziere befohlen; Bayerisches Hauptstaatsarchiv München Dreißigjähriger Krieg Akten 236, fol. 39′ (Ausfertigung): Maximilian I. an Tilly, München, 1629 XI 04: … „wann man dergleich officiren nit in allen fällen, wie es die unuorsehen notdurfft erfordert, gebrauchen khan und darff: alß werdet ihr euch angelegen sein lassen, wie die uncatholischen officiri, sowol undere diesem alß anderen regimentern nach unnd nach sovil muglich abgeschoben unnd ihre stellen mit catholischen qualificirten subiectis ersezt werden konnde“. Der Obristleutnant war zumeist auch Hauptmann oder Rittmeister einer Kompanie, wofür er ein zusätzliches Einkommen bezog, so dass er bei Einquartierungen und Garnisonsdienst zwei Quartiere und damit auch entsprechende Verpflegung und Bezahlung beanspruchte oder es zumindest versuchte. Von Piccolomini stammt angeblich der Ausspruch (1642): „Ein teutscher tauge für mehrers nicht alß die Oberstleutnantstell“. HÖBELT, „Wallsteinisch spielen“, S. 285.
[7] ENGELBERT, Hatzfeldt, Schönst 6, S. 13. Die im Hatzfeldt-Archiv lagernden Archivalien sind nicht zugänglich, hier und im Folgenden werden die Angaben bei ENGELBERT, Hatzfeldt, herangezogen.
[8] Rittmeister [schwed. ryttmåstere, dän. kaptajn]: Oberbefehlshaber eines Kornetts (später Esquadron) der Kavallerie. Sein Rang entspricht dem eines Hauptmannes der Infanterie (vgl. Hauptmann). Wie dieser war er verantwortlich für Werbung und Soldzahlung, für Disziplin, Ausrüstung und Verpflegung sowie für die Ernennung der untergebenen Führer. Oft war er in erster Linie für die materielle Versorgung der Truppe zuständig, und die eigentlich militärischen Aufgaben wurden von seinem Stellvertreter, dem Leutnant, übernommen. Bei den kaiserlichen Truppen standen unter ihm Leutnant, Kornett, Wachtmeister, 2 oder 3 Korporale, 1 Fourier oder Quartiermeister, 1 Musterschreiber, 1 Feldscher, 2 Trompeter, 1 Schmied, 1 Plattner. Bei den schwedischen Truppen fehlten dagegen Sattler und Plattner, bei den Nationalschweden gab es statt Sattler und Plattner 1 Feldkaplan und 1 Profos, was zeigt, dass man sich um das Seelenheil als auch die Marsch- und Lagerdisziplin zu kümmern gedachte. Der Rittmeister beanspruchte in einer Kompanie Kürassiere 150 fl. Monatssold, d. h. 1.800 fl. jährlich, während ein bayerischer Kriegsrat 1637 jährlich 792 fl. erhielt, 1620 war er in der brandenburgischen Armee als Rittmeister über 50 Pferde nur mit 25 fl. monatlich datiert gewesen. Bei seiner Bestallung wurde er in der Regel durch den Obristen mit Werbe- und Laufgeld zur Errichtung neuer Kompanien ausgestattet. Junge Adlige traten oft als Rittmeister in die Armee ein.]: Oberbefehlshaber eines Kornetts (später Esquadron) der Kavallerie. Sein Rang entspricht dem eines Hauptmannes der Infanterie (vgl. Hauptmann). Wie dieser war er verantwortlich für Werbung und Soldzahlung, für Disziplin, Ausrüstung und Verpflegung sowie für die Ernennung der untergebenen Führer. Oft war er in erster Linie für die materielle Versorgung der Truppe zuständig, und die eigentlich militärischen Aufgaben wurden von seinem Stellvertreter, dem Leutnant, übernommen. Bei den kaiserlichen Truppen standen unter ihm Leutnant, Kornett, Wachtmeister, 2 oder 3 Korporale, 1 Fourier oder Quartiermeister, 1 Musterschreiber, 1 Feldscher, 2 Trompeter, 1 Schmied, 1 Plattner. Bei den schwedischen Truppen fehlten dagegen Sattler und Plattner, bei den Nationalschweden gab es statt Sattler und Plattner 1 Feldkaplan und 1 Profos, was zeigt, dass man sich um das Seelenheil als auch die Marsch- und Lagerdisziplin zu kümmern gedachte. Der Rittmeister beanspruchte in einer Kompanie Kürassiere 150 fl. Monatssold, d. h. 1.800 fl. jährlich, während ein bayerischer Kriegsrat 1637 jährlich 792 fl. erhielt, 1620 war er in der brandenburgischen Armee als Rittmeister über 50 Pferde nur mit 25 fl. monatlich datiert gewesen. Bei seiner Bestallung wurde er in der Regel durch den Obristen mit Werbe- und Laufgeld zur Errichtung neuer Kompanien ausgestattet. Junge Adlige traten oft als Rittmeister in die Armee ein.
[9] Werbung: Der jeweilige Kriegsherr schloss mit einem erfahrenen Söldner (Obrist, Obristleutnant, Hauptmann) einen Vertrag (das sogenannte „Werbepatent“), in dem er ihn eine festgelegte Anzahl von Söldnern anwerben ließ. Dafür wurde ihm ein der von Städten und Territorien wegen der Ausschreitungen gefürchteter => Musterplatz angewiesen. Zudem erhielt der Werbeherr eine vereinbarte Geldsumme, mit der er die Anwerbung und den Sold der Geworbenen bezahlen sollte (=> Werbegeld). Manchmal stellte der Werbende auch Eigenmittel zur Verfügung, beteiligte sich so an der Finanzierung und wurde zum „Gläubiger-Obristen“ des Kriegsherrn. Zudem war der Werbeherr zumeist Regimentsinhaber der angeworbenen Truppen, was ihm zusätzliche beträchtliche Einnahmen verschaffte. Manche Rekruten wurden von den Werbeoffizieren doppelt gezählt oder unerfahrene, z. T. invalide und mangelhaft ausgerüstete Männer als schwerbewaffnete Veteranen geführt, um vom Obristen eine höhere Summe ausgezahlt zu erhalten. Auch Hauptleute, meist adliger Herkunft, stellten Kompanien oder Fähnlein auf eigene Kosten dem Kriegsherrn bzw. einem Obristen zur Verfügung, um dann in möglichst kurzer Zeit ihre Aufwendungen wieder hereinzuholen und noch Gewinne zu erzielen, was zu den üblichen Exzessen führen musste. Teilweise wurde die Anwerbung auch erschlichen oder erzwungen. Auf der Straße eingefangene Handwerker wurden für Wochen ins Stockhaus gesteckt und durch die Erschießung von Verweigerern zum Dienst gezwungen; SODEN, Gustav Adolph II, S. 508. Wie schwierig Werbungen bereits 1633 geworden waren, zeigen die Aufzeichnungen des Dr. Molther aus Friedberg; WAAS, Chroniken, S. 141: „Im Junio [1633] hat die hiesige Stadt und allenthalben die Grafschaften und adeligen Örter Volk geworben, welches zu Heilbrunn [April 1633] ist beschlossen worden, und hat die Stadt alhier 24 Mann sollen werben. Es ist aber keiner zu bekommen gewesen. Man hat einem zu Fuß geboten 10, 20, auch 30 Thaler, wohl auch 40, und hat doch fast niemand bekommen können. Derowegen hat der Officier, so das Volk abholen sollen, die Soldaten, so die Stadt Wetzlar geworben, hero geführet, so 16 Mann sind gewesen, und so lang hier behalten, bis die Stadt ihre 24 Mann hat gehabt. Darbei noch gedrohet, er wollte, so sie nicht balde geworben, die Burger und deren Söhne mitnehmen“. In einem Bericht aus Wien (Dezember 1634) heißt es: „Aus Schwaben und Bayern kommen wegen der großen Hungersnoth viele tausend Menschen auf der Donau herab, so dass man immer von Neuem werben und die Regimenter complettiren kann“. SODEN, Gustav Adolph III, S. 129. JORDAN, Mühlhausen, S. 90f. (1637) über den Werbeplatz Sporcks: „Den 4. April ist er wieder mit etlichen Völkern zurückgekommen und hat sich mit denselben hier einquartiret und seinen Werbeplatz hier gehabt, hat auch viel Volk geworben, wie denn die Eichsfelder und andere benachbarte häufig zuliefen und Dienst nahmen, nur daß sie ins Quartier kamen und die Leute aufzehren konnte. Viele trieb auch der Hunger. Als es aber ans Marchiren gehen sollte, so wurde aus dem Marchiren ein Desertieren“. Für Anfang 1643 heißt es über die Werbemethoden des schwedischen Kommandanten in Erfurt, Caspar Ermes; JORDAN, Mühlhausen, S. 97: „In diesem Jahre legte abermals der Commandant von Erfurt einen Capitän mit einer Compagnie Infanterie in die Stadt, um Soldaten zu werben. Weil sie aber nicht viel Rekruten bekamen, so machten sie einen listigen Versuch. Sie warfen Geld in die Straße; wenn nun jemand kam und es aufhob, so sagten sie, er hätte Handgeld genommen, er müsse nun Soldat werden. Im Weigerungsfalle steckten sie solchen Menschen in den Rabenturm, wo er so lange mit Wasser und Brod erhalten wurde, bis er Soldat werden wollte“. Vgl. RINKE, Lippe, S. 20f.. Die Hildesheimer Handwerksmeister berichteten dem Rat am 12./22.11.1638, dass „die Handwercksbursch […] vor den Stadtthoren nicht allein angehalten und befragt worden, ob sie Lust haben, sich alß Soldaten gebrauchen zu laßen, sondern auch überredet werden, daß sie keine Arbeit allhier bekommen können […] und wann sie sich deßen verweigern, die Werber […] sie dahin nötigen, daß sie Geldt nehmen oder […] ihnen die Bündel vom Halße schneiden undt anders, waß sie sonsten bey sich tragen, nehmen, biß sie sich zu der Soldaten Charge sich verstehen wollen“. PLATH, Konfessionskampf, S. 482. Unter 1642 heißt es in Raphs Chronik von Bietigheim (BENTELE, Protokolle, S. 200), dass der kaiserliche Obristwachtmeister Dusin 1642, weil er „mit Werbung eines Regiments und Musterung desselben gegen dem Bayerfürsten großen Falsch gebraucht, auch andere tyrannische Untaten in der Marggrafschaft Durlach und anderswo unerhört verüebt, hingegen mit Klaidungen Tractamenten und Dienern sich mehr als fürstlich haltend und hierdurch alles Geld, üppiglich vergeudet hat, zu Tüwingen[Tübingen; BW] uff der Burgstaig seinem Verschulden nach mit dem Schwert gerichtet worden. Sein Großvatter soll ein Großherzog zu Venedig gewesen sein“. Für unerlaubte Werbung drohte die Todesstrafe; MÜLLER, Unterpfalz, S. 63. Der Schweriner Dompropst und Ratzeburger Domherr, Otto von Estorf [1566-29.7.1637], berichtet zum April 1623: „Dietrich von Falkenstein ein Mansfeldischer Werber, so vor wenig tagen zue Breslau eingezogen, ist gerichtet, der Andere, so catholisch geworden, ist beim Leben erhalten“. DUVE, Diarium belli Bohemici et aliarum memorabilium, S. 26. Vgl. auch ERB, Die Werber in Schwallungen 1620; SCHENNACH, Tiroler Landesverteidigung, S. 275ff.
[10] Hans Ulrich Freiherr v. Schaffgotsch [Schaffguetsch, Schaffguezsch, Schafgutsch] [28.8.1595 Schloss Greiffenstein (bei Greiffenberg, Niederschlesien)-23.7.1635 Regensburg], kaiserlicher General. Vgl. KREBS, Hans Ulrich Freiherr von Schaffgotsch; HENKEL, Schaffgotsch.
[11] KREBS, Hans Ulrich Freiherr von Schaffgotsch, S. 172 (14).
[12] Feuerrohr: Büchse mit Luntenschloss; volkstümlich gebraucht auch für Musketier.
[13] ENGELBERT, Hatzfeldt, Schönst 6, S. 13. – Schmiedeberg [Kowary; LK Jelenia Góra]; HHSSchl, S. 476ff.
[14] Schweidnitz [Świdnica]; HHSSchl, S. 491ff.
[15] Kontribution: Kriegssteuern, die ein breites Spektrum an Sach- oder Geldleistungen umfasste, wurden im Westfälischen als „Raffgelder“ bezeichnet; SCHÜTTE, Dreißigjähriger Krieg, Nr. 45, S. 127; LEHMANN, Kriegschronik, S. 34, Anm. (1632): „Contribution eine große straffe, Sie erzwingt alles, was sonst nicht möglich ist“. Sie wurde auf Grundlage einer Abmachung zwischen Lokalbehörden (zumeist Städten) und Militärverwaltung erhoben. Teilweise wurde den Juden eine Sondersteuer auferlegt (HOCK, Kitzingen, S. 92), um sich selbst einer zusätzlichen Belastung zu entziehen. Die Kontribution wurde durch speziell geschultes, z. T. korruptes Personal (vgl. WAGNER; WÜNSCH, Staffel, S. 122ff.) zumeist unter Androhung militärischer Gewalt oder unter Androhung des Verlusts des Bürgerrechts (das in Erfurt seit 1510 ab dem 16. Lebensjahr erworben werden konnte), des Braurechts, der Benutzung der Allmende, den säumigen Bürgern „das Handwerk zu legen“ etc. (vgl. NÜCHTERLEIN, Wernigerode), und der Zunagelung der Haustüren (JORDAN, Mühlhausen, S. 76 (1633)) eingetrieben. Den Zahlenden wurde als Gegenleistung Schutz gegen die Übergriffe des Gegners in Aussicht gestellt. Nicht selten mussten an die beiden kriegführenden Parteien Kontributionen abgeführt werden, was die Finanzkraft der Städte, Dörfer und Herrschaften sehr schnell erschöpfen konnte. Auch weigerte sich z. T. die Ritterschaft wie im Amt Grimma erfolgreich, einen Beitrag zu leisten; LORENZ, Grimma, S. 667. Vgl. REDLICH, Contributions; ORTEL, Blut Angst Threnen Geld, der diese Euphemismen für Erpressungen, erwartete oder erzwungene „Verehrungen“ etc. auflistet. Der Anteil der Kontributionsgelder an den Einkünften der Generalkriegskommissare und Kriegskommissare betrug bis zu 30 %. So erhielt z. B. der kurbayerische Kriegskommissar Christoph von Ruepp vom 18.1.1621 bis 30.4.1633 95.341 fl., davon 30.347 fl. Kontributionsgelder. DAMBOER, Krise, S. 51. BELLINCKHAUSEN; TEGEDER; KREIENBRINK, S. 268, über die schwedische Einquartierung Dezember 1633 in Osnabrück: Die Soldaten „sagen und klagen, sie bekommen kein geld, da doch stets alle wochen die burger ihr contribution ausgeben mußen, dan das kriegsvolck sagt, das ihr obristen und befehlhaber das geldt zu sich nehmmen und sie mußenn hunger und kummer haben, werden zum stehlen verursacht“. Der Flussmeister und Advokat Johann Georg Maul [? – nach 1656)] (1638), WAGNER; WÜNSCH, Staffel, S. 121: „Weil ich nun zu dieser Contribut[ion] wöchentlich 7 f geben müssen und nicht allemahl sogleich bezahlet habe, bin ich und die Meinigen zu verschiedenen mahlen ohngewarneter Weisse überfallen worden, und man hat mich dermaasen gequälet und gemartert, dass es einen Steine in der Erdte erbarmen möchte, sonderlich in der Heilgen Zeit, am 5. Jan[uar] 1638, da ich eines kleinen Resto wegen von 6 vollgesoffenen Soldaten, der einer, der Berth genannt unter dem Obristen [Heinrich; BW] von Schleiniz, den Degen über mich gezogen, mein Weib, so dazwischen gelaufen, am Arme verwundet, den Gürtel von Leibe in drey Stücken gerissen und solche Grausamkeit verübet, dass es nicht zu beschreiben, vielweniger von Christlichen Menschen geglaubet werden kann, mitler weile, als dieser Berth also mit mir chargierte, haben die andern 5 Bösewichter gemauset, was sie angetroffen, unter andern mir einen Fisch Otter, so man an die Arme stecket, mein Kamm Futter mit aller Zugehör vor 5 f, allerhand Geräthe ohngefähr 8 f, so ich nicht wieder bekommen können“. Aus der Stausenbacher Chronik des Caspar Preis für 1648, ECKHARDT; KLINGELHÖFER, Bauernleben, S. 69: „Im Jahr 1649 in dem Monadt October seind wir einmal der Hessischen Conterbutzion erleitigt worden. Dem allmächtigen, ewigen, barmhertzigen, liben, trewen Gott, dem Vatter aller Gnaden, sey ewigen Lob, Ehr und Preiß gesagt in alle ewigkeit. Amen. In dem schweren Joch der hesischen Conterbutzion seind wir gemartert, gepeinigt und gequället worden zwantzig gantzer Jahr. Ach du mein Gott und mein Herr, wie mancher armer redtlicher ehrlicher Man hatt doch das Seinige musen verlasen und mit dem Rück ansehen und sich in die Fremde begeben musen wegen der Conterbutzion und des gemarterten Bludtgelts. Es ist doch in Wharheit nichts anders dan der armen Leuth Schweiß und Blutt“. Vgl. VOGEL, Leipzigisches Geschicht-Buch, S. 443: „Den 11 Junii [1631; BW] zur Nacht hat sich eines vornehmen Doctoris Frau im Brühl / welches mit schwermüthigen Gedancken beladen aufm Gange im Hembde an eine Quele erhencket / weil sie / wie man sagte / denen Soldaten Quartier und Geld geben müssen / welche 2 alte Weiber loßgeschnitten / von Todtengräbern abgehohlet / und den 13. dieses mit einer kleinen Schule begraben worden“. Der Anteil der Kontributionsgelder an den Einkünften der Generalkriegskommissare und Kriegskommissare betrug bis zu 30 %. So erhielt z. B. der kurbayerische Kriegskommissar Christoph von Ruepp vom 18.1.1621 bis 30.4.1633 95.341 fl., davon 30.347 fl. Kontributionsgelder. DAMBOER, Krise, S. 51. Die Kontribution wurde oft auch zweckentfremdet; vgl. SEMLER, Tagebücher, S. 23 (1633): „Man sagt, daß die von Bodman ohngefahr 30 thaler für ihre contribution dem obrist leüttenant [Edlinstetten; BW] alhie, alß ihrem vettern, zu hannden gestellt, darmit sie ihme genůgsambe satisfaction geben, er aber diß gellt dem apotegger zutragen laßen mit begeren, solle ihme darumb confect schickhen. Da man vnß aber bereden wollen, auß disem contribution gellt werde man die soldaten beklaiden vnd in daß veld ausstaffieren“. Die ausführlichste Darstellung der Erpressung von Kontributionen durch Besatzungstruppen findet sich bei NÜCHTERLEIN, Wernigerode, S. 73ff. => Hrastowacky in den „Miniaturen“. VOGEL, Leipzigisches Geschicht-Buch, S. 443: „Den 11 Junii [1631; BW] zur Nacht hat sich eines vornehmen Doctoris Frau im Brühl / welches mit schwermüthigen Gedancken beladen aufm Gange im Hembde an eine Quele erhencket / weil sie / wie man sagte / denen Soldaten Quartier und Geld geben müssen / welche 2 alte Weiber loßgeschnitten / von Todtengräbern abgehohlet / und den 13. dieses mit einer kleinen Schule begraben worden“. In den bei Angriffen und Belagerungen ohnehin gefährdeten Vorstädten waren die Kontributionsleistungen geringer. Allerdings bestand hier auch immer die Gefahr, dass die Vorstädte entweder vom Feind abgebrannt oder seitens der Stadtkommandanten abgerissen oder abgetragen wurden, um dem Feind keine Verstecke zu bieten und um ein freies Schussfeld zu haben.
[16] Franz Albrecht Herzog v. Sachsen-Lauenburg [10.11.1598 Lauenburg-10.6.1642 Schweidnitz], kaiserlich-kursächsischer Feldmarschall.
[17] Kompanie [schwed. kompani, dän. kompany]: Eine Kompanie zu Fuß (kaiserlich, bayerisch und schwedisch) umfasste von der Soll-Stärke her 100 Mann, doch wurden Kranke und Tote noch 6 Monate in den Listen weiter geführt, so dass ihre Ist-Stärke bei etwa 70-80 Mann lag. Eine Kompanie zu Pferd hatte bei den Bayerischen 200, den Kaiserlichen 60, den Schwedischen 80, manchmal bei 100-150, zum Teil allerdings auch nur ca. 30. Geführt wurde die Fußkompanie von einem Hauptmann, die berittene Kompanie von einem Rittmeister. Vgl. TROUPITZ, Kriegs-Kunst. Vgl. auch „Kornett“, „Fähnlein“, „Leibkompanie“.
[18] Frankfurt a. d. Oder; HHSD X, S. 177ff.
[19] Obrist [schwed. överste, dän. oberst]: I. Regimentskommandeur oder Regimentschef mit legislativer und exekutiver Gewalt, „Bandenführer unter besonderem Rechtstitel“ (ROECK, Als wollt die Welt, S. 265), der für Bewaffnung und Bezahlung seiner Soldaten und deren Disziplin sorgte, mit oberster Rechtsprechung und Befehlsgewalt über Leben und Tod. Dieses Vertragsverhältnis mit dem obersten Kriegsherrn wurde nach dem Krieg durch die Verstaatlichung der Armee in ein Dienstverhältnis umgewandelt. Voraussetzungen für die Beförderung waren (zumindest in der kurbayerischen Armee) richtige Religionszugehörigkeit (oder die Konversion), Kompetenz (Anciennität und Leistung), finanzielle Mittel (die Aufstellung eines Fußregiments verschlang 1631 in der Anlaufphase ca. 135.000 fl.) und Herkunft bzw. verwandtschaftliche Beziehungen (Protektion). Zum Teil wurden Kriegskommissare wie Johann Christoph Freiherr v. Ruepp zu Bachhausen zu Obristen befördert, ohne vorher im Heer gedient zu haben; Bayerisches Hauptstaatsarchiv München Kurbayern Äußeres Archiv 2398, fol. 577 (Ausfertigung): Ruepp an Maximilian I., Gunzenhausen, 1631 XI 25. Der Obrist ernannte die Offiziere. Als Chef eines Regiments übte er nicht nur das Straf- und Begnadigungsrecht über seine Regimentsangehörigen aus, sondern er war auch Inhaber einer besonderen Leibkompanie, die ein Kapitänleutnant als sein Stellvertreter führte. Ein Obrist erhielt in der Regel einen Monatssold von 500-800 fl. je nach Truppengattung, 500 fl. zu Fuß, 600 fl. zu Roß [nach der „Ordnung Wie es mit der verpflegung der Soldaten“ (1630)] in der kurbrandenburgischen Armee 1.000 fl. „Leibesbesoldung“ nebst 400 fl. Tafelgeld und 400 fl. für Aufwärter. In besetzten Städten (1626) wurden z. T. 920 Rt. erpresst (HEIMATMUSEUM SCHWEDT, Die Uckermark, S. 15). Nach Wallensteins Verpflegungsordnbung (1629) standen ihm als Obrist und Hauptmann der Infanterie 800 Rt. monatlich zu; KRAUSE, Urkunden 1. Bd., S. 460. Daneben bezog er Einkünfte aus der Vergabe von Offiziersstellen. Weitere Einnahmen kamen aus der Ausstellung von Heiratsbewilligungen, aus Ranzionsgeldern – 1/10 davon dürfte er als Kommandeur erhalten haben – , Verpflegungsgeldern, Kontributionen, Ausstellung von Salvagardia-Briefen – die er auch in gedruckter Form gegen entsprechende Gebühr ausstellen ließ – und auch aus den Summen, die dem jeweiligen Regiment für Instandhaltung und Beschaffung von Waffen, Bekleidung und Werbegeldern ausgezahlt wurden. Da der Sold teilweise über die Kommandeure ausbezahlt werden sollten, behielten diese einen Teil für sich selbst oder führten „Blinde“ oder Stellen auf, die aber nicht besetzt waren. Auch ersetzten sie zum Teil den gelieferten Sold durch eine schlechtere Münze. Zudem wurde der Sold unter dem Vorwand, Ausrüstung beschaffen zu müssen, gekürzt oder die Kontribution unterschlagen. BELLINCKHAUSEN; TEGEDER; KREIENBRINK, der osnabrugischenn handlung, S. 277 (1634) zur schwedischen Garnison: „Am gemelten dingstage sein 2 Soldaten bey mir hergangen bey r[atsherr] Joh[ann] Fischers hause. Der ein sagt zum andern: In 3 Wochen habe ich nur 12 ß [Schilling = 6 Heller = 12 Pfennig; das entsprach insgesamt dem Tageslohn eines Maurers; BW]. Ich wol, das der donner und der blytz inn der statt schlüge, das es bränte und kein hauß stehen bliebe. Muß das nicht Gott erbarmen. Wir burger mußen alle wochen unse contribution zahlen, die obristen nehmmens geldt zu sich, und die gemeinen soldaten mußen hunger leyden“. Zur brandenburgischen Armee heißt es; OELSNITZ, Geschichte, S. 64: „Fälle, daß die Obersten mit ihren Werbegeldern durchgingen, gehörten nicht zu den größten Seltenheiten; auch stimmte bei den Musterungen die Anzahl der anwesenden Mannschaften außerordentlich selten mit den in der Kapitulation bedingten. So sollte das Kehrberg’sche [Carl Joachim v. Karberg; BW] Regiment 1638 auf 600 Mann gebracht werden, es kam aber nie auf 200. Es wurde dem Obersten der Proceß gemacht, derselbe verhaftet und kassirt. Aehnlich machte es der Oberst Rüdiger v. Waldow [Rüdiger [Rötcher] v. Waldow; BW] und es ließen sich noch viele ähnliche Beispiele aufführen“. Vgl. BELLINCKHAUSEN; TEGEDER; KREIENBRINK, der osnabrugischen handlung, S. 277: „Wir burger mußen alle wochen unse contribution zahlen, die obristen nehmmens geldt zu sich, und die gemeinen soldaten mußen hunger leyden“. Der Austausch altgedienter Soldaten durch neugeworbene diente dazu, ausstehende Soldansprüche in die eigene Tasche zu stecken. Zu diesen „Einkünften“ kamen noch die üblichen „Verehrungen“, die mit dem Rang stiegen und nichts anderes als eine Form von Erpressung darstellten, und die Zuwendungen für abgeführte oder nicht eingelegte Regimenter („Handsalben“) und nicht in Anspruch genommene Musterplätze; abzüglich allerdings der monatlichen „schwarzen“ Abgabe, die jeder Regimentskommandeur unter der Hand an den Generalleutnant oder Feldmarschall abzuführen hatte; Praktiken, die die obersten Kriegsherrn durchschauten. Zudem erbte er den Nachlass eines ohne Erben und Testament verstorbenen Offiziers. Häufig stellte der Obrist das Regiment in Klientelbeziehung zu seinem Oberkommandierenden auf, der seinerseits für diese Aufstellung vom Kriegsherrn das Patent erhalten hatte. Der Obrist war der militärische ‚Unternehmer‘, die eigentlich militärischen Dienste wurden vom Major geführt. Das einträgliche Amt – auch wenn er manchmal „Gläubiger“-Obrist seines Kriegsherrn wurde – führte dazu, dass begüterte Obristen mehrere Regimenter zu errichten versuchten (so verfügte Werth zeitweise sogar über 3 Regimenter), was Maximilian I. von Bayern nur selten zuließ oder die Investition eigener Geldmittel von seiner Genehmigung abhängig machte. Im April 1634 erging die kaiserliche Verfügung, dass kein Obrist mehr als ein Regiment innehaben dürfe; ALLMAYER-BECK; LESSING, Kaiserliche Kriegsvölker, S. 72. Die Möglichkeiten des Obristenamts führten des Öfteren zu Misshelligkeiten und offenkundigen Spannungen zwischen den Obristen, ihren karrierewilligen Obristleutnanten (die z. T. für minderjährige Regimentsinhaber das Kommando führten; KELLER, Drangsale, S. 388) und den intertenierten Obristen, die auf Zeit in Wartegeld gehalten wurden und auf ein neues Kommando warteten. Zumindest im schwedischen Armeekorps war die Nobilitierung mit dem Aufstieg zum Obristen sicher. Zur finanziell bedrängten Situation mancher Obristen vgl. dagegen OMPTEDA, Die von Kronberg, S. 555. Da der Obrist auch militärischer Unternehmer war, war ein Wechsel in die besser bezahlten Dienste des Kaisers oder des Gegners relativ häufig. Der Regimentsinhaber besaß meist noch eine eigene Kompanie, so dass er Obrist und Hauptmann war. Auf der Hauptmannsstelle ließ er sich durch einen anderen Offizier vertreten. Ein Teil des Hauptmannssoldes floss in seine eigenen Taschen. Dazu beanspruchte er auch die Verpflegung. OELSNITZ, Geschichte, S. 64f.: Der kurbrandenburgische Geheime Rat Adam Graf zu „Schwarzenberg spricht sich in einem eigenhändigen Briefe (22. August 1638) an den Geheimen Rath etc. v. Blumenthal [Joachim Friedrich Freiherr v. Blumenthal; BW] sehr nachtheilig über mehrere Obersten aus und sagt: ‚weil die officierer insgemein zu geitzig sein und zuviel prosperiren wollen, so haben noch auf die heutige stunde sehr viele Soldaten kein qvartier Aber vnter dem schein als ob Sie salvaguardien sein oder aber alte reste einfodern sollen im landt herumb vagiren vnd schaffen ihren Obristen nur etwas in den beutel vnd in die küch, Es gehöret zu solchen dantz mehr als ein paar weißer schue, das man dem General Klitzingk [Hans Kaspar [Caspar] v. Klitzing; BW] die dispositiones vom Gelde und vonn proviant laßen sollte, würde, wan Churt borxtorff [Konrad [Kurt] Alexander Magnus v. Burgsdorff; BW] Pfennigmeister vnd darvber custos wehre der katzen die kehle befohlen sein, wir haben vnd wissen das allbereit 23 Stäbe in Sr. Churf. Drchl. Dienst vnd doch ist kein einsiger ohne der alte Obrister Kracht [Hildebrand [Hillebrandt] v. Kracht; BW] der nit auß vollem halse klaget als ob Man Ihme ungerecht wehre, ob Sie In schaden gerieten, Man sol sie vornemen Insonderheit die, welche 2000 zu lievern versprochen vnd sich nit 300 befinden vndt sol also exempel statuiren – aber wer sol Recht sprechen, die höchste Im kriegsrath sein selber intressirt vnd mit einer suppen begossen“. Ertragreich waren auch Spekulationen mit Grundbesitz oder der Handel mit (gestohlenem) Wein (vgl. BENTELE, Protokolle, S. 195), Holz, Fleisch oder Getreide. Zum Teil führte er auch seine Familie mit sich, so dass bei Einquartierungen wie etwa in Schweinfurt schon einmal drei Häuser „durch- und zusammen gebrochen“ wurden, um Raum zu schaffen; MÜHLICH; HAHN, Chronik 3. Bd., S. 504. Die z. T. für den gesamten Dreißigjährigen Krieg angenommene Anzahl von rund 1.500 Kriegsunternehmern, von denen ca. 100 bis 300 gleichzeitig agiert hätten, ist nicht haltbar, fast alle Regimentsinhaber waren zugleich auch Kriegs- bzw. Heeresunternehmer. II. Manchmal meint die Bezeichnung „Obrist“ in den Zeugnissen nicht den faktischen militärischen Rang, sondern wird als Synonym für „Befehlshaber“ verwandt. Vgl. KAPSER, Heeresorganisation, S. 101ff.; BOCKHORST, Westfälische Adelige, S. 15ff., REDLICH, German military enterpriser; DAMBOER, Krise; WINKELBAUER, Österreichische Geschichte 1. Bd., S. 413ff.
[20] Hans Georg v. Arnim-Boitzenburg [1583 Boitzenburg-28.4.1641 Dresden], polnische, dann schwedische Dienste, 1627 kaiserlicher Obrist, Feldmarschall, 1630 kurbrandenburgischer u. kursächsischer Feldmarschall, 1635 Ausscheiden wegen Prager Frieden, 1637 Verschleppung nach Schweden u. Flucht, ab 1641 Reorganisation der kursächsischen Armee. Vgl. STADTMUSEUM SCHWEDT, Die Uckermark, S. 30ff.
[21] ENGELBERT, Hatzfeldt, Schönst 1, S. 4. – Bützow [LK Rostock]; HHSD XII, S. 120ff.
[22] Sternberg [Torzym, LK Sulęcin; heute Polen]; HHSD X, S. 467f.
[23] Johann Albrecht II. Herzog v. Mecklenburg-Güstrow [5.5.1590 Waren-23.4.1636 Güstrow].
[24] Schaan [LK Rostock].
[25] Gemeint waren wahrscheinlich Lothringer, Truppen Karls IV. Herzog v. Lothringen [5.4.1604 Nancy-18.9.1675 Allenbach (bei Birkenfeld)], die im Reich einen außerordentlich schlechten Ruf genossen. Jeremias Drexel SJ, der Maximilian I. auf seinem Böhmischen Feldzug begleitete, gesteht am 30.7.1620; RIEZLER, Kriegstagebücher, S. 92, „dass die Lothringer in dem eroberten Schlosse Aisterheim schlimmer als die Türken hausten. Die Trossknechte im Gefolge der fünf lothringischen Schadronen haben diesem Berichterstatter den Eindruck gemacht, als habe man von vielen Galgen die Diebe gesammelt. Überhaupt scheinen sich die schlimmsten Elemente im ligistischen Heere unter den Lothringern befunden zu haben. Wir erfahren von Angehörigen dieser Truppen, die Krankheit simulierten, um im Wagen gefahren zu werden, dann an einem abgelegenen Ort ihren Fuhrknecht ermordeten und sich mit den Pferden und aller sonst erreichbaren Beute aus dem Staube machten“. THEATRUM EUROPAEUM 2. Bd., S. 493 (1631): „Es hat diß Volck auch an andern Orthen / da sie auffgebrochen / also gehauset vnnd Tyrannisiret / daß es ein Stein erbarmen mögen: alles auff den eussersten Grad verderbet / geplündert / den Haußraht verbrennet / das Bettwerck in die Lufft gestrewet / vnd andern vnmenschlichen Muthwillen verübet / nicht anders als wann die Innwohner ihre abgesagte Feinde gewesen: Sonsten aber waren sie so forchtsamb vnd verzagt / vnnd dorfften ihres Manns / ob sie schon offtmals als demselben an der Anzahl vberlegen / nit erwarten“. Melchior Adam Pastorius [1624 Erfurt-1702 Nürnberg], Bürgermeister und Oberrichter in Bad Windsheim (1631) fest; PASTORIUS, Kurtze Beschreibung, S. 111f.: „Bald ruckte die Lothringische Armee hernach / die plünderte das gantze Land aus / und suchten diejenige Bauren Leute / so mit ihrem Vieh in die Wälder gewichen waren / mit Hunden auf / etliche übel bekleidete waren im Walde erforen / etliche hatten was Vieh / in die Stadt geflüchtet / das starb Hungers / weilen auch das Futter in der Stadt alles ausgezehret war / man konnte kein Aas hinausführen lassen / daß verursachte Gestanck / Kranckheit und Sterben. Es wurden damals weder Kirchen noch Schulen gehalten / auch keine Wachten gehalten / noch sonsten etwas in der Stadt verrichtet / jederman bliebe zu Hause wie ein Dachs in seiner Höhlen. Und dieses Volck hiesse man den Tyllischen Zug“. Der Chronist Sebastian Dehner [25.8.1612 Rothenburg-13.6.1679] hält fest; HELLER, Rothenburg, S. 77f.: „30. Oktober an einem Sonntag zu Nachts umb Horn ist daß Galgenthor geöffnet worden, da ist der Lothringer mit seinem Volck, lauter Franzosen, hereingezogen, alßbald Rathhauß, Rüstkammer und den Mark mit Schildwach bestellet, auf dem Mark viel Feuer angezündet, dabey Schwein, Schaf, Hünner, Gänß, waß u. wo sie waß gefunden, gebraten, gesotten und recht soldatisch angefangen zu leben. Nach Mitternacht fingen sie an, die Häußer mit Gewalt zu erbrechen und die Leute zu tribuliren, alleß zu plündern, zu nemmen, zu schlagen, daß ein groses Lamentiren, Weinen, Heulen, Klagen und Schreyen in allen Gaßen und Häusern entstanden; die Leuth Geld zu geben mit Stößen und Schlägen genötiget, in manchem Hauß Truhen und Kasten, Alleß zerschlagen, die Leuth auf der Gaßen außgezogen u. s. w. Man hat fast nichts sowohl verschoben, welches sie nicht gesucht und gefunden. Es hat kein Bürgermeister noch Herr mehr aufs Rathhauß gekönnt noch gedörft; Läuten und Schlagen, Kirchen- und Schulengehen ist alles innengestanden. 31. Octobr. Montag gegen Tag, als es hell worden, sind mehr Soldaten in die Statt gelaßen worden und was die Vörige nit genommen und verwüst, haben dieße vollend genommen; sind manche Häußer rein außspoliert worden; ist eine Parthey auß- die andere eingangen. Gegen Ausschlagen sind etliche Teutsche für das lateinische Schulhauß kommen fürgebend, sie wären salva guardia, welchen der H. Rector die Thür geöffnet; aber alß sie hinaufkommen, haben sie den Rector geschlagen, Geld u. Silbergeschmeid und Kleider genommen und damit fort, welchen alßbald bey 16 Franzosen mit ihren Büxen[25] und brennenden Lunten gefolget, ins Hauß gangen, der armen Schuler Mäntel, Kleider, Hüt und Schuhe genommen und alß solche fortwaren, und die Kuhe auß dem Stall war, hat man die Tür in Eil wider von Innen zugeschlagen, were sonst alles genommen und verwüst worden. […] Am Sambst: und Sonntag hat man die Völkher erst recht einquartiert: je einem 4. 5. 6.; denen hat man nach der Volle müßen Freßen und Saußen schaffen, wie und waß sie begeret, und Leibs und Lebens nit recht sicher bey ihnen gewest, oftmalß alleß auß den Häusern geschlagen und darinnen nach ihrem Muthwillen gehauset und den Leuthen mit großer Bedrohung offentlich unter die Augen gesagt, Alleß, waß noch übrig in Häußern, were ihr. ‚Vatter hinauß, mein ist das Hauß !‘ u. s. w. ‚Ihr Rebellen ! Ihr Schelmen ! Ihr Dieb ! Ihr Mayneidige !‘ “
[26] ENGELBERT, Hatzfeldt, Schönst 6, S. 13.
[27] BEHR, Ueber das Archiv des Stifts Schwerin, S. 87.
[28] Bangsbo, heute Ortsteil von Frederikshaven [Nordjyllands A, Jütland]; HHSDänemark, S. 47f.
[29] Frederikshaven [Nordjyllands A, Jütland]; HHSDänemark, S. 47f.
[30] Skagen [Kommune Frederikshaven, Nordjyllands A, Jütland]; HHSDänemark, S. 47f.
[31] Læsø [Nordjyllands A, Jütland].
[32] ENGELBERT, Hatzfeldt, Schönst 6, S. 13. – Hals [Nordjyllands A, Jütland]; HHSDän, S. 66.
[33] Elling [Kommune Frederikshaven, Nordjyllands A, Jütland]; HHSDänemark, S. 47f.
[34] ENGELBERT, Hatzfeldt, Schönst 6, S. 13.
[35] Schanze: geschlossenes, auf dem Feld angelegtes Erdwerk, zur Belagerung und zur Verteidigung. Schanzgräber waren für die Anlage von Belagerungs- und Verteidigungswerken zuständige Arbeiter (Schanzbauern), die im Tross des Heeres mitzogen und dem Schanzmeister unterstanden. Sie waren weitgehend verachtete Menschen, die in der sozialen Hierarchie der Heere nur wenig über den Prostituierten standen und schlecht bezahlt wurden. Auch verurteilte Straftäter wurden zu Schanzarbeiten herangezogen. Diese „Condemnatio ad opera publica”, die Verurteilung zu Schanzarbeiten, war als Todesstrafe in absehbarer Zeit gedacht. Bürger und Geistliche der besetzten Städte sowie Klosteruntertanen, die zu diesen Arbeiten verpflichtet bzw. dafür ausgelost wurden, empfanden diese schwere Arbeit als ehrenrührig und entzogen sich ihr durch die Flucht. Zum Teil wurden Kinder ab 12 Jahren zu dieser harten Arbeit eingesetzt, ganze Schulklassen dazu getrieben. Vgl. auch die Beschreibung der Drangsalierung der Bürger Iglaus 1647 bei STERLY, Drangsale, S. 64f.. Um seine eigenen Truppen zu schonen, zwang Johann von Götz bei der Belagerung der Feste Marienberg (Würzburg) eine große Anzahl von Bauern der Umgebung, Schanzarbeiten zu verrichten, ‚vnd die Stücke, die Er mit Pferden nicht dahin bringen konnte, hinauffzuziehen: Worüber dan viele todt geblieben, vnd daher die Bauren aller orten sich häuffig absentiret vnd verlauffen’ (CHEMNITZ, Königlich Schwedichen […] II, S. 581). Auch eingeflüchtete Bauern wurden zu diesen schweren Arbeiten gezwungen. Im schwedischen Heer wurden dazu bevorzugt die ohnehin sozial deklassierten Finnen eingesetzt (vgl. auch TOEPPEN, Hoppes Chronik, S. 77). Reichskanzler Oxenstierna hatte auch den Frankfurtern die Verpflichtung der Bettler zum Festungs- bzw. Schanzenbau empfohlen. Im 17. Jahrhundert wurden zunehmend auch Soldaten durch die Aufnahme der Schanzpflicht in die Artikelbriefe für Schanzarbeiten herangezogen; ein Versuch der Fürsten, ein bisher ungenutztes Reservoir an billigen Arbeitskräften zu erschließen, eine Reaktion auf die neuen militärischen Erfordernisse (Belagerungs- und Grabenkrieg, Ausbreitung der Festungen) und Ausdruck des fürstlichen Willens, die Soldaten körperlich, geistig und sittlich zu disziplinieren (vgl. BURSCHEL, Söldner, S. 138, 255).Bei den Schweden wurden bevorzugt die Finnen zu diesen schweren Arbeiten herangezogen. Aus Iglau wird unter 1647 berichtet, wie der schwedische Kommandant Österling die nur noch 299 [von ehemals 13.000) Einwohner fassende Stadt während der Belagerung durch die Kaiserlichen zur Schanzarbeit trieb; STERLY, Drangsale, S. 64f.: „In das kaiserliche Lager langte immer mehr und mehr schweres Geschütz an; als dieses der Kommandant erfuhr; ließ er er voll Grimm die Einwohner wie das mit aller Gewalt auf die Schanzarbeit treiben, und erließ das strengste Verboth, daß außer dieser Arbeit sich keine Manns- noch Weibsperson sehen lasse. Was war dieses für ein Trübsal unter den armen Bürgern ! dieselben hatten ihren geringen Vorrath an den nothwendigsten Lebensmitteln bereits aufgezehrt, und konnten sich bei dem bestehenden strengsten Verbothe, nicht auszugehen, keine andere beischaffen; vom Hunger und Durst gequält, und daher ganz erschöpft, mussten sie sich dennoch den schwersten Arbeiten unterziehen. Der Kommandant war taub gegen alles Bitten und Flehen; verlangten einige die Erlaubniß, sich aus der Stadt zu entfernen, so ließ er sie in den Zwinger einschließen, ihnen des Tags ein bischen Brot und ein wenig Wasser reichen, dafür aber unter Schlägen zur Arbeit anhalten. Als der Kommandant die Deserzion zweier seiner Leute am vorhergehenden Tage erfuhr, und besorgte, daß Mehrere diesem Beispiele folgen dürften, so ließ er den Arbeitenden Fußeisen anlegen“.
[36] ENGELBERT, Hatzfeldt, Schönst 6, S. 13.
[37] ENGELBERT, Hatzfeldt, Schönst 6, S. 13. – Huteloff-Kloster: nicht identifiziert.
[38] ENGELBERT, Hatzfeldt, Schönst 6, S. 13.
[39] Friede von Lübeck: Friede von Lübeck vom 22.5.1629 zwischen Ferdinand II. und Christian IV. von Dänemark: Der König und sein Sohn verzichteten auf die norddeutschen Stifte.
[40] Steinau a. O. [Śinawa, Kr. Wohlau]; HHSSchl, S. 517ff.
[41] schwedische Armee: Trotz des Anteils an ausländischen Söldnern (ca. 85 %; nach GEYSO, Beiträge II, S. 150, Anm., soll Banérs Armee 1625 bereits aus über 90 % Nichtschweden bestanden haben) als „schwedisch-finnische Armee“ bezeichnet. Die Unterscheidung zwischen der „Royal-Armee“, die v. Gustav II. Adolf selbst geführt wurde, u. den v. den Feldmarschällen seiner Konföderierten geführten „bastanten“ Armeen erscheint angesichts der Operationen der letzteren überflüssig. Nach LUNDKVIST, Kriegsfinanzierung, S. 384, betrug der Mannschaftsbestand (nach altem Stil) im Juni 1630 38.100, Sept. 1631 22.900, Dez. 1631 83.200, Febr./März 1632 108.500, Nov. 1632 149.200 Mann; das war die größte paneuropäische Armee vor Napoleon. 9/10 der Armee Banérs stellten deutsche Söldner; GONZENBACH, Der General Hans Ludwig von Erlach von Castelen II, S. 130. Schwedischstämmige stellten in dieser Armee einen nur geringen Anteil der Obristen. So waren z. B. unter den 67 Generälen und Obristen der im Juni 1637 bei Torgau liegenden Regimenter nur 12 Schweden; die anderen waren Deutsche, Finnen, Livländern, Böhmen, Schotten, Iren, Niederländern und Wallonen; GENTZSCH, Der Dreißigjährige Krieg, S. 208. Vgl. die Unterredung eines Pastors mit einem einquartierten „schwedischen“ Kapitän, Mügeln (1642); FIEDLER, Müglische Ehren- und Gedachtnis-Seule, S. 208f.: „In dem nun bald dieses bald jenes geredet wird / spricht der Capitain zu mir: Herr Pastor, wie gefället euch der Schwedische Krieg ? Ich antwortet: Der Krieg möge Schwedisch / Türkisch oder Tartarisch seyn / so köndte er mir nicht sonderlich gefallen / ich für meine Person betete und hette zu beten / Gott gieb Fried in deinem Lande. Sind aber die Schweden nicht rechte Soldaten / sagte der Capitain / treten sie den Keyser und das ganze Römische Reich nicht recht auff die Füsse ? Habt ihr sie nicht anietzo im Lande ? Für Leipzig liegen sie / das werden sie bald einbekommen / wer wird hernach Herr im Lande seyn als die Schweden ? Ich fragte darauff den Capitain / ob er ein Schwede / oder aus welchem Lande er were ? Ich bin ein Märcker / sagte der Capitain. Ich fragte den andern Reuter / der war bey Dreßden her / der dritte bey Erffurt zu Hause / etc. und war keiner unter ihnen / der Schweden die Zeit ihres Lebens mit einem Auge gesehen hette. So haben die Schweden gut kriegen / sagte ich / wenn ihr Deutschen hierzu die Köpffe und die Fäuste her leihet / und lasset sie den Namen und die Herrschafft haben. Sie sahen einander an und schwiegen stille“. Vgl. auch das Streitgespräch zwischen einem kaiserlich und einem schwedisch Gesinnten „Colloquium Politicum“ (1632). Zur Fehleinschätzung der schwedischen Armee (1642): FEIL, Die Schweden in Oesterreich, S. 355, zitiert [siehe VD17 12:191579K] den Jesuiten Anton Zeiler (1642): „Copey Antwort-Schreibens / So von Herrn Pater Antoni Zeylern Jesuiten zur Newstadt in under Oesterreich / an einen Land-Herrn auß Mähren / welcher deß Schwedischen Einfalls wegen / nach Wien entwichen / den 28 Junii An. 1642. ergangen : Darauß zu sehen: I. Wessen man sich bey diesem harten und langwürigen Krieg in Teutschland / vornemlich zutrösten habe / Insonderheit aber / und für das II. Was die rechte und gründliche Ursach seye / warumb man bißher zu keinem Frieden mehr gelangen können“. a. a. O.: „Es heisst: die Schweden bestünden bloss aus 5 bis 6000 zerrissenen Bettelbuben; denen sich 12 bis 15000 deutsche Rebellen beigesellt. Da sie aus Schweden selbst jährlich höchstens 2 bis 3000 Mann ‚mit Marter und Zwang’ erhalten, so gleiche diese Hilfe einem geharnischten Manne, der auf einem Krebs reitet. Im Ganzen sei es ein zusammengerafftes, loses Gesindel, ein ‚disreputirliches kahles Volk’, welches bei gutem Erfolge Gott lobe, beim schlimmen aber um sein Erbarmen flehe“. Im Mai 1645 beklagte Torstensson, dass er kaum noch 500 eigentliche Schweden bei sich habe, die er trotz Aufforderung nicht zurückschicken könne; DUDÍK, Schweden in Böhmen und Mähren, S. 160.
[42] Breslau [Wrocław]; HHSSchl, S. 38ff.
[43] Hans Georg v. Arnim-Boitzenburg [1583 Boitzenburg-28.4.1641 Dresden], polnische, dann schwedische Dienste, 1627 kaiserlicher Obrist, Feldmarschall, 1630 kurbrandenburgischer u. kursächsischer Feldmarschall, 1635 Ausscheiden wegen Prager Frieden, 1637 Verschleppung nach Schweden u. Flucht, ab 1641 Reorganisation der kursächsischen Armee. Vgl. STADTMUSEUM SCHWEDT, Die Uckermark, S. 30ff.
[44] Ohlau [Oława]; HHSSchl, S. 373ff.
[45] Brieg [Brzeg]; HHSSchl, S. 54ff.
[46] Namslau [Namysłów]; HHSSchl, S. 326ff.
[47] Kriegsgefangene: Zur Gefangennahme vgl. die Reflexionen bei MAHR, Monro, S. 46: „Es ist für einen Mann besser, tüchtig zu kämpfen und sich rechtzeitig zurückzuziehen, als sich gefangennehmen zu lassen, wie es am Morgen nach unserem Rückzug vielen geschah. Und im Kampf möchte ich lieber ehrenvoll sterben als leben und Gefangener eines hartherzigen Burschen sein, der mich vielleicht in dauernder Haft hält, so wie viele tapfere Männer gehalten werden. Noch viel schlimmer ist es, bei Gefangennahme, wie es in gemeiner Weise immer wieder geübt wird, von einem Schurken nackt ausgezogen zu werden, um dann, wenn ich kein Geld bei mir habe, niedergeschlagen und zerhauen, ja am Ende jämmerlich getötet zu werden: und dann bin ich nackt und ohne Waffen und kann mich nicht verteidigen. Man Rat für den, der sich nicht entschließen kann, gut zu kämpfen, geht dahin, daß er sich dann wenigstens je nach seinem Rang gut mit Geld versehen soll, nicht nur um stets selbst etwas bei sich zu haben, sondern um es an einem sicheren Ort in sicheren Händen zu hinterlegen, damit man ihm, wenn er gefangen ist, beistehen und sein Lösegeld zahlen kann. Sonst bleibt ihm nichts anderes übrig, als sich zu entschließen, in dauernder Gefangenschaft zu bleiben, es sei denn, einige edle Freunde oder andere haben mit ihm Mitleid“. Nach LAVATER, Kriegs-Büchlein, S. 65, hatten folgende Soldaten bei Gefangennahme keinerlei Anspruch auf Quartier (Pardon): „wann ein Soldat ein eysen, zinne, in speck gegossen, gekäuete, gehauene oder gevierte Kugel schiesset, alle die gezogene Rohr und französische Füse [Steinschloßflinten] führen, haben das Quartier verwirkt. Item alle die jenigen, die von eysen geschrotete, viereckige und andere Geschröt vnd Stahel schiessen, oder geflammte Dägen, sollt du todt schlagen“. Leider reduziert die Forschung die Problematik der de facto rechtlosen Kriegsgefangenen noch immer zu einseitig auf die Alternative „unterstecken“ oder „ranzionieren“. Der Ratsherr Dr. Plummern berichtet (1633); SEMLER, Tagebücher, S. 65: „Eodem alß die von Pfullendorff avisirt, daß ein schwedischer reütter bei ihnen sich befinnde, hatt vnser rittmaister Gintfeld fünf seiner reütter dahin geschickht sollen reütter abzuholen, welliche ihne biß nach Menßlißhausen gebracht, allda in dem wald spolirt vnd hernach zu todt geschoßen, auch den bauren daselbst befohlen in den wald zu vergraben, wie beschehen. Zu gleicher zeit haben ettlich andere gintfeldische reütter zu Langen-Enßlingen zwo schwedische salvaguardien aufgehebt vnd naher Veberlingen gebracht, deren einer auß Pommern gebürtig vnd adenlichen geschlächts sein sollen, dahero weiln rittmaister Gintfeld ein gůtte ranzion zu erheben verhofft, er bei leben gelassen wird“. Der Benediktiner-Abt Gaisser berichtet zu 1633; STEMMLER, Tagebuch Bd. 1, S. 415: „Der Bürger August Diem sei sein Mitgefangener gewesen, für den er, falls er nicht auch in dieser Nacht entkommen sei, fürchte, daß er heute durch Aufhängen umkomme. Dieser sei, schon vorher verwundet, von den Franzosen an den Füßen in einem Kamin aufgehängt und so lange durch Hängen und Rauch gequält worden, bis das Seil wieder abgeschnitten worden sei und er gerade auf den Kopf habe herabfallen dürfen“. Soldaten mussten sich mit einem Monatssold freikaufen, für Offiziere gab es je nach Rang besondere Vereinbarungen zwischen den Kriegsparteien. Das Einsperren in besondere Käfige, die Massenhinrichtungen, das Vorantreiben als Kugelfang in der ersten Schlachtreihe, die Folterungen, um Auskünfte über Stärke und Bewegung des Gegners zu erfahren, die Hungerkuren, um die „Untersteckung“ zu erzwingen etc., werden nicht berücksichtigt. Frauen, deren Männer in Gefangenschaft gerieten, erhielten, wenn sie Glück hatten, einen halben Monatssold bis zwei Monatssolde ausgezahlt und wurden samt ihren Kindern fortgeschickt. KAISER, Kriegsgefangene; KROENER, Soldat als Ware. Die Auslösung konnte das eigene Leben retten; SEMLER, Tagebücher, S. 65: „Zu gleicher zeitt [August 1630] haben ettlich andere gintfeldische reütter zu Langen-Enßlingen zwo schwedische salvaguardien aufgehebt vnd nacher Veberlingen gebracht, deren einer auß Pommern gebürtig vnd adenlichen geschlächte sein sollen, dahero weiln rittmeister Gintfeld eine gůtte ranzion zu erheben verhofft, er bei leben gelassen worden“. Teilweise beschaffte man über sie Informationen; SEMLER, Tagebücher, S. 70 (1633): „Wie beschehen vnd seyn nahendt bei der statt [Überlingen; BW] vier schwedische reütter, so auf dem straiff geweßt, von vnsern tragonern betretten [angetroffen; BW], zwen darvon alsbald nidergemacht, zwen aber, so vmb quartier gebeten, gefangen in die statt herein gebracht worden. Deren der eine seines angebens Christian Schultheß von Friedland [S. 57] auß dem hertzogthumb Mechelburg gebürtig vnder der kayßerlichen armada siben jahr gedient vnd diesen sommer zu Newmarckht gefangen vnd vndergestoßen [am 30.6.1633; BW] worden: der ander aber von Saltzburg, vnderm obrist König geritten vnd zu Aichen [Aichach; BW] in Bayern vom feind gefangen vnd zum dienen genötiget worden. Vnd sagte der erste bei hoher betheurung vnd verpfändung leib vnd lebens, dass die schwedische vmb Pfullendorff ankomne vnd noch erwartende armada 24 regimenter starck, vnd werde alternis diebus von dem Horn vnd hertzogen Bernhard commandirt; führen 4 halb carthaunen mit sich vnd ettlich klainere veld stückhlin. Der ander vermainte, daß die armada 10.000 pferdt vnd 6.000 zu fůß starckh vnd der so geschwinde aufbruch von Tonawerd [Donauwörth; BW] in diese land beschehen seye, weiln man vernommen, dass die kayserische 8000 starckh in Würtemberg eingefallen“. Auf Gefangenenbefreiung standen harte Strafen. Pflummern hält in seinem Tagebuch fest: „Martij 24 [1638; BW] ist duca Federico di Savelli, so in dem letzsten vnglückhseeligen treffen von Rheinfelden den 3 Martij neben dem General von Wert, Enckefort vnd andern obristen vnd officiern gefangen vnd bis dahin zu Lauffenburg enthallten worden, durch hilff eines weibs auß: vnd den bemellten 24 Martij zu Baden [Kanton Aargau] ankommen, volgenden morgen nach Lucern geritten vnd von dannen nach Costantz vnd seinem vermellden nach fürter zu dem general Götzen ihne zu fürderlichem fortzug gegen den feind zu animirn passirt. Nach seinem außkommen seyn ein officier sambt noch einem soldaten wegen vnfleißiger wacht vnd der pfarherr zu Laufenburg neben seinem capellan auß verdacht, daß sie von deß duca vorhabender flucht waß gewüßt, gefänglich eingezogen, die gaistliche, wie verlautt, hart torquirt [gefoltert; BW], vnd obwoln sie vnschuldig geweßt, offentlich enthauptet; die ihenige fraw aber, durch deren hauß der duca sambt seinem camerdiener außkommen, vnd noch zwo personen mit růthen hart gestrichen worden“. Der Benediktoner-Abt Gaisser berichtet über die Verschiffung schwedischer Gefangener des Obristen John Forbes de Corse von Villingen nach Lindau (1633); STEMMLER, Tagebücher Bd. 1, S. 319: „Abschreckend war das Aussehen der meisten gemeinen Soldaten, da sie von Wunden entkräftet, mit eigenem oder fremdem Blute besudelt, von Schlägen geschwächt, der Kleider und Hüte beraubt, viele auch ohne Schuhe, mit zerrissenen Decken behängt, zu den Schiffen mehr getragen als geführt wurden, mit harter, aber ihren Taten angemessener Strafe belegt“. Gefangene waren je nach Vermögen darauf angewiesen, in den Städten ihren Unterhalt durch Betteln zu bestreiten. Sie wurden auch unter Offizieren als Geschenk gebraucht; KAISER, Wohin mit den Gefangenen ?, in: http://dkblog.hypotheses.org/108: „Im Frühsommer 1623 hatte Christian von Braunschweig, bekannt vor allem als ‚toller Halberstädter’, mit seinen Truppen in der Nähe Göttingens, also im Territorium seines älteren Bruders Herzog Friedrich Ulrich, Quartier genommen. In Scharmützeln mit Einheiten der Armee der Liga, die damals im Hessischen operierte, hatte er einige Gefangene gemacht. Was sollte nun mit diesen geschehen? Am 1. Juli a. St. wies er die Stadt Göttingen an, die gefangenen Kriegsknechte nicht freizulassen; vielmehr sollte die Stadt sie weiterhin ‚mit nottürfftigem vnterhalt’ versorgen, bis andere Anweisungen kämen. Genau das geschah wenige Tage später: Am 7. Juli a. St. erteilte Christian seinem Generalgewaltiger (d. h. der frühmodernen Militärpolizei) den Befehl, daß er ‚noch heutt vor der Sonnen vntergangk, viertzig dero zu Göttingen entthaltenen gefangenen Soldaten vom feinde, den Lieutenantt vnd Officiers außsgenommen, Laße auffhencken’. Um den Ernst der Anweisung zu unterstreichen, fügte er hinzu, daß dies ‚bei vermeidung vnser hochsten vngnad’ geschehen solle. Der Generalgewaltiger präsentierte daraufhin der Stadt Göttingen diesen Befehl; bei der dort überlieferten Abschrift findet sich auf der Rückseite die Notiz vom Folgetag: ‚Vff diesen Schein seindt dem Gewalthiger 20 Gefangene vff sein darneben mundtlich andeuten ausgevolgtt worden’. Der Vollzug fand also offenbar doch nicht mehr am 7. Juli, am Tag der Ausfertigung des Befehls, statt. Aber es besteht kaum ein Zweifel, daß zwanzig Kriegsgefangene mit dem Strang hingerichtet wurden. (StA Göttingen, Altes Aktenarchiv, Nr. 5774 fol. 2 Kopie; der Befehl an die Stadt Göttingen vom 1.7.1623 a.St. ebd. fol. 32 Ausf.)“. Teilweise wurden Gefangene auch unter den Offizieren verkauft; MÜHLICH; HAHN, Chronik 3. Bd., S. 607 (Schweinfurt 1645). Zur Problematik vgl. KAISER, Kriegsgefangene in der Frühen Neuzeit, S. 11-14.
[48] Oppeln [Opole]; HHSSchl, S. 378ff.
[49] Jägerndorf [Krnov; Bez. Freudenthal, Tschechien]; HHSBöhm, S. 222ff.
[50] Troppau [Opava, Tschechien]; HHSBöhm, S. 625ff.
[51] Schweidnitz [Świdnica]; HHSSchl, S. 491ff.
[52] KUNATH, Kursachsen, S. 100f.
[53] Regiment: Größte Einheit im Heer, aber mit höchst unterschiedlicher Stärke: Für die Aufstellung eines Regiments waren allein für Werbegelder, Laufgelder, den ersten Sold und die Ausrüstung 1631 bereits ca. 135.000 fl. notwendig. Zum Teil wurden die Kosten dadurch aufgebracht, dass der Obrist Verträge mit Hauptleuten abschloss, die ihrerseits unter Androhung einer Geldstrafe eine bestimmte Anzahl von Söldnern aufbringen mussten. Die Hauptleute warben daher Fähnriche, Kornetts und Unteroffiziere an, die Söldner mitbrachten. Adlige Hauptleute oder Rittmeister brachten zudem Eigenleute von ihren Besitzungen mit. Wegen der z. T. immensen Aufstellungskosten kam es vor, dass Obristen die Teilnahme an den Kämpfen mitten in der Schlacht verweigerten, um ihr Regiment nicht aufs Spiel zu setzen. Der jährliche Unterhalt eines Fußregiments von 3.000 Mann Soll-Stärke wurde mit 400- 450.000 fl. eines Reiterregiments von 1.200 Mann mit 260.-300.000 fl. angesetzt. Zu den Soldaufwendungen für die bayerischen Regimenter vgl. GOETZ, Kriegskosten Bayerns, S. 120ff.; KAPSER, Kriegsorganisation, S. 277ff. Ein Regiment zu Fuß umfasste de facto bei den Kaiserlichen zwischen 650 und 1.100, ein Regiment zu Pferd zwischen 320 und 440, bei den Schweden ein Regiment zu Fuß zwischen 480 und 1.000 (offiziell 1.200 Mann), zu Pferd zwischen 400 und 580 Mann, bei den Bayerischen 1 Regiment zu Fuß zwischen 1.250 und 2.350, 1 Regiment zu Roß zwischen 460 und 875 Mann. Das Regiment wurde vom Obristen aufgestellt, von dem Vorgänger übernommen und oft vom seinem Obristleutnant geführt. Über die Ist-Stärke eines Regiments lassen sich selten genaue Angaben finden. Das kurbrandenburgische Regiment Carl Joachim v. Karberg [Kerberg] sollte 1638 sollte auf 600 Mann gebracht werden, es kam aber nie auf 200. Karberg wurde der Prozess gemacht, er wurde verhaftet und kassiert; OELSNITZ, Geschichte, S. 64. Als 1644 der kaiserliche Generalwachtmeister Johann Wilhelm v. Hunolstein die Stärke der in Böhmen stehenden Regimenter feststellen sollte, zählte er 3.950 Mann, die Obristen hatten 6.685 Mann angegeben. REBITSCH, Gallas, S. 211; BOCKHORST, Westfälische Adlige.
[54] SCHERER, Sächs. Regimenter, Nr. 13..
[55] Vgl. CATALANO, Ein Chamäleon; REBITSCH, Wallenstein; MORTIMER, Wallenstein; SCHUBERTH; REICHEL, Die blut’ge Affair’; MORTIMER, Wallenstein.
[56] Zittau; HHSD VIII, S. 371ff.
[57] Ottavio Piccolomini Pieri di Sticciano [Picoloni, Picolomnini, Bicolomini] P. d’Aragona, Herzog von Amalfi [11.11.1599 Florenz-11. 8.1656 Wien], kaiserlicher Feldmarschall. Vgl. BARKER, Piccolomini. Eine befriedigende Biographie existiert trotz des reichhaltigen Archivmaterials bis heute nicht. Hingewiesen sei auf die Arbeiten von ELSTER (=> Literaturregister).
[58] Torgau [LK Nordsachsen]; HHSD XI, S. 467ff.
[59] Kanth [Katy Wroclawskie; Bez. Breslau] oder Käntchen [Katki; Bez. Schweidnitz].
[60] Glogau [Głogów]; HHSSchl, S. 127ff.
[61] Liegnitz [Legnica]; HHSSchl, S. 283ff.
[62] Oppeln [Opole]; HHSSchl, S. 378ff.
[63] Breslau [Wrocław]; HHSSchl, S. 38ff.
[64] KUNATH, Kursachsen, S. 145f.
[65] Heinrich Matthias Graf v. Thurn-Valvassina [24.2.1567 Schloss Lipnitz/Lipnice nad Sázavou-28.1.1640 Pernau], böhmischer Ständeführer, schwedischer Generalleutnant.
[66] Landsasse: Mitglied der Ritterschaft eines Landes; mit größeren Gütern Angesessener (Schriftsasse, der keine Unterobrigkeit, sondern lediglich den Landesherrn zum Richter hatte).
[67] Jacob [James, Joachim, Heinrich Jakob] Freiherr Duwall [MacDougal, MacDougall, Duwall, Duwalt, Duwaldt, Dubwaldt, Duval, Dual, Duual, Dugaldt, Dougal, Douwall, Duvald, Thubald, Mag. Dubald, Mack Duwall, Tubal, Tubald] [um 1589 Prenzlau – 28.4./9.5.1634 Oppeln], schwedischer Obrist, Generalkommissar. Vgl. MURDOCH, SSNE ID: 1623.
[68] Levin v. Beyern [Bayer, Beyer] [vor 1600 in Brandenburg-vor 1680], kurbrandenburgischer Obrist.
[69] Joachim Ernst v. Krockow [Crakaw, Cracau, Crocko, Crockow, Crockaw, Cracou, Krackau, Krackaw] [1601-Sommer 1646 Danzig], schwedischer, dann kaiserlicher Generalwachtmeister.
[70] Caspar Graf Colonna v. Fels [Völs] [1594-31.3.1666 Oppeln], schwedischer Obrist.
[71] Dragoner [schwed. Dragon; frz. Dragon]: leichter Reiter, der auch zu Fuß focht, benannt nach den mit Drachenkopf (dragon) verzierten Reiterpistolen, nach KEITH, Pike and Shot Tactics, S. 24, aus dem Holländischen „dragen“ bzw. „tragen“. „Arbeiter zu Pferd“ hat man sie genannt. Der Dragoner war im Prinzip ein berittener Musketier (der zum Gefecht absaß), da das Pferd zu schlecht war, um mit der Kavallerie ins Gefecht reiten zu können. Berneck, Geschichte der Kriegskunst, S. 136. Auch äußerlich war der Dragoner nicht vom Infanteristen zu unterscheiden. Zudem verfügte in der schwedischen Armee 1631/32 etwa nur die Hälfte der Dragoner überhaupt über ein Pferd. Oft saßen daher zwei Dragoner auf einem Pferd. Falls überhaupt beritten, wurden die Dragoner als Vorhut eingesetzt, um die Vormarschwege zu räumen und zu sichern. Teilweise machte man auch Unberittene zu Dragonern, indem man ihnen ein Pferd und eine Muskete gab; SCHWARZ, Die Neumark, S. 52. Des Öfteren führten Dragoner am Sattelknopf kleine Äxte mit, um Hindernisse entfernen oder sich auch zeitweise selbst verteidigen zu können. Zum Teil wurden unberittene Dragoner-Einheiten im Kampf auch als Musketiere eingesetzt. Zu ihren Aufgaben gehörte auch Sicherung und Deckung von Konvois, Patrouillen, Angriffe aus dem Hinterhalt, Bildung der Vor- und Nachhut. Ausführlich dargestellt bei ENGERISSER, Von Kronach, S. 468ff., FLIEGER, Die Schlacht, S. 123ff. Eine Designation vom 13.7.1643 über die Verwendung des Werbegeldes bzw. die Abrechnung für einen Dragoner stellt 44 Gulden 55 Kreuzer in Rechnung. Vgl. WALLHAUSEN, Kriegs-Kunst zu Pferd. Zu den Waffen vgl. http://www.engerisser.de/Bewaffnung/Bewaffnung.html.
[72] Meile: 1 Meile = ca. 7,420 km, eine schwedische (auch große) wie auch westfälische große Meile wurde mit 10 km bzw. 10, 044 km gerechnet. In der Regel kein bestimmtes Maß, sondern eine Strecke, „die ein Fußgänger ohne Anstrengung in zwei Stunden zurücklegen“ konnte. HIRSCHFELDER, Herrschaftsordnung, S. 192.
[73] N Stössel [ – ], schwedischer Obrist.
[74] Konrad [Kurt] Alexander Magnus v. Burgsdorff [Borgsdorff] [11.12.1595-1.2.1652 Berlin] kurbrandenburgischer Geheimrat, Oberkämmerer u. Obrist.
[75] Schwadron, Esquadron [schwed. skvadron, dän. squadron]: Im 16. Jahrhundert bezeichnete Escadre (von lateinisch exquadra Gevierthaufen, Geschwader) eine Stellungsform des Fußvolks und der Reiterei, aus welcher im 17. Jahrhundert für letztere die Eskadron, für ersteres das Bataillon hervorging. Ca. 210 Pikeniere sollten eine Schwadron bilden, 3 eine Brigade. Die Schwadron der Reiterei entsprach der Kompanie der Fußtruppen. Die schwedische Kompanie (Fußtruppen) bestand nach Lorenz TROUPITZ, Kriegs-Kunst / nach Königlich Schwedischer Manier eine Compagny zu richten, Franckfurt 1638, aus drei Schwadronen (zu Korporalschaften, eine Schwadron entsprach daher dem späteren Zug). Die Schwadron war in der Regel eine taktische, selbstständig operierende Infanterie- oder Kavallerieeinheit, die nur für die jeweilige Schlacht aus verfügbaren Einheiten gebildet wurde, meist aus einem Regiment bestehend. Nach Bedarf konnten a) bestehende zahlenmäßig starke Regimenter geteilt oder b) schwache Regimenter zu einer Schwadron zusammengelegt werden; SCHÜRGER, Archäologisch entzaubert, S. 380.
[76] Claude de Letouf, baron de Sirot [Sire, Syre, Cirey, Siroti, Sirota] [12.7.1600 Schloss Sirot bei Cluny (Saône-et-Loire)-6.4.1652 Orléans], französischer Generalfeldmarschallleutnant. Vgl. BARTHÉLMY, Mémoires et la vie de Messire Claude de Letouf chevalier, baron de Sirot.
[77] Kürassier, Kürisser, Kyrisser, Corazzen (franz. Cuirasse für Lederpanzer (cuir = Leder) [schwed. kyrassiär, dän. kyrassér]: Die Kürassiere waren die älteste, vornehmste – ein gerade daher unter Adligen bevorzugtes Regiment – und am besten besoldete Waffengattung. Sie gehörten zu den Eliteregimentern, der schweren Reiterei, deren Aufgabe im Gefecht es war, die feindlichen Linien zu durchbrechen, die Feinde zur Flucht zu nötigen und damit die Schlacht zu entscheiden. Sie trugen einen geschwärzten Trabharnisch (Brust- und Rückenharnisch, den „Kürass“), Schwert, Ober- und Unterarmzeug, eiserne Stulphandschuhe, Beinschienen und Stulpstiefel mit Sporen, Schwert oder Säbel und zwei lange Reiterpistolen, die vor dem Aufsitzen gespannt wurden. Im späten 16. Jahrhundert wurde es in der schweren Reiterei üblich, einen knielangen Küriss ohne Unterbeinzeug zu tragen. Der Kürass wurde mit 15 Rt. veranschlagt. SKALA, Kürassiere; WALLHAUSEN, Kriegs-Kunst zu Pferd. Nach LICHTENSTEIN, Schlacht, S. 42f., musste ein dänischer Kürassier mit einem mindestens 16 „Palmen“ [1 Palme = 8, 86 cm] hohen Pferd, Degen u. Pistolen antreten. Der Kürass kostete ihn 15 Rt. Er durfte ein kleineres Gepäckpferd u. einen Jungen mitbringen. Der Arkebusier hatte ebenfalls Pferd, Degen u. Pistolen mitzubringen, durfte aber ein 2. Pferd nur halten, wenn er v. Adel war. Für Brust- u. Rückenschild musste er 11 Rt. zahlen. Der Infanterist brachte den Degen mit u. ließ sich für das gelieferte Gewehr einen Monatssold im ersten halben Jahr seines Dienstes abziehen. Bei der Auflösung des Regiments erhielten die Soldaten sämtl. Waffen mit einem Drittel des Ankaufspreises vergütet, falls der Infanterist noch nicht 6 Monate, der Kavallerist noch nicht 10 Monate gedient hatte; andernfalls mussten sie die Waffen ohne jede Vergütung abliefern. Der Kürassier erhielt für sich u. seinen Jungen täglich 2 Pfd. Fleisch, 2 Pfd. Brot, 1/8 Pfd. Butter oder Käse u. 3 „Pott“ [1 Pott = 4 Glas = 0, 96 Liter] Bier. Arkebusier u. Infanterist bekamen die Hälfte. Die tägliche Ration betrug 12 Pfd. Heu, Gerste oder Hafer je nach den Vorräten. An das Kommissariat musste der Kürassier für Portion u. Ration monatlich 7 Rt., an den Wirt im eigenen oder kontribuierenden Land musste der Kürassier 5, der Unteroffizier 4, der Sergeant 3, Arkebusier u. Infanterist 2 1/2 Rt. zahlen. Im besetzten Land, das keine Kontributionen aufbrachte, wurde ohne Bezahlung requiriert. Ein Teil des Handgeldes wurde bis zum Abschied zurückbehalten, um Desertionen zu verhüten, beim Tode wurde der Teil an die Erben ausbezahlt. Kinder u. Witwen bezogen einen sechsmonatlichen Sold. Zu den schwedischen Kürassierregimentern vgl. die Bestimmungen in der Kapitulation für Efferen, Adolf Theodor [Dietrich], genannt Hall => „Miniaturen“. Des Öfteren wurden Arkebusierregimenter in Kürassierregimenter umgewandelt, falls die notwendigen Mittel vorhanden waren.
[78] Arkebusier [schwed. arquebusier, dän. arquebusier]: Leichter, mit einer Arkebuse bewaffneter Reiter, eigentlich berittener Infanterist (der zum Gefecht absaß). Die Arkebuse (später Karabiner genannt) war ein kurzes Gewehr von ca. 1 m Länge, eine Waffe für bis zu über 100 g schwere Kugeln, die in freiem Anschlag verwendbar war; bei der Infanterie als Handrohr, Büchse oder Arkebuse, bei der Kavallerie als Karabiner oder Faustrohr (Pistole mit Radschloss). Der Karabiner war leichter als die Muskete, die Geschosse waren ebenfalls leichter, ihre Durchschlagskraft war auch geringer. Gerüstet war der Arkebusier mit einem Kürass aus schussfreiem Brust- und Rückenstück (dieses wurde mit 11 Rt. veranschlagt) oder auch nur dem Bruststück. 1635 wurde von Nürnberger Plattnern ein Arkebusier-Harnisch, der vorn und hinten schusssicher war, für 3 Rt. angeboten; TOEGEL, Der Schwedische Krieg, Nr. 1239. Seitenwehr war ein kurzer Haudegen, in den Sattelhalftern führte er 1 – 2 leichte Pistolen. Er wurde zumeist in kleineren Gefechten oder für Kommandounternehmen eingesetzt. In den Schlachten sollten sie die Flanken der eigenen angreifenden Kürassiere decken und in die von ihnen geschlagenen Lücken eindringen. Er erhielt als Verpflegung die Hälfte dessen, was dem Kürassier zustand, zudem auch weniger Sold. Vgl. ENGERISSER, Von Kronach nach Nördlingen, S. 464ff., FLIEGER, Die Schlacht, S. 123, BEAUFORT-SPONTIN, Harnisch, S. 96. Des Öfteren wurden Arkebusierregimenter, wenn die Mittel vorhanden waren, in Kürassierregimenter umgewandelt. Vgl. WALLHAUSEN, Kriegs-Kunst zu Pferd. Zu den Waffen vgl. auch http://www.engerisser.de/Bewaffnung/Bewaffnung.html.
[79] Kriegsgefangene: Zur Gefangennahme vgl. die Reflexionen bei MAHR, Monro, S. 46: „Es ist für einen Mann besser, tüchtig zu kämpfen und sich rechtzeitig zurückzuziehen, als sich gefangennehmen zu lassen, wie es am Morgen nach unserem Rückzug vielen geschah. Und im Kampf möchte ich lieber ehrenvoll sterben als leben und Gefangener eines hartherzigen Burschen sein, der mich vielleicht in dauernder Haft hält, so wie viele tapfere Männer gehalten werden. Noch viel schlimmer ist es, bei Gefangennahme, wie es in gemeiner Weise immer wieder geübt wird, von einem Schurken nackt ausgezogen zu werden, um dann, wenn ich kein Geld bei mir habe, niedergeschlagen und zerhauen, ja am Ende jämmerlich getötet zu werden: und dann bin ich nackt und ohne Waffen und kann mich nicht verteidigen. Man Rat für den, der sich nicht entschließen kann, gut zu kämpfen, geht dahin, daß er sich dann wenigstens je nach seinem Rang gut mit Geld versehen soll, nicht nur um stets selbst etwas bei sich zu haben, sondern um es an einem sicheren Ort in sicheren Händen zu hinterlegen, damit man ihm, wenn er gefangen ist, beistehen und sein Lösegeld zahlen kann. Sonst bleibt ihm nichts anderes übrig, als sich zu entschließen, in dauernder Gefangenschaft zu bleiben, es sei denn, einige edle Freunde oder andere haben mit ihm Mitleid“. Nach LAVATER, Kriegs-Büchlein, S. 65, hatten folgende Soldaten bei Gefangennahme keinerlei Anspruch auf Quartier (Pardon): „wann ein Soldat ein eysen, zinne, in speck gegossen, gekäuete, gehauene oder gevierte Kugel schiesset, alle die gezogene Rohr und französische Füse [Steinschloßflinten] führen, haben das Quartier verwirkt. Item alle die jenigen, die von eysen geschrotete, viereckige und andere Geschröt vnd Stahel schiessen, oder geflammte Dägen, sollt du todt schlagen“. Leider reduziert die Forschung die Problematik der de facto rechtlosen Kriegsgefangenen noch immer zu einseitig auf die Alternative „unterstecken“ oder „ranzionieren“. Der Ratsherr Dr. Plummern berichtet (1633); SEMLER, Tagebücher, S. 65: „Eodem alß die von Pfullendorff avisirt, daß ein schwedischer reütter bei ihnen sich befinnde, hatt vnser rittmaister Gintfeld fünf seiner reütter dahin geschickht sollen reütter abzuholen, welliche ihne biß nach Menßlißhausen gebracht, allda in dem wald spolirt vnd hernach zu todt geschoßen, auch den bauren daselbst befohlen in den wald zu vergraben, wie beschehen. Zu gleicher zeit haben ettlich andere gintfeldische reütter zu Langen-Enßlingen zwo schwedische salvaguardien aufgehebt vnd naher Veberlingen gebracht, deren einer auß Pommern gebürtig vnd adenlichen geschlächts sein sollen, dahero weiln rittmaister Gintfeld ein gůtte ranzion zu erheben verhofft, er bei leben gelassen wird“. Der Benediktiner-Abt Gaisser berichtet zu 1633; STEMMLER, Tagebuch Bd. 1, S. 415: „Der Bürger August Diem sei sein Mitgefangener gewesen, für den er, falls er nicht auch in dieser Nacht entkommen sei, fürchte, daß er heute durch Aufhängen umkomme. Dieser sei, schon vorher verwundet, von den Franzosen an den Füßen in einem Kamin aufgehängt und so lange durch Hängen und Rauch gequält worden, bis das Seil wieder abgeschnitten worden sei und er gerade auf den Kopf habe herabfallen dürfen“. Soldaten mussten sich mit einem Monatssold freikaufen, für Offiziere gab es je nach Rang besondere Vereinbarungen zwischen den Kriegsparteien. Das Einsperren in besondere Käfige, die Massenhinrichtungen, das Vorantreiben als Kugelfang in der ersten Schlachtreihe, die Folterungen, um Auskünfte über Stärke und Bewegung des Gegners zu erfahren, die Hungerkuren, um die „Untersteckung“ zu erzwingen etc., werden nicht berücksichtigt. Frauen, deren Männer in Gefangenschaft gerieten, erhielten, wenn sie Glück hatten, einen halben Monatssold bis zwei Monatssolde ausgezahlt und wurden samt ihren Kindern fortgeschickt. KAISER, Kriegsgefangene; KROENER, Soldat als Ware. Die Auslösung konnte das eigene Leben retten; SEMLER, Tagebücher, S. 65: „Zu gleicher zeitt [August 1630] haben ettlich andere gintfeldische reütter zu Langen-Enßlingen zwo schwedische salvaguardien aufgehebt vnd nacher Veberlingen gebracht, deren einer auß Pommern gebürtig vnd adenlichen geschlächte sein sollen, dahero weiln rittmeister Gintfeld eine gůtte ranzion zu erheben verhofft, er bei leben gelassen worden“. Teilweise beschaffte man über sie Informationen; SEMLER, Tagebücher, S. 70 (1633): „Wie beschehen vnd seyn nahendt bei der statt [Überlingen; BW] vier schwedische reütter, so auf dem straiff geweßt, von vnsern tragonern betretten [angetroffen; BW], zwen darvon alsbald nidergemacht, zwen aber, so vmb quartier gebeten, gefangen in die statt herein gebracht worden. Deren der eine seines angebens Christian Schultheß von Friedland [S. 57] auß dem hertzogthumb Mechelburg gebürtig vnder der kayßerlichen armada siben jahr gedient vnd diesen sommer zu Newmarckht gefangen vnd vndergestoßen [am 30.6.1633; BW] worden: der ander aber von Saltzburg, vnderm obrist König geritten vnd zu Aichen [Aichach; BW] in Bayern vom feind gefangen vnd zum dienen genötiget worden. Vnd sagte der erste bei hoher betheurung vnd verpfändung leib vnd lebens, dass die schwedische vmb Pfullendorff ankomne vnd noch erwartende armada 24 regimenter starck, vnd werde alternis diebus von dem Horn vnd hertzogen Bernhard commandirt; führen 4 halb carthaunen mit sich vnd ettlich klainere veld stückhlin. Der ander vermainte, daß die armada 10.000 pferdt vnd 6.000 zu fůß starckh vnd der so geschwinde aufbruch von Tonawerd [Donauwörth; BW] in diese land beschehen seye, weiln man vernommen, dass die kayserische 8000 starckh in Würtemberg eingefallen“. Auf Gefangenenbefreiung standen harte Strafen. Pflummern hält in seinem Tagebuch fest: „Martij 24 [1638; BW] ist duca Federico di Savelli, so in dem letzsten vnglückhseeligen treffen von Rheinfelden den 3 Martij neben dem General von Wert, Enckefort vnd andern obristen vnd officiern gefangen vnd bis dahin zu Lauffenburg enthallten worden, durch hilff eines weibs auß: vnd den bemellten 24 Martij zu Baden [Kanton Aargau] ankommen, volgenden morgen nach Lucern geritten vnd von dannen nach Costantz vnd seinem vermellden nach fürter zu dem general Götzen ihne zu fürderlichem fortzug gegen den feind zu animirn passirt. Nach seinem außkommen seyn ein officier sambt noch einem soldaten wegen vnfleißiger wacht vnd der pfarherr zu Laufenburg neben seinem capellan auß verdacht, daß sie von deß duca vorhabender flucht waß gewüßt, gefänglich eingezogen, die gaistliche, wie verlautt, hart torquirt [gefoltert; BW], vnd obwoln sie vnschuldig geweßt, offentlich enthauptet; die ihenige fraw aber, durch deren hauß der duca sambt seinem camerdiener außkommen, vnd noch zwo personen mit růthen hart gestrichen worden“. Der Benediktoner-Abt Gaisser berichtet über die Verschiffung schwedischer Gefangener des Obristen John Forbes de Corse von Villingen nach Lindau (1633); STEMMLER, Tagebücher Bd. 1, S. 319: „Abschreckend war das Aussehen der meisten gemeinen Soldaten, da sie von Wunden entkräftet, mit eigenem oder fremdem Blute besudelt, von Schlägen geschwächt, der Kleider und Hüte beraubt, viele auch ohne Schuhe, mit zerrissenen Decken behängt, zu den Schiffen mehr getragen als geführt wurden, mit harter, aber ihren Taten angemessener Strafe belegt“. Gefangene waren je nach Vermögen darauf angewiesen, in den Städten ihren Unterhalt durch Betteln zu bestreiten. Sie wurden auch unter Offizieren als Geschenk gebraucht; KAISER, Wohin mit den Gefangenen ?, in: http://dkblog.hypotheses.org/108: „Im Frühsommer 1623 hatte Christian von Braunschweig, bekannt vor allem als ‚toller Halberstädter’, mit seinen Truppen in der Nähe Göttingens, also im Territorium seines älteren Bruders Herzog Friedrich Ulrich, Quartier genommen. In Scharmützeln mit Einheiten der Armee der Liga, die damals im Hessischen operierte, hatte er einige Gefangene gemacht. Was sollte nun mit diesen geschehen? Am 1. Juli a. St. wies er die Stadt Göttingen an, die gefangenen Kriegsknechte nicht freizulassen; vielmehr sollte die Stadt sie weiterhin ‚mit nottürfftigem vnterhalt’ versorgen, bis andere Anweisungen kämen. Genau das geschah wenige Tage später: Am 7. Juli a. St. erteilte Christian seinem Generalgewaltiger (d. h. der frühmodernen Militärpolizei) den Befehl, daß er ‚noch heutt vor der Sonnen vntergangk, viertzig dero zu Göttingen entthaltenen gefangenen Soldaten vom feinde, den Lieutenantt vnd Officiers außsgenommen, Laße auffhencken’. Um den Ernst der Anweisung zu unterstreichen, fügte er hinzu, daß dies ‚bei vermeidung vnser hochsten vngnad’ geschehen solle. Der Generalgewaltiger präsentierte daraufhin der Stadt Göttingen diesen Befehl; bei der dort überlieferten Abschrift findet sich auf der Rückseite die Notiz vom Folgetag: ‚Vff diesen Schein seindt dem Gewalthiger 20 Gefangene vff sein darneben mundtlich andeuten ausgevolgtt worden’. Der Vollzug fand also offenbar doch nicht mehr am 7. Juli, am Tag der Ausfertigung des Befehls, statt. Aber es besteht kaum ein Zweifel, daß zwanzig Kriegsgefangene mit dem Strang hingerichtet wurden. (StA Göttingen, Altes Aktenarchiv, Nr. 5774 fol. 2 Kopie; der Befehl an die Stadt Göttingen vom 1.7.1623 a.St. ebd. fol. 32 Ausf.)“. Teilweise wurden Gefangene auch unter den Offizieren verkauft; MÜHLICH; HAHN, Chronik 3. Bd., S. 607 (Schweinfurt 1645). Zur Problematik vgl. KAISER, Kriegsgefangene in der Frühen Neuzeit, S. 11-14.
[80] Johann Gottfried v. Rauchhaupt [Rauhaupt] [1598-1635], kaiserlicher Obrist.
[81] KREBS, Hans Ulrich Freiherr von Schaffgotsch, S. 40f.
[82] Axel Gustafsson Oxenstierna Greve af Södermore [16.6.1583 Fanö bei Uppsala-28.1.1654 Stockholm], schwedischer Reichskanzler. Vgl. WETTERBERG, Axel Oxenstierna; FINDEISEN, Axel Oxenstierna; BACKHAUS (Hg.), Brev 1-2.
[83] Generalleutnant [schwed. Generalleutnant]: Der Generalleutnant vertrat den General bzw. Feldherrn und war in der kaiserlichen, kurbayerischen, dänischen und schwedischen Armee der höchste Befehlshaber und Stellvertreter des Kaisers und des Königs/der Königin, mit weitgehenden politischen und militärischen Vollmachten. Über ihm stand nur noch der „Generalissimus“ mit absoluter Vollmacht. Als Rekompens erhielt er für seine Leistungen Landzuweisungen (zumeist aus eroberten Gebieten oder den sogenannten „Rebellengütern“) sowie die Erhebung etwa in den Grafen- oder Herzogsstand. Als Stellvertreter seines Dienstherrn führte er Verhandlungen mit den Ständen, erzwang die Depossedierung von Adligen und Absetzung von Territorialherrn in den besetzten Gebieten und lenkte durch seine Abgesandten auch Friedensverhandlungen. Wichtige Träger der gesamten Organisation des Kriegswesens waren dabei die Generalkriegskommissare und die Obristen, die in der Regel nach ihm oder nach seinen Vorschlägen bestallt wurden.
[84] manuteniert: erhalten.
[85] Diversion: Ablenkungsmanöver, Vorstoß auf einem Nebenkriegsschauplatz, unerwarteter Angriff.
[86] Matthias [Matteo] [di] Gallas [Galas, Galasso], Graf v. Campo, Herzog v. Lucera] [17.10.1588 Trient-25.4.1647 Wien], kaiserlicher Generalleutnant. Vgl. REBITSCH, Matthias Gallas; KILIÁN, Johann Matthias Gallas.
[87] Leitmeritz [Litoměřice]; HHSBöhm, S. 324ff.
[88] in die Harre: auf Dauer, in die Länge.
[89] Pest: Eine während des gesamten Krieges immer wieder auftretende Seuche war die Pest (die „zur frühen Neuzeit wie das Amen in der Kirche“ gehörte, ULBRICHT, Seuche, S. 10) als demographische Katastrophe für einzelne Landstriche, von HAPPE [mdsz.thulb.uni-jena.de: I 87r] und seinen Zeitgenossen neben Krieg und Hunger zu den drei Hauptstrafen Gottes gerechnet; vgl. dazu auch LANG, Pestilentz, S. 133 f. Truppenbewegungen, Zerstörungen, Hungerkrisen bzw. chronische Unterernährung, mangelnde Hygiene etc. trugen zur Verbreitung der Pest bei, die in vier Formen auftrat: 1. die abortive Pest als „leichte“ Variante: Symptome waren leichtes Fieber sowie Anschwellen der Lymphdrüsen. War die Infektion überstanden, wurden Antikörper gebildet, die eine etwa 10 Jahre anhaltende Immunisierung gegen die drei anderen Formen bildete. MARX mdsz.thulb.uni-jena.de] starb 10 Jahre nach der Pest von 1625 an der Pest von 1635. 2. die Beulenpest (Bubonenpest nach griech. bubo = Beule), die nach ca. 9 Tagen zum Tod führen konnte, wenn der Erreger ins Blut eintrat, die Letalität konnte zwischen 60-80 % liegen). Die Ansteckungszeit lag zwischen wenigen Stunden und etwa einer Woche, Symptome waren Kopf- und Gliederschmerzen, Fieber, Benommenheit, Schlaflosigkeit, später treten Bewusstseinsstörungen und Ohnmachtsanfälle auf. Im Bereich des Flohbisses bildeten sich stark anschwellende und äußerst schmerzhafte Beulen am Hals, an den Leisten und Achselhöhlen. Diese Beulen erreichten eine Größe von ca. 10 cm und waren durch die die Blutungen in den Lymphknoten dunkelblau bis schwarz eingefärbt. Sie fielen nach Vereiterung in sich zusammen. Die Beulenpest an sich war nicht tödlich, da die Beulen von selbst abheilen konnten. Das Aufschneiden der Beulen war insofern gefährlich, da die Bakterien über das Blut in andere Organe gelangen konnten. Bei den unbehandelten Patienten kam es wohl bei 30-50 %r zur gefährlichen Lungenpest. Die Beulenpest verbreitete sich im Winter kältebedingt langsamer als im Sommer und erreichte ihren Höhepunkt im Herbst. 3. die Pestsepsis (Pestseptikämie), wenn die Bakterien in die Blutbahn eintraten, entweder über offene Wunden oder beim Platzen der Pestbeulen nach innen. Symptome waren hier hohes Fieber, Kopfschmerzen, Anfälle von Schüttelfrost, danach kam es zu größeren Haut- und Organblutungen. Der Tod trat bei Nichtbehandelten wohl spätestens nach 36 Stunden auf. 4. die Lungenpest, bei der die Erreger durch die Pestsepsis in die Lunge kamen oder von Mensch zu Mensch durch Tröpfcheninfektion übertragen wurde, bei der der Tod angeblich in 24 Stunden, zumeist aber unbehandelt in 2 bis 5 Tagen eintrat und die eine Letalität von 95 % hatte. Angeblich konnte man sich in nur 1 bis 2 Tagen anstecken. Symptome waren eine starke Atemnot, Husten, blaue Lippen und blutiger Auswurf. Das führt zu einem Lungenödem, verbunden mit dem Zusammenbruch des Kreislaufs. MARX’ Angaben [mdsz.thulb.uni-jena.de] lassen vermuten, dass es sich bei der Pest von 1625 um die Beulenpest gehandelt haben muss. Geschlecht, sozialer Status und Ernährung waren Determinanten, die über Ansteckung und Abwehrkräfte entschieden. Der Pestbazillus wurde durch Rattenflöhe, Wanzen, Läuse und andere Parasiten übertragen. Das Bakterium blieb z. B. in Flohkot, Staub, Kleidung, Pelzen, Wasser und Erde wochenlang virulent. Zumindest scheint man in Erfurt 1625 recht sorglos mit der Ansteckungsgefahr umgegangen zu sein, HEUBEL, S. 42 [mdsz.thulb.uni-jena.de]. Möglicherweise hatte der Rat jedoch durch eine strenge Quarantäne von vierzig Tagen Versorgungsengpässe befürchtet und wollte die Handelsbeziehungen nicht gefährden. Zur Pest in Wismar (1630) heißt es: BALCK, Wismar, S. 50f.: „Auf Wallensteins Anordnung wurden Gegenmaßregeln getroffen: Der Stadtsyndikus erhielt den Auftrag zur Beschaffung der notwendigen Heilmittel, außerdem wurde ein Pestbarbier angenommen, die infizierten Häuser, Buden und Keller wurden gesperrt, Pflegerinnen und auch besondere Totengräber bestellt. Trotzdem erlosch die Seuche nicht, was man vor allem auf die Fahrlässigkeit und Gleichgültigkeit der Soldaten schob. Sie begruben ihre Toten zum Teil selbst, Kranke stiegen aus den Fenstern ihres Quartiers und besuchten Gesunde, die ihrerseits auch wieder zu den Kranken kamen; ja sie nahmen sogar die Kleider der Gestorbenen an sich. Deshalb wurden auf Wengerskys Befehl vom 4./14. Januar 1630 die Kranken durch besondere Abzeichen kenntlich gemacht, ferner von jedem Regiment ein Feldscherer bestellt und, soweit nötig, die infizierten Häuser durch Posten bewacht. Am 16. August 1630 ordnete schließlich [der kaiserliche Kommandierende; BW] Gramb an, daß 12 wüste Häuser, auf jede Kompagnie eins, bestimmt werden sollten, in denen dann die infizierten Soldaten zu isolieren seien“.Aus Schweinfurt wird 1628 berichtet; HAHN, Chronik 2. Theil, S. 377 (Datierung nach dem a. St.): „Der Rath ließ am 27. December bekannt machen: Daß diejenigen, welche mit der jetzt grassirenden Pest entweder persönlich angesteckt, oder nur aus angesteckten Häusern und Orten wären; sich der gemeinen Badstuben und anderer gemeinen Versammlungen äussern und enthalten sollten“. „Auf die seltsamste Weise versuchte man sich übrigens damals vor Ansteckung zu schützen: So legte man frisches, warmes Brot auf die Toten und im Sterbezimmer wurden Zwiebeln aufgehängt, da man glaubte, beides ziehe das Pestgift aus der Luft“ [http://www.schweinfurtfuehrer.de/geschichte/1600-1700]. Die Kurfürsten äußerten im Oktober 1630 ihre Befürchtungen, die aus Italien zurückkehrenden Soldaten würden Pest und Syphilis mitbringen; TOEGEL, Der Schwedische Krieg, Nr. 33, S. 32. Allerdings scheint die in der Forschung vertretene Meinung, dass gerade die unteren Schichten die Angst vor der Pest beiseite geschoben hätten (ULBRICHT, Seuche, S. 44), so nicht stimmig. Mehr als 50 Pestheilige, angeführt von den Heiligen Sebastian und Rochus, wurden angerufen. Gebet, Frömmigkeit, Sittenreinheit und Liebe zu Gott galten aus theologischer Sicht als wirksamer Schutz vor der Pest. Man glaubte sich durch die Umwicklung mit Stroh auch der Leichen vor der Ansteckung mit der Pest schützen zu können. HAHN, Chronik 2. Teil, S. 375 (Schweinfurt 1627): „Von dem Rathe dahier wurde am 4. December beschlossen, dass alle an der Pest Gestorbene bey Nacht und ohne Procession begraben werden sollten“. Pestzeiten boten einen durchaus lukrativen Erwerb für die verachteten Totengräber, der von „ehrlichen“ Berufsgruppen ausgeübt wurde, da z. T. pro Begräbnis bis zu 20 Rt. (BRAUN, Marktredwitz, S. 52f.) verlangt wurde, aber auch von Angehörigen der ärmeren Bevölkerungsschicht. RUTHMANN, „Was damals fruchtbar und gebauet“, S. 78f. II. Zum Teil wurden ansteckende Krankheiten seit dem Mittelalter als „peste“ (z. B. die „Ungarische Krankheit“) bezeichnet. Vgl. die Ausführungen des Arztes Johann Gigas (1582-1635-1638; PRINZ, Johann Gigas), des Leibarztes v. Kurfürst Ferdinand von Köln u. des Osnabrücker Bischofs Franz Wilhelm von Wartenberg, der auch Anholt u. Tilly behandelte; SÖBBING, Eine Beschreibung, S. 13, 15: „10 Unnd weil die pest niemandt leichtlich angreifft, er sei dan dazu disponirt, daß ist, habe viel ungesunde feuchtigkeitenn bei sich, alß ist guet, bei gueter zeitt purgiren, aderlaßen, schwitzen etc., dan diese entwedder frey sein, oder aber lichtlich konnen errette[t] werden. 11 Hiezu ist auch gehoerigh mäßigh unnd zuchtigh lebenn, ordentliche diaet, naturlicher schlaeff, bewegungh des leibs, kunheit unnd zulaßige freuwde, dann die traurigenn unnd forchtsamen ins gemein die ersten sein. 12 Endtlich weill dießes alles von Godt, ist ein christlich eifferigh gebett, godtsehliges lebenn, meidungh der sunden, daß aller wrombste, soll nicht allein hinder, sondern warnen und allenhalben in acht genommen werden“. Vgl. die Beschreibung der Symptome bei dem erzgebirgischen Pfarrer u. Chronisten LEHMANN, der die Pest mehrfach erlebte: „Diese entsetzliche Seuche führt unzählig viel ungewöhnliche Zufälle und Beschwerden mit sich, nachdem das Gift und Patient beschaffen. Sie fället an mit ungewöhnlichem Frost, auch Schrecken und Schwindel, innerlicher Hitze und Unruhe, Mattigkeit in allen Gliedern, Hauptschmerzen, Rücken- und Seitenstechen, schwerem Odem, hitzigen Augen, Vertrocknung des Mundes, brennendem Durst, Blutstürzen, Achsel-, Ohren- und Seitenschmerzen. Sonderlich ist dabei große Herzensangst, Traurigkeit, Ohnmacht, tiefer Schlaf oder stetes Wachen und Rasen. Der Magen empfindet vom giftigen Ferment lauter Unlust, Aufstoßen, Erbrechen, Durchlauf, daher erfolgen oft gefährliche Spasmi, Konvulsionen, Schwindel, Fresel [Krämpfe; BW], Zittern und Schlagflüsse. Es schießen Karfunkel und Branddrüsen auf in den Weichen, unter den Achseln, hinter den Ohren. Die mühlselige Natur ängstigt sich, daß allerhand rote, gelbe, grüne, blaue, dunkelbraune Giftflecken ausschlagen. Das Angesicht wird ungestalt, gilbicht und grünlicht, der Puls schlägt hitzig, zitternd, unordentlich, die Glieder erkalten oft, es bricht die Herzensangst mit großem Schweiß aus, und zeigen die Schmerzen, Stiche, Flecken, Schlag, Wüten, Toben, Drüsen und Schwären, Urin und Exkremente an, welche innerlichen Hauptgliedmaßen am meisten leiden müssen. Ist also kein Wunder, daß die Pest, nachdem sie mit einem und anderm Zufall auf das schrecklichste grassieret, so vielerlei Namen führet“. LEHMANN, Erzgebirgsannalen, S. 96ff. 1624 ließ sich der Stadtmedikus in Neumarkt (Oberpfalz) durch die beiden Nürnberger Pestilentiarii über die Erscheinungsformen der in Nürnberg ausgebrochenen Pest informieren: „Das pestilenzialische Contagium dieser Stadt ist theils ein unmittelbares, theils ein mittelbares. Uebrigens weil bei den praktischen Aerzten das durch Gegenstände verbreitete Kontagium wie das in Distanz wirkende gleichmässige Kontagium genannt wird (denn man gebraucht es sowohl zur Bezeichnung eines Ansteckungsstoffes als auch der infizirten Luft), so ist zu bemerken, dass wir unter demselben nichts anderes verstehen, als einen Krankheits-Herd (Fomes). Das Pest ‚Miasma‘ ist Gott Lob bei uns zur Zeit nicht durch die Luft verbreitet worden. Daher ergreift die Pest die Menschen bei uns entweder durch einen besonderen Zunder (Fomes) oder durch unmittelbare Berührung. Auf die erste Weise nahm die Krankheit ihren Anfang, auf die zweite gewann sie Verbreitung. Was die Kranken selbst betrifft, so werden diese meist gleich vom Anfang an von einer bedeutenden Hinfälligkeit ergriffen mit Gefühl von Frost oder Hitze, Brechreiz, wirklichem Erbrechen und zuweilen von Bewusstlosigkeit, worauf sich in Kürze Anthraces und Bubonen, theils von verschiedener Farbe, theils von der Farbe der Haut selbst bilden. Doch sind diese Symptome nicht bei allen gleich, sondern verschieden, je nachdem diese oder jene Theile zuerst mit dem Ansteckungsstoff in Berührung kommen. Denn einige werden mit Kopfschmerz, Hinfälligkeit, Ohnmacht befallen, andere klagen über unstillbaren Durst, Fieberhitze und Schlaflosigkeit, auf welche bald Delirien folgen, wieder bei anderen erscheinen sogleich die charakteristischen Zeichen der Pest und zwar oft ohne die den Pestbeulen gewöhnlich vorhergehenden heftigen Schmerzen. Bei einigen Pestkranken entstanden unter den Erscheinungen der Euphorie Abscesse, bei anderen war damit unter heftige Ohnmacht verbunden. Bei einigen beobachtete man bloss Anthraces, bei anderen traten Anthraces und Bubonen zugleich auf. Diejenigen, bei welchen in entfernteren Theilen, z. B. der Leistengegend, Bubonen ausbrachen, wurden fast alle geheilt, während die, bei denen sie auf der Schulter oder der Brust ausbrachen, fast alle starben. Nicht selten trat übrigens der Tod plötzlich, unter scheinbar günstigen Symptomen ein, aber eben so oft sah man auch solche, welche durch die Heftigkeit der Erscheinungen in der äussersten Lebensgefahr zu schweben schienen, gegen alle Erwartung der Gefahr entrinnen und genesen. So gross ist die Täuschung und Bösartigkeit dieser Krankheit“. 1631 erhielt der „Pestilential-Chirurgus“ in Zwickau lediglich freie Wohnung und wöchentlich 1 ½ Rtlr.; HERZOG, Chronik von Zwickau 2. Bd., S. 417.
[90] Liegnitz [Legnica]; HHSSchl, S. 283ff.
[91] N Steinbach [ – ], schwedischer Rittmeister.
[92] in den Eisen liegen: verfolgen.
[93] Glogau [Głogów]; HHSSchl, S. 127ff.
[94] Neiße [Nysa]; HHSSchl, S. 331ff.
[95] Münsterberg i. Schl. [Ziębice, LK Zabkowice Śląskie, Schlesien], HHSSchl, S. 320ff.
[96] Frankenstein [Ząbkowice Śląskie, LK Zabkowice Śląskie, Schlesien]; HHSSchl, S. 95ff.
[97] Reichenbach [Dzierżoniów]; HHSSchl, S. 433ff.
[98] Schweidnitz [Świdnica]; HHSSchl, S. 491ff.
[99] Jauer [Jawor, Stadt u. Fürstentum; Schlesien]; HHSSchl, S. 206ff.
[100] Lemberg [Lwow, Russland].
[101] Bunzlau [Bolesławiec]; HHSSchl, S. 63ff.
[102] Hirschberg [Jelenia Góra, Schlesien]; HHSSchl, S. 189ff.
[103] Fürstenstein, Schloss [Ksiaz, Gem. Liebichau/Lubiechów, Kr. Waldenburg]; HHSSchl, S. 112ff.
[104] Bolkenhain [Bolków, LK Jauer]; HHSSchl, S. 32ff.
[105] Neumarkt [Środa Śląska]; HHSSchl, S. 342ff.
[106] Strehlen [Strzelin, LK Strzelin]; HHSSchl, S. 519ff.
[107] Andrew [Andreas] Lindsay [Lindesay, Linden, Linsen]; Obristleutnant [ -10.12.1649], schwedischer Obristleutnant. Vgl. MURDOCH, SSNE ID: 2951.
[108] Liebau [Lubawka; LK Kamienna Góra]; HHSSchl, S. 281f.
[109] N Scheppel [Scheps] [ – ], schwedischer Rittmeister.
[110] Wischütz [Wyszęcice, Ort der Landgemeinde Wińsko (Winzig), Powiat Wołowski, Niederschlesien, Polen].
[111] Johann Gottfried v. Rauchhaupt [Rauhaupt] [1598-1635], kaiserlicher Obrist.
[112] Hans Abraham v. Gersdorf [Gersdorff] [22.1.1609 Kay-4.9.1678 Torgau], kursächsischer Obrist.
[113] Johann Friedrich v. Kötteritz [1593-6.12.1633 Kölln an der Spree], kurbrandenburgischer Obrist.
[114] Thurn meint hier die Bildung einer Wagenburg aus den Trosswagen.
[115] Stück: Man unterschied Kartaunen [Belagerungsgeschütz mit einer Rohrlänge des 18-19-fachen Rohrkalibers [17,5 – 19 cm], verschoss 40 oder 48 Pfund Eisen, Rohrgewicht: 60-70 Zentner, Gesamtgewicht: 95-105 Zentner, zum Vorspann nötig waren bis zu 32 Pferde: 20-24 Pferde zogen auf einem Rüstwagen das Rohr, 4-8 Pferde die Lafette]; Dreiviertelkartaune: langläufiges Geschütz mit großer Reichweite, Rohrlänge 16-17faches Kaliber, schoss 36 Pfund Eisen. Vgl. MIETH, Artilleria Recentior Praxis. Halbe Kartaune: langläufiges Geschütz mit großer Reichweite, Rohrlänge 22-faches Kaliber (15 cm), schoß 24 Pfund Eisen. Das Rohrgewicht betrug 40-45 Zentner, das Gesamtgewicht 70-74 Zentner. Als Vorspann wurden 20-25 Pferde benötigt. ENGERISSER, Von Nördlingen, S. 579. Das Material und der Feuerwerker-Lohn für den Abschuss einer einzigen 24-pfündigen Eisenkugel aus den „Halben Kartaunen“ kostete fünf Reichstaler – mehr als die monatliche Besoldung eines Fußsoldaten“. EICKHOFF; SCHOPPER, 1636, S. 81. Sie hatte eine max. Schussweite von 720 Meter; DAMBOER, Krise, S. 211. Viertelkartaune: „ein stück, welches 12 pfund eisen treibt, 36 zentner wiegt, und 24 kaliber lang ist. man hält diese stücke in den vestungen für die allerbequemste“ [DWB]. Meist als Feldschlange bezeichnet wurde auch die „Halbe Schlange“: langläufiges Geschütz mit großer Reichweite, Rohrlänge 32-34-faches Kaliber (10,5-11,5 cm), schoss 8-10 Pfund Eisen. Das Rohrgewicht betrug 22-30 Zentner, das Gesamtgewicht 34-48 Zentner. Als Vorspann wurden 10-16 Pferde benötigt; die „Quartierschlange“: 40-36-faches Kaliber (6,5-9 cm), Rohrgewicht: 12-24 Zentner, Gesamtgewicht: 18-36 Zentner, Vorspann: 6-12 Pferde; Falkone: 39-faches Kaliber Rohrgewicht: 14-20 Zentner, Gesamtgewicht: 22-30 Zentner, Vorspann: 6-8 Pferde; Haubitze als Steilfeuergeschütz, 10-faches Kaliber (12-15 cm), zumeist zum Verschießen von gehacktem Blei, Eisenstücken („Hagel“) bzw. Nägeln verwendet; Mörser als Steilfeuergeschütz zum Werfen von Brand- und Sprengkugeln (Bomben). Angaben nach ENGERISSER, Von Kronach nach Nördlingen, S. 575ff. Pro Tag konnten etwa 50 Schuss abgegeben werden. „Vom Nürnberger Stückegießer Leonhard Loewe ist die Rechnung für die Herstellung zweier jeweils 75 Zentner schwerer Belagerungsgeschütze erhalten, die auf den heutigen Wert hochgerechnet werden kann. An Material- und Lohnkosten verlangte Loewe 2.643 Gulden, das sind ca. 105.000 bis 132.000 Euro. Das Material und der Feuerwerker-Lohn für den Abschuss einer einzigen 24-pfündigen Eisenkugel aus diesen ‚Halben [?; BW] Kartaunen’ kosteten fünf Reichstaler – mehr als die monatliche Besoldung eines Fußsoldaten“. EICKHOFF; SCHOPPER, 1636, S. 81; SCHREIBER, Beschreibung, bzw. Anleitung, 3. Kapitel.
[116] Adam Erdmann Graf Trčka z Lipy [Terzka] [1584, 1599, 1600-25.2.1634 Eger], kaiserlicher Obrist, Feldmarschallleutnant.
[117] Retranchement: der nicht mehr zu verteidigende Teil einer Festung, der vom übrigen Befestigungswerk durch Brustwehr, Schanzkörbe und Palisaden abgetrennt wurde; allgemein: Verschanzung durch starke Brustwehr und Graben. Vgl. LAVATER, KRIEGSBüchlein, S. 24: „Es sind Abschnitte / Afterschantzen / oder neue Brustwehren / welche man / so der Feind einen Wall schier in hat / innerlich dagegen aufwirft / den Feind weiter abzuhalten“.
[118] Knecht, gemeiner: dienstgradloser einfacher Soldat. Er hatte 1630 monatlich Anspruch auf 6 fl. 40 kr., in der brandenburgischen Armee auf 8 fl. 10 gr. = 7 Rtl. 2 Gr; nach der „Ordnung Wie es mit der verpflegung der Soldaten“ (1630) 6 fl. 40 kr. Ein Bauernknecht im bayerischen Raum wurde mit etwa 12 fl. pro Jahr (bei Arbeitskräftemangel, etwa 1645, wurden auch 18 bis 24 fl. verlangt) entlohnt. Schon 1625 wurde festgehalten; NEUWÖHNER, Im Zeichen des Mars, S. 92: „Ihme folgete der obrist Blanckhardt, welcher mit seinem gantzen regiment von 3000 fueßknechte sechß wochen lang still gelegen, da dann die stath demselben reichlich besolden muste, wovon aber der gemeine knecht nicht einen pfennig bekommen hatt“. In einem Bericht des Obristleutnants des Regiments Kaspar von Hohenems (25.8.1632) heißt es; SCHENNACH, Tiroler Landesverteidigung, S. 336: „daß sie knecht gleichsam gannz nackhent und ploß auf die wachten ziehen und mit dem schlechten commißbroth vorlieb nemmen müessen, und sonderlichen bey dieser kelte, so dieser orten erscheint, da mich, als ich an ainem morgen die wachten und posti visitiert, in meinem mantl und guetem klaidt gefrorn hat, geschweigen die armen knecht, so übel beklaidt, die ganze nacht auf den wachten verpleiben müessen. So haben sie auch gar kain gelt, das sie nur ain warme suppen kauffen khönnen, müessen also, wegen mangl der klaider und gelt, mit gwalt verschmachten und erkhranken, es sollte ainen harten stain erbarmen, daß die Graf hohenembsische Regiment gleich von anfang und biß dato so übel, und gleichsam die armen knecht erger alß die hundt gehalten werden. Es were gleich so guet, man käme und thete die armen knecht […] mit messern die gurgel abschneiden, alß das man sie also lenger abmatten und gleichsam minder als einen hundt achten thuett“. Gallas selbst schrieb am 25.1.1638 dem Kaiser; ELLERBACH; SCHERLEN, Der Dreißigjährige Krieg Bd. 3, S. 222: „Mochte wohl den Stein der erd erbarmen zuzuschauen, wie die arme knecht kein kleid am leib, keine schuh am fuße, die reiter keine stiefel oder sattel haben, auch den mehrerteil sich freuen, wenn sie nur die notdurft an eichelbrot bekommen können“. => Verpflegung. In den Feldlagern (über)lebte er unter den schwierigsten Bedingungen bei einer durchschnittlichen Lebenserwartung von 3, 4 Jahren. Bei Gefangennahme oder Stürmen auf eine Stadt lief er immer Gefahr, getötet zu werden, da für ihn keine Ranzion (Lösegeld) zu erwarten war, oder wenn eine Untersteckung unter die eigenen Truppen nicht notwendig erschien. Generell wurden jedoch „teutsche Knechte“ gegenüber etwa den „Welschen“ bevorzugt übernommen.
[119] Jaroslav [Jerßlau] Adam Schaffmann [Ssofman] v. Hemerles [Hemrles, Hermerles], auf Konarowicz u. Weltrub [ -1669], schwedischer Obristleutnant, Obrist.
[120] Die Angaben der Unterhändler bei CHEMNITZ, Königlichen Schwedischen […], Krieg, CHEMNITZ, Königl. Schwedischer […] Krieg, 1. Buch, 60. Kap., S. 271f., weichen davon ab.
[121] Akkord: Übergabe, Vergleich, Vertrag: Vergleichsvereinbarungen über die Übergabebedingungen bei Aufgabe einer Stadt oder Festung sowie bei Festsetzung der Kontributionen und Einquartierungen durch die Besatzungsmacht. Angesichts der Schwierigkeiten, eine Stadt oder Festung mit militärischer Gewalt einzunehmen, versuchte die militärische Führung zunächst, über die Androhung von Gewalt zum Erfolg zu gelangen. Ergab sich eine Stadt oder Festung daraufhin ‚freiwillig‘, so wurden ihr gemilderte Bedingungen (wie die Verschonung von Plünderungen) zugebilligt. Garnisonen erwarteten je nach Lage der Dinge meist einen ehrenvollen Abzug und zogen in der Regel gegen die Verpflichtung ab, die nächsten sechs Monate keine Kriegsdienste beim Gegner zu leisten. Auch wurde festgelegt, z. B. 1634 Landsberg/Warthe beim Abzug der kaiserlichen Garnison; THEATRUM EUROPAEUM 3. Bd., S. 196: „Ingleichen sollen sie vor- vnd bey dem Abzug einigen Einwohner / Bürger vnnd Schutzverwandten / er sey Geist- oder Weltlich / im geringsten nicht beleydigen / vielmehr aber / was jedweder Officierer vnnd Soldat der Burgerschafft schuldig / so entlehnet / oder mit Gewalt abgenommen / vorm Abzug richtig bezahlen“. Vgl. auch die genauen Festlegungen im Akkord von Dömitz (26.12.1631; THEATRUM EUROPAEUM 2. Bd., S. 497ff.). Zumeist wurden diese Akkorde vom Gegner unter den verschiedensten Vorwänden, z. B.. wegen der Undiszipliniertheit ihrer Truppen oder weil die Abziehenden gegen den Akkord verstießen, nicht eingehalten.
[122] Untersteckung, Unterstoßung, „Unterstellung“, „unterhaltung“: (zwangsweise) Eingliederung von (insbesondere gefangen genommenen) Soldaten in bestehende unvollständige Verbände. „Die ‚Untersteckung‘ von gefangenen Soldaten des Kriegsgegners war in der frühen Neuzeit allgemein üblich, wurde für gewöhnlich von den Betroffenen ohne Widerstände akzeptiert und scheint gar nicht selten die Zusammensetzung eines Heeres erheblich verändert zu haben“ (BURSCHEL, Söldner, S. 158). In der kurbayerischen Armee – Maximilian I. von Bayern war grundsätzlich gegen die Untersteckung wegen der Unzuverlässigkeit in Schlachten – wurden sie als Kugelfang beim Angriff oder Sturm auf eine Stadt vorausgeschickt; SEMLER, Sebastian Bürsters Beschreibung, S. 67. Franz von Mercy hatte nach seinem Sieg bei Tuttlingen (24.11.1643) an die 2000 Franzosen untergesteckt. HEILMANN, Kriegsgeschichte, S. 69f. Doch wurden schon seit dem Böhmischen Krieg Gefangene, die die Untersteckung verweigerten, oft hingerichtet. HELLER, Rothenburg, S. 158: (1645): „Die [bayr.] Furir aber haben alle Häußer, wo Franz. oder Weimar. gelegen, außgesucht und was sie hinterlaßen, alles weggenommen. Wie sie denn im güldenen Greifen einen Weimarischen Feldscherer sampt seiner Feldtruhen, welcher allhie geblieben und hernach wollen nach Hauß ziehen in Holstein, ertapt, übel gemartert und geschlagen, endlich mit sich hinweggefürt und, wie man gesagt, weilen er ihnen nit wollen dienen, auf dem Feld erschoßen“. MAHR, Monro, S. S. 157, bei der Einnahme der Schanze bei Oppenheim: „Als unsere anderen Leute sahen, daß das Schloß gefallen war, rannten sie los, die vorgelagerte Schanze zu erstürmen, in der sich neun Kompanien Italiener mit ihren Fahnen befanden. Ihre Offiziere sahen nun, daß das Schloß hinter ihnen überrumpelt war und daß der Angriff vor ihnen losbrach, da warfen sie ihre Waffen weg und riefen nach Quartier, die ihnen auch gewährt wurde. Ihre Fahnen wurden ihnen abgenommen. Da sie alle bereit waren, in unsere Dienste zu treten, wurden sie vom König Sir John Hepburn zugewiesen, der nicht nur ihr Oberst wurde, sondern auch ein guter Schutzherr, der sie in guten Quartieren unterbrachte, bis sie neu eingekleidet und bewaffnet waren. Aber sie zeigten sich undankbar und blieben nicht, sondern liefen in Bayern alle davon. Nachdem sie einmal die warme Sommerluft verspürt hatten, waren sie vor dem nächsten Winter alle verschwunden“. Teilweise beschaffte man über sie Informationen; SEMLER, Tagebücher, S. 70f. (1633): „Wie beschehen vnd seyn nahendt bei der statt [Überlingen; BW] vier schwedische reütter, so auf dem straiff geweßt, von vnsern tragonern betretten [angetroffen; BW], zwen darvon alsbald nidergemacht, zwen aber, so vmb quartier gebeten, gefangen in die statt herein gebracht worden. Deren der eine seines angebens Christian Schultheß von Friedland [S. 57] auß dem hertzogthumb Mechelburg gebürtig vnder der kayßerlichen armada siben jahr gedient vnd diesen sommer zu Newmarckht gefangen vnd vndergestoßen [am 30.6.1633; BW] worden: der ander aber von Saltzburg, vnderm obrist König geritten vnd zu Aichen [Aichach; BW] in Bayern vom feind gefangen vnd zum dienen genötiget worden. Vnd sagte der erste bei hoher betheurung vnd verpfändung leib vnd lebens, dass die schwedische vmb Pfullendorff ankomne vnd noch erwartende armada 24 regimenter starck, vnd werde alternis diebus von dem Horn vnd hertzogen Bernhard commandirt; führen 4 halb carthaunen mit sich vnd ettlich klainere veld stückhlin. Der ander vermainte, daß die armada 10.000 pferdt vnd 6.000 zu fůß starckh vnd der so geschwinde aufbruch von Tonawerd [Donauwörth; BW] in diese land beschehen seye, weiln man vernommen, daß die kayserische 8000 starckh in Würtemberg eingefallen“. => Kriegsgefangene.
[123] Landsberg O. S. [Gorzów Śląskie; LK Olesno]; HHSSchl, S. 264f.
[124] Frankfurt a. d. Oder; HHSD X, S. 177ff.
[125] Ernst Georg Graf v. Sparr [Sparre, Spara] zu Trampe auf Greifenberg [1596 Trampe bei Eberswalde-Juni/September 1666], kaiserlicher Generalfeldzeugmeister.
[126] Werbung: Der jeweilige Kriegsherr schloss mit einem erfahrenen Söldner (Obrist, Obristleutnant, Hauptmann) einen Vertrag (das sogenannte „Werbepatent“), in dem er ihn eine festgelegte Anzahl von Söldnern (auch „Neugeschriebene“ genannt) anwerben ließ. Dafür wurde ihm ein der von Städten und Territorien wegen der Ausschreitungen gefürchteter => Musterplatz angewiesen. Zudem erhielt der Werbeherr eine vereinbarte Geldsumme, mit der er die Anwerbung und den Sold der Geworbenen bezahlen sollte (=> Werbegeld). Manchmal stellte der Werbende auch Eigenmittel zur Verfügung, beteiligte sich so an der Finanzierung und wurde zum „Gläubiger-Obristen“ des Kriegsherrn. Zudem war der Werbeherr zumeist Regimentsinhaber der angeworbenen Truppen, was ihm zusätzliche beträchtliche Einnahmen verschaffte. Der Zeitzeuge Hanns Kahn aus Klings/Rhön; LEHMANN, Leben und Sterben, S. 196: „Ein bayerischer Major der kaiserlichen Armee verlangt 5.200 Taler, um eine Kompanie Reiter zu werben. Das Geld wird ‚von den armen und übel geplagten Leuten herausgetrieben‘. ‚Weil der Major großen Zulauf bekommt, wird die Kompanie bald komplett, welche den 28. März des folgenden Jahres nach Hildburghausen marschiert‘. Insgesamt kosten die Anwerbungen 12.000 Taler an Werbe- und Verpflegungsgeldern“. Manche Rekruten wurden von den Werbeoffizieren doppelt gezählt oder unerfahrene, z. T. invalide und mangelhaft ausgerüstete Männer als schwerbewaffnete Veteranen geführt, um vom Obristen eine höhere Summe ausgezahlt zu erhalten. Auch Hauptleute, meist adliger Herkunft, stellten Kompanien oder Fähnlein auf eigene Kosten dem Kriegsherrn bzw. einem Obristen zur Verfügung, um dann in möglichst kurzer Zeit ihre Aufwendungen wieder hereinzuholen und noch Gewinne zu erzielen, was zu den üblichen Exzessen führen musste. Teilweise wurde die Anwerbung auch erschlichen oder erzwungen. Auf der Straße eingefangene Handwerker wurden für Wochen ins Stockhaus gesteckt und durch die Erschießung von Verweigerern zum Dienst gezwungen; SODEN, Gustav Adolph II, S. 508. Wie schwierig Werbungen bereits 1633 geworden waren, zeigen die Aufzeichnungen des Dr. Molther aus Friedberg; WAAS, Chroniken, S. 141: „Im Junio [1633] hat die hiesige Stadt und allenthalben die Grafschaften und adeligen Örter Volk geworben, welches zu Heilbrunn [April 1633] ist beschlossen worden, und hat die Stadt alhier 24 Mann sollen werben. Es ist aber keiner zu bekommen gewesen. Man hat einem zu Fuß geboten 10, 20, auch 30 Thaler, wohl auch 40, und hat doch fast niemand bekommen können. Derowegen hat der Officier, so das Volk abholen sollen, die Soldaten, so die Stadt Wetzlar geworben, hero geführet, so 16 Mann sind gewesen, und so lang hier behalten, bis die Stadt ihre 24 Mann hat gehabt. Darbei noch gedrohet, er wollte, so sie nicht balde geworben, die Burger und deren Söhne mitnehmen“. Für Anfang 1643 heißt es in den Aufzeichnungen aus Mühlhausen über die Werbemethoden des schwedischen Kommandanten in Erfurt, Caspar Ermes; JORDAN, Mühlhausen, S. 97: „In diesem Jahre legte abermals der Commandant von Erfurt einen Capitän mit einer Compagnie Infanterie in die Stadt, um Soldaten zu werben. Weil sie aber nicht viel Rekruten bekamen, so machten sie einen listigen Versuch. Sie warfen Geld in die Straße; wenn nun jemand kam und es aufhob, so sagten sie, er hätte Handgeld genommen, er müsse nun Soldat werden. Im Weigerungsfalle steckten sie solchen Menschen in den Rabenturm, wo er so lange mit Wasser und Brod erhalten wurde, bis er Soldat werden wollte“. In einem Bericht aus Wien (Dezember 1634) heißt es: „Aus Schwaben und Bayern kommen wegen der großen Hungersnoth viele tausend Menschen auf der Donau herab, so dass man immer von Neuem werben und die Regimenter complettiren kann“. SODEN, Gustav Adolph III, S. 129. JORDAN, Mühlhausen, S. 90f. (1637) über den Werbeplatz Sporcks: „Den 4. April ist er wieder mit etlichen Völkern zurückgekommen und hat sich mit denselben hier einquartiret und seinen Werbeplatz hier gehabt, hat auch viel Volk geworben, wie denn die Eichsfelder und andere benachbarte häufig zuliefen und Dienst nahmen, nur daß sie ins Quartier kamen und die Leute aufzehren konnte. Viele trieb auch der Hunger. Als es aber ans Marchiren gehen sollte, so wurde aus dem Marchiren ein Desertieren“. Für Anfang 1643 heißt es über die Werbemethoden des schwedischen Kommandanten in Erfurt, Caspar Ermes; JORDAN, Mühlhausen, S. 97: „In diesem Jahre legte abermals der Commandant von Erfurt einen Capitän mit einer Compagnie Infanterie in die Stadt, um Soldaten zu werben. Weil sie aber nicht viel Rekruten bekamen, so machten sie einen listigen Versuch. Sie warfen Geld in die Straße; wenn nun jemand kam und es aufhob, so sagten sie, er hätte Handgeld genommen, er müsse nun Soldat werden. Im Weigerungsfalle steckten sie solchen Menschen in den Rabenturm, wo er so lange mit Wasser und Brod erhalten wurde, bis er Soldat werden wollte“. Vgl. RINKE, Lippe, S. 20f.; Die Hildesheimer Handwerksmeister berichteten dem Rat am 12./22.11.1638, dass „die Handwercksbursch […] vor den Stadtthoren nicht allein angehalten und befragt worden, ob sie Lust haben, sich alß Soldaten gebrauchen zu laßen, sondern auch überredet werden, daß sie keine Arbeit allhier bekommen können […] und wann sie sich deßen verweigern, die Werber […] sie dahin nötigen, daß sie Geldt nehmen oder […] ihnen die Bündel vom Halße schneiden undt anders, waß sie sonsten bey sich tragen, nehmen, biß sie sich zu der Soldaten Charge sich verstehen wollen“. PLATH, Konfessionskampf, S. 482. Unter 1642 heißt es in Raphs Chronik von Bietigheim (BENTELE, Protokolle, S. 200) , dass der kaiserliche Obristwachtmeister Dusin 1642, weil er „mit Werbung eines Regiments und Musterung desselben gegen dem Bayerfürsten großen Falsch gebraucht, auch andere tyrannische Untaten in der Marggrafschaft Durlach und anderswo unerhört verüebt, hingegen mit Klaidungen Tractamenten und Dienern sich mehr als fürstlich haltend und hierdurch alles Geld, üppiglich vergeudet hat, zu Tüwingen [Tübingen; BW] uff der Burgstaig seinem Verschulden nach mit dem Schwert gerichtet worden. Sein Großvatter soll ein Großherzog zu Venedig gewesen sein“. Der Schweriner Dompropst und Ratzeburger Domherr, Otto von Estorf [1566 – 29.7.1637], berichtet in seinem „Diarium belli Bohemici et aliarum memorabilium“ zum April 1623: „Dietrich von Falkenstein ein Mansfeldischer Werber, so vor wenig tagen zue Breslau eingezogen, ist gerichtet, der Andere, so catholisch geworden, ist beim Leben erhalten“. DUVE, Diarium belli Bohemici et aliarum memorabilium, S. 26. Vgl. auch ERB, Die Werber in Schwallungen 1620; SCHENNACH, Tiroler Landesverteidigung, S. 275ff.
[127] anschmitzen: anhängen.
[128] Christian IV. König v. Dänemark [12.4.1577 Schloss Frederiksborg-18.2.1648 Schloss Rosenborg/Kopenhagen]. Vgl. HEIBERG, Christian 4; FINDEISEN. Christian IV.
[129] Boizenburg [LK Ludwigslust-Parchim]; HHSD XII, S. 5ff.
[130] Johann ‘t Serclaes Graf v. Tilly [Feb. 1559 Schloss Tilly, Gemeinde Villers-la-Ville/Villers; Herzogtum Brabant-30.4.1632 Ingolstadt], ligistischer Feldmarschall. Vgl. KAISER, Politik; JUNKELMANN, Der Du gelehrt hast; JUNKELMANN, Tilly.
[131] N Traitor [ – ], dänischer Offizier. Um Hinweise wird gebeten !
[132] Feldmarschall [schwed. fältmarskalk, dän. feltmarskal]: Stellvertreter des obersten Befehlshabers mit richterlichen Befugnissen und Zuständigkeit für Ordnung und Disziplin auf dem Marsch und im Lager. Dazu gehörte auch die Organisation der Seelsorge im Heer. Die nächsten Rangstufen waren Generalleutnant bzw. Generalissimus bei der kaiserlichen Armee. Der Feldmarschall war zudem oberster Quartier- und Proviantmeister. In der bayerischen Armee erhielt er 1.500 fl. pro Monat, in der kaiserlichen 2.000 fl. [nach der „Ordnung Wie es mit der verpflegung der Soldaten“ (1630)], die umfangreichen Nebeneinkünfte nicht mitgerechnet, war er doch an allen Einkünften wie Ranzionsgeldern, den Abgaben seiner Offiziere bis hin zu seinem Anteil an den Einkünften der Stabsmarketender beteiligt.
[133] Vgl. die Darstellung des englischen Soldnerführers Monro zu den Kämpfen im August um die Schanze bei Boizenburg Anfang 1627; MAHR, Monro, S. 34ff.
[134] ex post facto: nach dem Geschehen.
[135] Meißen; HHSD VIII, S. 223ff.
[136] Jacob Bohm [Boom, Baum] [ – ], schwedischer Obrist.
[137] bastant: widerstandsfähig.
[138] Afterreden: üble Nachreden.
[139] Beständiger Bericht und Schutzrede / Deß Hochwohlgebohrnen Graven und Herrn / Herrn Heinrich Matthes Grafen von Thurn … Generaln : Darinn Das / jüngsthin den 1. Oct. bey der Steinawer Brucken in Schlesien erfolgtes Unheil / dessen Ursprung Mittel und Verlauff / zu Verhütung ungleichen Verdachts und irriger Meynung / ordentlich und richtig erzehlet und beschrieben würdt. Frankfurt/M. 1633. [SLUB Dresden: Hist.Germ.C. 559,111]
[140] Schlacht bei Steinau 11.10.1633: Schlacht bei Steinau an der Oder (Śinawa, Kr. Wohlau): Wallenstein schlug die Schweden, Brandenburger und Sachsen unter Heinrich Matthias Graf Thurn und Heinrich Jakob Duwall. Vgl. Thurns Verteidigungsschrift, Beständiger Bericht vnd SchutzRede / Des Hochwolgebornen Graven vnd Herrn / Herrn Heinrich Matthes / Grafen von Thurn … Generaln : Darinnen Das jüngsthin / den 1. Octob. bey der Steinawer Brücken in Schlesien erfolgtes Unheil / dessen Ursprung / Mittel vnd Verlauff / zu verhütung ungleichen Verdachts vnd irriger Meinung / ordentlich vnd richtig erzehlet vnd beschrieben wird [http://digital. Slub.dresden.de/id3811300331/1].
[141] Elbing [Elbląg, Stadtkr.]; HHSPr, S. 45ff.
[142] Vivres: Lebensmittel.
[143] Dominsel Breslau: Kathedrale St. Johannes des Täufers auf Ostrów Tumski, der Dominsel von Breslau.
[144] Johann Melchior Ritter v. Schwalbach [Schwallenberg] [30.12.1581 Gießen-30.6.1635 Dresden], kursächsischer Generalfeldzeugmeister.
[145] August Adolf Freiherr v. Trandorf [Drandorff] [ca. 1600-15.2.1656 Bad Mergentheim], kursächsischer Obrist.
[146] KREBS, Hans Ulrich Freiherr von Schaffgotsch, S. 44.
[147] Christoph Schneider [ – ], kursächsischer Obrist.
[148] N Bonitz [ – ], kursächsischer Obrist. Vgl. LUCAE, Schlesiens curieuse Denckwürdigkeiten, 2. Bd., S. 1408.
[149] GOTTFRIED, Historische Chronik, S. 484.
[150] Neumarkt in der Oberpfalz [LK Neumarkt in der Oberpfalz; HHSD VII, S. 505f.
[151] HALLWICH, Wallenstein’s Ende 2. Bd. 129.
[152] Generalleutnant [schwed. generallöjtnant, dän. generalløjtnant]: Der Generalleutnant vertrat den General bzw. Feldherrn und war in der kaiserlichen, kurbayerischen, dänischen und schwedischen Armee der höchste Befehlshaber und Stellvertreter des Kaisers und des Königs/der Königin, mit weitgehenden politischen und militärischen Vollmachten. Über ihm stand nur noch der „Generalissimus“ mit absoluter Vollmacht. 1625 wurde er mit 908 Rt. monatlich in der dänischen Armee besoldet; OPEL, Der niedersächsisch-dänische Krieg 2. Bd., S. 171. Als Rekompens erhielt er in der kaiserlichen und kurbayerischen Armee für seine Leistungen Landzuweisungen (zumeist aus eroberten Gebieten oder den sogenannten „Rebellengütern“) sowie die Erhebung etwa in den Grafen- oder Herzogsstand. Als Stellvertreter seines Dienstherrn führte er Verhandlungen mit den Ständen, erzwang die Depossedierung von Adligen und Absetzung von Territorialherrn in den besetzten Gebieten und lenkte durch seine Abgesandten auch Friedensverhandlungen. Wichtige Träger der gesamten Organisation des Kriegswesens waren dabei die Generalkriegskommissare und die Obristen, die in der Regel nach ihm oder nach seinen Vorschlägen bestallt wurden.
[153] Wilhelm IV. Herzog v. Sachsen-Weimar 11.4.1598 Altenburg-17.5.1662 Weimar], schwedischer Generalleutnant. Vgl. HUSCHKE, Wilhelm IV.
[154] Inconvenientien: Misshelligkeiten, Frechheiten.
[155] Kriegskommissar [schwed. war kommissionär, dän. war-kommissær]: Bevollmächtigter des Kriegsherrn zur Eintreibung von Kriegssteuern (Kontribution). Als Quartierkommissar legte er darüber hinaus die Einquartierungen der Soldaten fest. (Der Quartiermeister bzw. Fourier sorgte dann für deren praktische Umsetzung; vgl. s. v. „Fourier“.) Der „Musterkommissarius“ führte in landesherrlichem Auftrag die Musterungen durch und überwachte die Zusammensetzung des Heeres. Musterkommissare waren bei gemeinen Soldaten wie Offizieren gleichermaßen verhasst, da sie Manipulationen und Betrügereien auf den Musterplätzen zu unterbinden suchten: Söldner erschlichen sich vielfach Sold, indem sie sich unter verändertem Namen mehrfach mustern ließen, Offiziere führten zuweilen mehr Männer in den Soldlisten, als tatsächlich vorhanden waren, um die eigene Tasche mit den überschüssigen Löhnungen zu füllen (vgl. BURSCHEL, Söldner, S. 120ff.). Auch hatten sie die Abdankungen und die Zusammenlegung und Neuformierung kleiner Einheiten zu überwachen. Dänische Kriegskommissare erhielten monatlich ab 1625 zwischen 200 und 400 Rt. je nach Aufgabenbereich; OPEL, Der niedersächsisch-dänische Krieg 2. Bd., S. 171. Der Anteil der Kontributionsgelder an den Einkünften der Generalkriegskommissare und Kriegskommissare betrug bis zu 30 %. So erhielt z. B. der kurbayerische Kriegskommissar Christoph von Ruepp vom 18.1.1621 bis 30.4.1633 95.341 fl., davon 30.347 fl. Kontributionsgelder. DAMBOER, Krise, S. 51; vgl. auch PFEILSTICKER, Lang. In einer Landtagsbeschwerde des Gerichtes Hörtenberg wird geklagt, daß bei Durchzügen „auch tails beglaitcommissari den unntertonnen mehr sched- als nutzlich sein, in deme sy mer dem soldaten beifallen, unnd in ansuechenden unerzeuglichen sachen recht geben, als den unnderthonnen obhabennden gebierennden schutz erweisen“. SCHENNAT, Tiroler Landesverteidigung, S. 63. Zum Teil wurden Kriegskommissare wie Johann Christoph Freiherr v. Ruepp zu Bachhausen zu Obristen befördert, ohne vorher im Heer gedient zu haben; Bayerisches Hauptstaatsarchiv München Kurbayern Äußeres Archiv 2398, fol. 577 (Ausfertigung): Ruepp an Maximilian I., Gunzenhausen, 1631 XI 25. „Im Dreißigjährigen Krieg machten sich jüdische Kommissare unersetzlich. Ein schwedischer Diplomat sagte: ‚Alle Juden sind Kommissarii, und alle Kommissarii sind Juden‘ “ [MÜHLAUER, Des Kaisers Kommissar]. Teilweise wird in zeitgenössischen Chroniken auch festgehalten, dass Kriegskommissare ihr Amt aufgaben, um sich nicht länger an der Ausbeutung der kriegsverarmen Leute zu beteiligen; Chronik des Sweder von Schele, Teil 3, fol. 877 (Juli 1634).
[156] Alexander [v.] Erskein [Esken, Eske, Erskeine, Eßkhen, Eschen] [31.1.1598 Greifswald-27.7.1656 Zamość], schwedischer Kriegsrat, Resident. Vgl. http://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=15450.
[157] HUSCHKE, Herzog Wilhelm, S. 170.
[158] Ludwig I. Fürst v. Anhalt-Köthen [17.6.1579 Dessau-7.1.1650 Köthen]. Vgl. KRAUSE, Gottlieb, Ludwig, Fürst zu Anhalt-Cöthen und sein Land vor und während des Dreißigjährigen Krieges. 3 Bände. Köthen und Neusalz 1877-1879; KRAUSE, Urkunden, Aktenstücke und Briefe, Bd. 1-5. Vgl. Genealogie der Fürsten von Anhalt um die Zeit Christians II. von Anhalt-Bernburg (1599–1656), unter: http://diglib.hab.de/edoc/ed000228/start.htm: Digitale Edition und Kommentierung der Tagebücher des Fürsten Christian II. von Anhalt-Bernburg (1599-1656). in: Editiones Electronicae Guelferbytanae. Wolfenbüttel 2013.
[159] Ranstadt [Wetteraukreis].
[160] SCHERER, Sächs. Regimenter, Nr. 13.
[161] Hans XIV. v. Rochow [Rochaw, Rohau] [18.8.1596 Zinna-16.9.1660 Stülpe], kursächsischer Obrist.
[162] Hieronymus [Geronimo] Graf v. Colloredo-Waldsee [1582-Juli 1638 bei St. Omer], kaiserlicher Feldmarschallleutnant.
[163] Pressnitz [Přisečnice; Kr. Chomutov (Komotau)]: Bergstadt im Erzgebirge, bis 1974 an der Stelle, wo sich heute die große Fläche der Pressnitztalsperre (vodní nádrž Přisečnice) erstreckt. Häuser, Kirchen und Schloss von Přisečnice sowie die benachbarten Dörfer Rusová (Reischdorf) und Dolina (Dörnsdorf) wurden abgerissen und an deren Stelle der Fluss Přísečnice (Pressnitz) gestaut.
[164] Frauenstein [LK Mittelsachsen]; HHSD VIII, S. 98f.
[165] Freiberg [LK Mittelsachsen]; HHSD VIII, S. 99ff.
[166] Vorwerk: Wirtschaftshof eines Rittergutes oder landesherrlichen Amtes oder Schlosses.
[167] Abraham Schönnickel [Schonickel, Schönickel, Schönicke, Schönick; Trehenickel ?] [ – ], kaiserlicher Obrist.
[168] Zwickau; HHSD VIII, S. 380ff.
[169] Reitzenhain; heute Ortsteil von Marienberg [Erzgebirgskreis].
[170] Glashütte [Dippoldiswalde]; HHSD VIII, S. 115f.
[171] Johann Georg I. Kurfürst v. Sachsen [5.3.1585 Dresden-8.10.1656 Dresden].
[172] Garnison: Besatzung in einer Festung (Kavallerie und Infanterie). Die monatliche Löhnung der Soldaten, der Servis und die Fourage mussten von der betreffenden Garnisonsstadt aufgebracht werden und waren genau geregelt; vgl. die „Königlich Schwedische Kammer-Ordre“ Torstenssons vom 4.9.1642 bei ZEHME, Die Einnahme, S. 93ff. Der Garnisonsdienst wurde wegen der geringeren Aussicht auf Beute, Hunger und Krankheiten bei längerer Einquartierung immer unbeliebter, so dass man dazu überging, neugeworbene Söldner im Felddienst einzusetzen. Der französische Diplomat François Ogier [um 1597-1670] schrieb 1635 über die schwedische Garnison in Marienburg [Malbork]: „Ich betrachtete das Lager und die Unterkünfte der Schweden und sah ein Bild von menschlichem Elend und Wahnsinn. Ich sah in die Gesichter der Männer, und da ich nicht erkennen konnte, dass sie sich unterhielten, zweifelte ich daran, ob sie überhaupt Männer waren, so barbarisch, schmutzig und krank waren sie. Alle waren in Lumpen gekleidet und barfuß, und zum größten Teil handelte es sich um unhöfliche, junge Bauern“. BRZEZINSKI; HOOK, Armee, S. 52. KELLER, Drangsale, S. 401ff.: „Ein Zeitgenosse, der in Philippsburg gezwungen als Garnisonssoldat zubringen mußte, gibt uns darüber folgende interessante Notizen, die auf jede Garnison passen dürften. ‚So mußte ich denn’, erzählt er uns, ‚Musquetirer werden wider meinen Willen. Das kam mir aber sauer an, weil der Schmalhanz da herrschte und das Commißbrod schrecklich klein war. Ich sage nicht vergeblich: schrecklich klein – denn ich erschrack auch alle Morgen, wenn ich’s empfing, weil ich wußte, daß ich mich den ganzen Tag damit behelfen mußte, da ich es doch ohne Mühe auf einmal aufreiben konnte. Und die Wahrheit zu bekennen, so ist’s wohl ein elend Creatur um einen armen Musquetiren (Garnisonssoldaten), der sich solcher Gestalt mit seinem Brod und noch dazu halb satt, behelfen muß, denn da ist keiner anders, als ein Gefangener, der mit Wasser und Brod sein armseliges Leben verzögert. Ja ein Gefangener hat’s noch besser, denn er darf seiner Ruhe pflegen und hat mehr Hoffnung, als so ein elender Garnisoner, mit der Zeit einmal aus solchem Gefängniß zu kommen. Zwar waren auch Etliche, die ihr Auskommen umb ein kleines besser hatten von verschiedener Gattung, doch keine einzige Manier, die mir beliebte, um solcher Gestalt mein Maulfutter zu erobern, anständig sein sollte. Denn Etliche nehmen, und sollten es auch verlaufene Personen gewesen sein, in solchem Elend keiner anderen Ursach halber Weiber, als daß sie durch solche entweder mit Arbeiten als Nähen, Waschen, Spinnen oder mit Krämpeln und Schachern oder wohl gar mit Stehlen ernähret werden sollen. Da war ein Fähndrich unter den Weibern, die hatte ihre Gage wie ein Gefreiter, eine andere war Hebamme und brachte sich dadurch selbsten und ihrem Manne manch guten Schmauß zuwege; eine andere konnte stärken und waschen, diese wuschen den ledigen Officieren und Soldaten Hemden, Strümpfe, Schlafhosen und ich nicht weiß nicht, was mehr, davon sie ihren besonderen Namen kriegten; andere verkiefen Taback und versahen den Kerlen ihre Pfeifen, die dessen Mangel hatten; andere handelten mit Brandtwein und waren im Rufe, daß sie ihn mit Wasser verfälschten; eine andere war eine Näherin und konnte allerhand Stich und Nadel machen, damit sie Geld erwarb; eine andere wußte sich blößlich aus dem Feld zu ernähren, im Winter grub sie Schnecken, im Frühling graste sie Salat, im Sommer nahm sie Vogelnester aus und im Herbst wußte sie tausenderlei Schnabelweid zu kriegen; etliche trugen Holz zu verkaufen, wie die Esel. Solchergestalt meine Nahrung zu haben, war für mich nichts. Etliche Kerl ernährten sich mit Spielen, weil sie es besser, als die Spitzbuben konnten und ihren einfältigen Cameraden das ihrige mit falschen Würfeln und Karten abzuzwacken wußten, aber solche Profession war mir ein Eckel. Andere arbeiteten auf der Schanz und sonsten, wie die Bestien, aber hierzu war ich zu faul; etliche konnten und trieben ein Handwerk, ich Tropf hatte aber keins gelernt. Zwar wenn man einen Musicanten nöthig gehabt hätte, so wäre ich wohl bestanden, aber dasselbe Hungerland behalf sich nur mit Trommeln und Pfeiffen; etliche schulderten vor andern und kamen Tag und Nacht nicht einmal von der Wacht. Ich aber wollte lieber hungern, als meinen Leib so abmergeln’ “.
[173] Tetschen [Děčín, Tschechien]; HHSBöhm, S. 610ff.
[174] Zschopau [Erzgebirgskreis]; HHSD VIII, S. 378f.
[175] Marienberg [Erzgebirgskreis]; HHSD VIII, S. 215f.
[176] Annaberg-Buchholz [Erzgebirgskreis]; HHSD VIII, S. 5ff.
[177] Kontribution: Kriegssteuern, die ein breites Spektrum an Sach- oder Geldleistungen umfasste, wurden im Westfälischen als „Raffgelder“ bezeichnet; SCHÜTTE, Dreißigjähriger Krieg, Nr. 45, S. 127; LEHMANN, Kriegschronik, S. 34, Anm. (1632): „Contribution eine große straffe, Sie erzwingt alles, was sonst nicht möglich ist“. Sie wurde auf Grundlage einer Abmachung zwischen Lokalbehörden (zumeist Städten) und Militärverwaltung erhoben. Teilweise wurde den Juden eine Sondersteuer auferlegt (HOCK, Kitzingen, S. 92), um sich selbst einer zusätzlichen Belastung zu entziehen. Die Kontribution wurde durch speziell geschultes, z. T. korruptes Personal (vgl. WAGNER; WÜNSCH, Staffel, S. 122ff.) zumeist unter Androhung militärischer Gewalt oder unter Androhung des Verlusts des Bürgerrechts (das in Erfurt seit 1510 ab dem 16. Lebensjahr erworben werden konnte), des Braurechts, der Benutzung der Allmende, den säumigen Bürgern „das Handwerk zu legen“ etc. (vgl. NÜCHTERLEIN, Wernigerode), und der Zunagelung der Haustüren (JORDAN, Mühlhausen, S. 76 (1633)) eingetrieben. Den Zahlenden wurde als Gegenleistung Schutz gegen die Übergriffe des Gegners in Aussicht gestellt. Nicht selten mussten an die beiden kriegführenden Parteien Kontributionen abgeführt werden, was die Finanzkraft der Städte, Dörfer und Herrschaften sehr schnell erschöpfen konnte. Auch weigerte sich z. T. die Ritterschaft wie im Amt Grimma erfolgreich, einen Beitrag zu leisten; LORENZ, Grimma, S. 667. Vgl. REDLICH, Contributions; ORTEL, Blut Angst Threnen Geld, der diese Euphemismen für Erpressungen, erwartete oder erzwungene „Verehrungen“ etc. auflistet. Der Anteil der Kontributionsgelder an den Einkünften der Generalkriegskommissare und Kriegskommissare betrug bis zu 30 %. So erhielt z. B. der kurbayerische Kriegskommissar Christoph von Ruepp vom 18.1.1621 bis 30.4.1633 95.341 fl., davon 30.347 fl. Kontributionsgelder. DAMBOER, Krise, S. 51. BELLINCKHAUSEN; TEGEDER; KREIENBRINK, S. 268, über die schwedische Einquartierung Dezember 1633 in Osnabrück: Die Soldaten „sagen und klagen, sie bekommen kein geld, da doch stets alle wochen die burger ihr contribution ausgeben mußen, dan das kriegsvolck sagt, das ihr obristen und befehlhaber das geldt zu sich nehmmen und sie mußenn hunger und kummer haben, werden zum stehlen verursacht“. Der Flussmeister und Advokat Johann Georg Maul [? – nach 1656)] (1638), WAGNER; WÜNSCH, Staffel, S. 121: „Weil ich nun zu dieser Contribut[ion] wöchentlich 7 f geben müssen und nicht allemahl sogleich bezahlet habe, bin ich und die Meinigen zu verschiedenen mahlen ohngewarneter Weisse überfallen worden, und man hat mich dermaasen gequälet und gemartert, dass es einen Steine in der Erdte erbarmen möchte, sonderlich in der Heilgen Zeit, am 5. Jan[uar] 1638, da ich eines kleinen Resto wegen von 6 vollgesoffenen Soldaten, der einer, der Berth genannt unter dem Obristen [Heinrich; BW] von Schleiniz, den Degen über mich gezogen, mein Weib, so dazwischen gelaufen, am Arme verwundet, den Gürtel von Leibe in drey Stücken gerissen und solche Grausamkeit verübet, dass es nicht zu beschreiben, vielweniger von Christlichen Menschen geglaubet werden kann, mitler weile, als dieser Berth also mit mir chargierte, haben die andern 5 Bösewichter gemauset, was sie angetroffen, unter andern mir einen Fisch Otter, so man an die Arme stecket, mein Kamm Futter mit aller Zugehör vor 5 f, allerhand Geräthe ohngefähr 8 f, so ich nicht wieder bekommen können“. Aus der Stausenbacher Chronik des Caspar Preis für 1648, ECKHARDT; KLINGELHÖFER, Bauernleben, S. 69: „Im Jahr 1649 in dem Monadt October seind wir einmal der Hessischen Conterbutzion erleitigt worden. Dem allmächtigen, ewigen, barmhertzigen, liben, trewen Gott, dem Vatter aller Gnaden, sey ewigen Lob, Ehr und Preiß gesagt in alle ewigkeit. Amen. In dem schweren Joch der hesischen Conterbutzion seind wir gemartert, gepeinigt und gequället worden zwantzig gantzer Jahr. Ach du mein Gott und mein Herr, wie mancher armer redtlicher ehrlicher Man hatt doch das Seinige musen verlasen und mit dem Rück ansehen und sich in die Fremde begeben musen wegen der Conterbutzion und des gemarterten Bludtgelts. Es ist doch in Wharheit nichts anders dan der armen Leuth Schweiß und Blutt“. Vgl. VOGEL, Leipzigisches Geschicht-Buch, S. 443: „Den 11 Junii [1631; BW] zur Nacht hat sich eines vornehmen Doctoris Frau im Brühl / welches mit schwermüthigen Gedancken beladen aufm Gange im Hembde an eine Quele erhencket / weil sie / wie man sagte / denen Soldaten Quartier und Geld geben müssen / welche 2 alte Weiber loßgeschnitten / von Todtengräbern abgehohlet / und den 13. dieses mit einer kleinen Schule begraben worden“. Der Anteil der Kontributionsgelder an den Einkünften der Generalkriegskommissare und Kriegskommissare betrug bis zu 30 %. So erhielt z. B. der kurbayerische Kriegskommissar Christoph von Ruepp vom 18.1.1621 bis 30.4.1633 95.341 fl., davon 30.347 fl. Kontributionsgelder. DAMBOER, Krise, S. 51. Die Kontribution wurde oft auch zweckentfremdet; vgl. SEMLER, Tagebücher, S. 23 (1633): „Man sagt, daß die von Bodman ohngefahr 30 thaler für ihre contribution dem obrist leüttenant [Edlinstetten; BW] alhie, alß ihrem vettern, zu hannden gestellt, darmit sie ihme genůgsambe satisfaction geben, er aber diß gellt dem apotegger zutragen laßen mit begeren, solle ihme darumb confect schickhen. Da man vnß aber bereden wollen, auß disem contribution gellt werde man die soldaten beklaiden vnd in daß veld ausstaffieren“. Die ausführlichste Darstellung der Erpressung von Kontributionen durch Besatzungstruppen findet sich bei NÜCHTERLEIN, Wernigerode, S. 73ff. => Hrastowacky in den „Miniaturen“. VOGEL, Leipzigisches Geschicht-Buch, S. 443: „Den 11 Junii [1631; BW] zur Nacht hat sich eines vornehmen Doctoris Frau im Brühl / welches mit schwermüthigen Gedancken beladen aufm Gange im Hembde an eine Quele erhencket / weil sie / wie man sagte / denen Soldaten Quartier und Geld geben müssen / welche 2 alte Weiber loßgeschnitten / von Todtengräbern abgehohlet / und den 13. dieses mit einer kleinen Schule begraben worden“. In den bei Angriffen und Belagerungen ohnehin gefährdeten Vorstädten waren die Kontributionsleistungen geringer. Allerdings bestand hier auch immer die Gefahr, dass die Vorstädte entweder vom Feind abgebrannt oder seitens der Stadtkommandanten abgerissen oder abgetragen wurden, um dem Feind keine Verstecke zu bieten und um ein freies Schussfeld zu haben.
[178] Vergewaltigung, „Schändung“, „Schwechung“: Vergewaltigung war in den Kriegsartikeln aller Armeen ausdrücklich verboten und mit der Todesstrafe bedroht, war aber von Anfang an eines der häufigsten Delikte, wenngleich z. T. in den offiziellen Kriegsberichten an den Kriegsherrn absichtlich unterschlagen, aber auch in den Taufregistern immer wieder auftauchend. Auf Vergewaltigung stand schon in den Kriegsartikeln Gustav II. Adolfs von 1621 die Todesstrafe. THEATRUM EUROPAEUM 3. Band, S. 617: „So ist auch ein Polnischer Edelmann / welcher sampt seinem Knecht / ein Weibsbild geschändet / und deßwegen bey seinem Obristen angeklagt gewesen / zur Rede gestellt / unangesehen er eine grosse Summa Gelts für sein Leben geboten / gleichwol anfangs der Knecht in Gegenwart und Ansehen deß Edelmanns / enthauptet / und hernach er folgenden Tags auch mit dem Schwerd hingerichtet worden“. Im Taufregister der Kirche zu Wiesa wird als Vater eines am 7.8.1633 getauften Kindes eingetragen: „drey Soldaten“, für den am folgenden Tag getauften Sohn einer Witwe werden „zwene Soldaten“ aufgeführt. UHLIG, Leidenszeiten, S. 11.; vgl. die Zweifel der Pfarrer bei GROßNER; HALLER, Zu kurzem Bericht, S. 14, 66; Balgstedt im Besitz der Herren von Heßler und von Schieck 1616-1744: „1634 läßt Frau Thiele Zwillinge taufen; ihr Mann Hans Thiele hatte sie verlassen und war in den Krieg gezogen. In dem selben Jahre wird der außereheliche Sohn der Anna Schild getauft, welche sagt, sie sei voriges Jahr nach Pfingsten nach Laucha gegangen und auf dem Heimwege unterm Hain beim Spillingsgarten von einem Reiter überfallen worden, weshalb das Kind „Hans Reuter“ getauft wird“. Zur Schändung auch von Schwangeren vgl. HERRMANN, Aus tiefer Not, S. 54. Teilweise waren selbst Reiterjungen daran beteiligt; BLUME; RUNZHEIMER, Gladenbach, S. 323: „2 Jungen / Reiterjungen / habenn Cuntzen heintzgenn Hansenn metgen notzüchtigen wollen, habens uff die Erde geworffen undt das Maul zu gehalten. Sey ohngefehr 13 Jahr alt. Der Hoffmeister aber hab diese Jungen der maßen gezüchtigt, das sies nit wohl leugnen können“. Im 1658 erschienenen „Schwedenspiegel“ heißt es unter dem 6. Gebot: „Deß Königs Gustavi Bastard Sohn Gustavus Gustavessen – wie er in Osenbrug [Osnabück; BW] Gouverneur gewesen – eröffnet bey nächtlicher Zeit alda einem ehrlichen Bürger sein Hauß – nimbt ihm seine Tochter – schändet sie – und sendet ihm solche hernach wieder zu Hauß. Wann solche Schelmstück – in Feindes Landen weren verübet worden – so were es ja mehr dann Gottloß – aber dieses alles ist geschehen – wie der Schwed ihr Beschützer seyn sollen“. Zit. bei STRAHLMANN, Wildeshausen, S. 91, Anm. 2. Über Sperreuter heißt es z. B. auch: „Der Bürgermeisterin von Wemding soll er die Pistole an den Kopf gehalten haben, als diese ihm nicht ihre 13-jährige Pflegetochter überlassen wollte. In Nördlingen soll er eine 12-jährige[n] Lohweberstochter genötigt haben, die er dann sogar zum weiteren Gebrauch mit nach Augsburg nahm“. KODRITZKI, Seitenwechsel, S. 154f. Die Dunkelziffer von Vergewaltigungen mag aus verständlichen Gründen um ein Vielfaches höher gelegen haben.Vgl. auch MAHR, Monro, S. 56f.; Denkschrift über den Ruin der Landgrafschaft Hessen-Darmstadt infolge des Durchzugs, besonders durch die Kaiserlichen, aus dem Dezember 1634; HERRMANN, Aus tiefer Not, S. 108ff.: „Das kaiserliche, hispanische und ligistische volk ist alles auf unsern gnädigen fürsten und herren gezogen, liegt auch dessen noch ein namhafter anteil im land; jetzo ziehen wieder 4 regimenter hindurch, brauchen einen wunderlichen weg, nicht nach der straßen, sondern gar umschweifig nach einem circumflexu. Wollen viel geld haben, dessen doch bei so vielfältigen, ganz grundverderblichen durchplünderungen keines vorhanden. Vieh, frucht ist alles weg; der wein, den man nicht austrinken können, in die erde gelassen. Die besten flecken und dörfer liegen in der asch. Etlich tausend weibspersonen seind geschändet, – ja gar auch junge knaben, quod horrendum – in der schändung gar getötet. Dem herrn kammerpräsidenten Karspach ist bei seiner lieben alten mutter begräbnis in unversehener behendigkeit eine trupp auf den hals kommen, haben 16 adeliche weibspersonen in der trauer an der mahlzeit befunden, deren 8 sobald genotzüchtigt, eine adeliche jungfrau, so eine Schelmin von Bergen (eine einige tochter ihrer eltern) gar auf den offenen markt gelegt und publice geschändet; 8 derselben adelichen damen seind entloffen, haben sich in ein hühnerhaus verkrochen, bis daß der sturm vorüber gewesen. Zween tag vor unsers gnädigen fürsten und herrn wiederanlangung in dero landen ist ein jählicher einfall in dero flecken Oberrosbach [Ober-Rosbach/Kr. Friedberg; HHSD IV, S. 356f.; BW] geschehen, seind alle und jede sich darin befindende weibsbilder (nur 4 ausgenommen) violento stupro vitiiert worden. Hin und wieder im land seind noch sehr viel weibspersonen verloren, von denen man nicht weiß, wohin sie kommen“. Sogar Reiterjungen waren an solchen Vorgängen beteiligt; BLUME; RUNZHEIMER, Gladenbach, S. 323: „2 Jungen / Reiterjungen / habenn Cuntzen heintzgenn Hansenn metgen notzüchtigen wollen, habens uff die Erde geworffen undt das Maul zu gehalten. Sey ohngefehr 13 Jahr alt. Der Hoffmeister aber hab diese Jungen der maßen gezüchtigt, das sies nit wohl leugnen können“. Das Kriegstagebuch des Rüthener Bürgermeisters Christoph Brandis (ca. 1578-1658) über die hessische Einquartierung 1636 hält fest; CONRAD; TESKE, „Sterbzeiten“, S. 309f.: „Den 7ten April geschah eine schaendliche That. Ein Soldat Namens Mathes quartirte in D-s Hause (c. Da der Name dieses Buergers noch wirklich in Ruethen existirt, so fand ich vor gut ihn hinweg zu lassen.). Dieser Mathes hatte ihn schon vorher durch Einschlagung der Fenster, Thueren und Tischen, ja selbst durch schwere Pruegelsuppen viel molestiert [= belästigt], nun fehlte pro coronide ceterarum crudelitatum [= als Krönung weiterer Gefühllosigkeiten] noch das schlimmste. Am 7ten Morgens, als mehrbesagter Mathes noch auf der Buehne [= dem Lagerboden] lag, rief er herunter, man sollte ihm einen Pott voll Milch bringen oder er wollte alles zusammenhauen. D. schickt seine Tochter ein wackeres 17 Jahr altes Maedchen, ins Nachbarshaus, um welche zu bekommen. Weil nun das Maedchen ein wenig lange ausgeblieben, hat der Mathes destomehr gelermt, bis sie endlich gekommen und ihr Vater ihr gesagt: Sie sollte es dem Soldaten hinauftragen. Sie war iussu Patris [= auf Geheiß des Vaters] kaum heraufgekommen, als sie der Mathes zu seinem Willen haben wollte, sie wehrte sich, so gut sie konnte, und rief nach Huelfe, der Soldat aber stak ihr die geknueffte (geballte) Faust ins Maul. Indeß hatte der Vater doch etwas davon gehoert, er eilte mit seiner Hausfrauen herauf, Mathes aber hatte die Thuer schon zugeschallert [= zugeriegelt], und die armen Eltern mußten durch ein Loch, das Mathes schon einige Zeit zuvor in die Thuer gehauen hatte, ihr eignes Kind schaenden sehen ohne ihr helfen zu koennen. Der Kerl hatte ihr benebens [= dabei] die rechte Brust (d. Im Original steht eine andere bloß in Westfalen uebliche Benennung.) weil es sich vermuthlich zu stark gewehrt hatte, ganz und gar aufgerissen, so daß ein ganzes Stueck nachhero herausgefallen, und das Maegdlein ganz unmenschlich zugerichtet, unter unaufhoerlichen Schmerzen 14 Tage darauf verstorben. Der Vater gieng heute mit mir zu dem Hauptmann, um sich wegen des mehr besagten Mathes zu beklagen; aber er gab uns trozig zur Antwort, wenn es einmal todt seye, koenne er nicht mehr helfen. Er bestrafte auch den Mathes keinesweges, sondern ließ ihn, wie andere frei herumgehen. Der Vater ist untröstlich, und jedem dauert das arme Maegdlein, requiescat in pace [= Möge es in Frieden ruhen !]“. Die Einfügungen in eckigen Klammern stammen von den Herausgebern, in runden Klammern von dem 1. Hg. Cosmann (1789). Die Bestrafung wurde in der Tat sehr unterschiedlich gehandhabt, vgl. etwa die Aufzeichnungen des Schmalkaldener Chronisten Pforr; WAGNER, Pforr, S. 141: „Den 22. 9br: [1636] sollte ein [schwedischer] cornet gerichtet werden, weil er eine magd genotzüchtiget. Weil aber sein knegt die magd geehligt, dem er 2 pferd geben und 20 thlr in die kirchen gebüst, ist ihme das leben geschenckt worden“. WAGNER, Pforr, S. 133: „Den 27. Jan: [12635; BW] hat [ist] ein corporal von Mersinisch[en; Mercy, BW] regiment vollerweiße ins siechenhauß kommen, die arme leuht darin ubell geschlagen und ein sichen magd genotzüchtigt. Deßwegen der cornet von hießiger compagnia hinaußgeschickt worden, den corporal dieser thatt wegen in arest zu nehmen. Weil sich aber der corporal zur wehr gestellet, hat ihn der cornet todtgeschoßen“. Vgl. auch THEIBAULT, Landfrauen, S. 32, über einen einzigen derartigen Fall in der Werra-Region. Auf Klagen bei Kommandierenden hieß es z. T.; HERRMANN, Aus tiefer Not, S. 122: „es sei aus unterschiedenen regimentern kommandiert volk und unter denselben Spanier, Neapolitaner, Burgunder, Italiener etc., die man nicht also in zaum halten könnte“. Vgl. die Vorgänge in Zerbst 1626; KRAUSE, Urkunden 1. Bd., S. 114: „daß auch ehrliebenden weibspersonen Unzucht, die abgenommenen sachen dardurch wieder Zu erlangen, Zugemuthet, vnd vnlengsten Bürgermeister Rühlen S. tochter, als sie in der schantze arbeiten müssen, von einem Soldaten mit gewalt geschändet, vndt ihrer ehren beraubet worden“.Vergewaltigung gehörte auch zur üblichen Topik in zeitgenössischen Berichten oder bei Geburt unehelicher Kindern; vgl. GROßNER; HALLER, Zu kurzem Bericht, S. 52. SCHÜTTE, Dreißigjähriger Krieg, S. 58, die Schwängerung der Elschen Stovener, Amt Ravensberg (1631), die trotz Eides den Verdacht nicht unbedingt ausräumt, dass der eigene Vater die Tochter geschwängert hatte: „Anno 1631, den 3ten Junij Johan Stovener mit seiner Tochter Elschen, so geschwengert, gefenglich angenommen, und obwoll im gemeinen geschrey, alß sollte der vatter dieselbe geschwengert haben, so hatt doch die Tochter eidtlich beteuret, das ein soldate, so einen blauwen rock angehabt, sie ubergeweltiget und sie also geschwengert. Weil dieselbige nun grob schwanger, alß ist sie biß dahin, der banden entbunden, erlaißen und hat Aloff Varenbruck und was er an gelde alhie im lande hatt (38, 5 Rtl. bei 6 Schuldnern), zu burgen gestellett, diesergestaldt, das, wan sie ihrer weiblichen burde entbunden, sich jeder zeit widder einstellen soll. Zeugen. Und ist g(enante)r Johan Stovener, eine urpheide zue thuen, aufferlagt, welche auch in gegenwart Jorgen Kraecks prestiert“. Bei der Nonne Maria Anna Junius aus Bamberg, HÜMMER, Bamberg, S. 222, heißt es ausdrücklich, dass sich die Schweden in der ganzen Zeit „züchtig und ehrerbittig“ verhalten hätten. Vgl. JANSSON, Soldaten und Vergewaltigung, S. 197; THEIBAULT, Landfrauen; BERG, Administering justice; die Beschwerden der Pommern’schen Gesandten (1630); THEATRUM EUROPAEUM Bd. 2, S. 190, CONRAD; TESKE, Sterbzeiten, S. 309f.; HERRMANN, Aus tiefer Not, S. 108ff. Der Schweriner Dompropst und Ratzeburger Domherr, Otto von Estorf [1566 – 29.7.1637], berichtet zu 1632 über die Rache von Frauen; DIARIUM BELLI BOHEMICI ET ALIARUM MEMORABILIUM 3, S. 22: „Im Dorff Kienblad [Kühnblatt; BW] im Stift Wirtzburgk, wie ein Kais. Soldat mitt eines bauern Tochter zue grob scherzen wollen, ist Er von ihr vnd andern Weibern vbermeistert, castriret vnd in ein Teich erseufft worden“. Zum Teil wird diese Gewalt gegen Frauen auch mit „schwechen“ umschrieben. Zum Teil scheint man Versuche nicht besonders ernst genommen zu haben. Aus Zwickau (1632) wird berichtet; WILHELM, Descriptio, S. 181: „Den 14. Wurde ein Soldat auffm Esel gesetzt / welches zuvorhin offt geschehen / das er einem WeibesVolck Vnehr angemutet vnd sie zwingen wollen / dem wurden Stöcke an die Füsse gelegt / so dem guten Bruder sehr vexiret / welches gewähret / biß nach Mittag vmb 3. Vhr / do gehet ein Soldaten Jung vorvber / deme befehlen andere alda stehende Soldaten / er sollte dem die Stöcke von Füssen thun / so er verrichtet / vnnd solche auff einen Holtzwagen / so gleich vorvbergegangen geworffen / Es ist aber derselbe folgende Nacht auff die leiter gebracht worden / vnnd gehencket werden sollen / darbey grose Ceremonien vorlieffen / in deme man den Commendanten vnterschiedlich zu geruffen / vñ vmb gnade geschrien / so eine gute halbe Stunde gewehret / allein es hatte endlich das ansehen / als wen es nur zur Pravada wehre angestellet gewesen“.
[179] Vgl. BROCKMANN, Dynastie.
[180] KUNATH, Kursachsen, S. 178ff.
[181] Leisnig [LK Mittelsachsen]; HHSD VIII, S. 197ff.
[182] Friedrich Unger [Ungar, Hungar], genannt „Masslechner“ [ – ], kursächsischer, dann kaiserlicher Obrist.
[183] Joachim v. Schleinitz [Schleuniz, Schweinitz] (der Jüngere) [ -21.7.1644], kursächsischer Obristleutnant, Obrist, Generaloberkriegskommissar.
[184] Georg Adam Freiherr v. Traudisch [Trauditz, Trautzsch, Trautschen, Trautischz, Trauntitsch, Truntitsch, Trautniz, Tausch] [ – nach 1653], kursächsischer, kaiserlicher Feldmarschallleutnant.
[185] KAMPRAD; FRANCKE, Leisnigker Chronica, S. 449f.
[186] Der in Folge der schwedischen Niederlage in der Schlacht bei Nördlingen (5./6.9.1634) vereinbarte Prager Frieden zwischen Johann Georg von Sachsen und Kaiser Ferdinand II. wurde am 30.5.1635 unterzeichnet. Bei diesem Friedensschluss, dem fast alle protestantischen Reichsstände beitraten, verzichtete der Kaiser auf seinen Anspruch, den Augsburger Religionsfrieden von 1555 allein zu interpretieren und damit das Restitutionsedikt von 1629 durchzuführen (vgl. s. v. „Religionsedikt“); Ergebnis war eine begrenzte Festschreibung des konfessionellen Status quo. Weitere Ergebnisse waren: die Festschreibung der Translation der pfälzischen Kurwürde auf Bayern, der Ansprüche Sachsens auf die Lausitz und die Bildung eines Reichsheers (wobei Johann Georg von Sachsen und Maximilian I. von Bayern eigene Korps führen ließen, die als Teil der Reichsarmee galten), die bestehenden Bündnisse waren aufzulösen, fremde Mächte sollten den Reichsboden verlassen, etwaige Ansprüche auf den Ersatz der Kriegskosten seit 1630 wurden aufgehoben, eine allgemeine Amnestie sollte in Kraft treten. Zudem kann der Prager Frieden als einer der letzten kaiserlichen Versuche betrachtet werden, ein monarchisches System im Reich durchzusetzen. Maßgebliches Mittel dazu war die so genannte Prager Heeresreform, mit der der Kaiser den Versuch unternahm, nahezu alle reichsständischen Truppen unter seinen Oberbefehl zu stellen und zugleich den Ständen die Finanzierung dieses Reichsheeres aufzuerlegen. Diese Vorstellungen ließen sich ebenso wenig verwirklichen wie das Ziel, durch die Vertreibung der ausländischen Mächte Frankreich und Schweden zu einem Frieden im Heiligen Römischen Reich zu gelangen. Zur Forschungslage vgl. KAISER, Prager Frieden.
[187] Vgl. Slg. 15: Autographensammlung des Königlichen Hausarchivs der Niederlande. Online verfügbar unter: sachsen-anhalt.de/fileadmin/Elementbibliothek/Bibliothek_LHA/FB/Slg_15_00_Findbuch.pdf.:General Moritz Adolf von Dehne an Fürst August von Anhalt-Plötzkau, Güstrow 1635 (Nr. 77).
[188] Vgl. KRUSENSTJERN, Selbstzeugnisse, S. 170f.
[189] Staßfurt [Salzlandkreis]; HHSD XI, S. 443ff.
[190] Barby [Salzlandkreis]; HHSD XI, S. 31ff.
[191] Aschersleben [Salzlandkreis]; HHSD XI, S. 23ff.
[192] Magdeburg; HHSD XI, S. 288ff.
[193] Wachtmeister [schwed. sergeant, dän. sergent]: Unteroffiziersdienstgrad. Der Wachtmeister war zuständig für die Sicherheit des Lagers und der Truppen sowie für die Einteilung, Aufstellung, Beaufsichtigung der Wachen und Ausgabe der Losung. Selbst ein Wachtmeister hatte noch 3 Knechte, 1 Jungen und 5 Pferde, manchmal sogar noch einen Narren als Begleitung; WAGNER; WÜNSCH, Notabilia, S. 110. Mit der Einrichtung stehender Heere wurde die Bezeichnung „Wachtmeister“ synonym für Feldwebel verwendet. Nach Wallensteins Verpflegungsordnung (1629) standen ihm 32 Rt. monatlich zu; KRAUSE, Urkunden 1. Bd., S. 460. Ein Wachtmeister der Reiterei erhielt in der brandenburgischen Armee monatlich 40 fl. Erpresst wurden in besetzten Städten z. T. 48 Rt.; HEIMATMUSEUM SCHWEDT, Die Uckermark, S. 15.
[194] Salvaguardia: Ursprünglich kaiserlicher Schutzbrief, durch den der Empfänger mit seiner Familie und seiner ganzen Habe in des Kaisers und des Reichs besonderen Schutz und Schirm genommen wurde; zur öffentlichen Bekräftigung dieses Schutzes wurde dem Empfänger das Recht verliehen, den kaiserlichen Adler und die Wappen der kaiserlichen Königreiche und Fürstentümer an seinen Besitzungen anzuschlagen. Der Schutzbrief bedrohte jeden Angreifer mit Ungnade und Strafe. Im 30jährigen Krieg militärische Schutzwache; Schutzbrief (Urkunde, die, indem sie geleistete Kontributionen und Sonderzahlungen bestätigte, gegen weitere Forderungen schützen sollte, ggf. durch militärische Gewalt des Ausstellers); auch: sicheres Geleit; eine oft recht wirkungslose Schutzwache durch abgestellte Soldaten, in schriftlicher oder gedruckter Form auch Salvaguardia-Brief genannt, die meist teuer erkauft werden musste, und ein einträgliches Geschäft für die zuständigen Kommandeure darstellten. Teilweise wurden entsprechende Tafeln an Ortseingängen aufgestellt, „Salvaguardia“ an die Türen der Kirchen (HERRMANN, Aus tiefer Not, S. 55) geschrieben oder für die ausländischen Söldner ein Galgen angemalt. Die 1626 von Tilly erlassene Schultheißen-Ordnung hatte festgelegt: „Wer salua Guardia mit wortten oder that violirt, den solle niemandt zu verthädigen understehen, sonder welcher hoch oder nider Officir ein dergleichen erfahren mag, der solle den muthwilligen verbrecher sobalden zu dem Provosen schaffen, dem Schultheysen neben einandtwortung bey sich unrecht befundenen sachen und guetter hiervon berichten ohn einred, die Restitution und was bey der sachen underlauffen möcht dass Gericht entscheiden lassen, und welcher einem andern sein gewonnen beuth abnimbt oder an seinem freyen verkauff nachtheilig verhindert, den solle Schultheyss zur Restitution anhalten und noch darzu mit straffen hart belegen“. ZIEGLER, Dokumente II, S. 986. Der Abt Veit Höser (1577 – 1634) von Oberaltaich bei Straubing; SIGL, Wallensteins Rache, S. 140f.: „Da die Schweden so grausam wüteten und sich wie eine Seuche immer weiter ausbreiteten, alle Dörfer mit Raub, Mord und Jammer heimsuchten, erbaten die Bürger ab und zu von den Kapitänen der Weimaraner eine Schutzwache, die bei ihnen meist Salva Guardia heißt. Erhielten sie diesen Schutz zugesagt, so wurde jeweils ein Musketierer zu Fuß oder zu Pferd in das betreffende Dorf, die Ortschaft, den Markt abgestellt. Dieser sollte die herumstreifenden Soldatenhorden, kraft eines vom Kapitän ausgehändigten schriftlichen Mandats, im Zaume halten, ihre Willkür beim Rauben und Plündern einschränken. […] Es ist aber nicht zu bestreiten, dass eine solche Schutzwache unseren Leuten oder den Bewohnern anderer Orte, denen auf ihre Anforderung eine Salva Guardia zugestanden wurde, keinen Vorteil brachte. Im Gegenteil, sie schlugen ihnen vielmehr zum Schaden aus und waren eine Belastung. Offensichtlichen Nutzen dagegen hatten nur die Kapitäne, denn ihnen mussten die Leute gleich anfangs die ausgehandelte Geldsumme vorlegen oder wenigstens wöchentlich die entsprechende Rate (pensio) entrichten. Kurz, wie Leibeigene oder Sklaven mussten sie blechen, was die Kapitäne verlangten. Ich habe nur einen Unterschied zwischen den Orten mit und denen ohne Salva Guardia festgestellt: Die Dörfer ohne Schutzgeleit wurden früher, jene mit einer Salva Guardia erst später ausgeplündert. Da nämlich die Schweden vom Plündern nicht ablassen konnten, solange sie nicht alles geraubt hatten, so raubten und plünderten sie entweder alles auf einmal (sodaß sie nicht mehr zurückkommen mußten) oder sie ließen allmählich und langsam bei ihren Raubzügen alles mitgehen, bis nichts mehr zu holen war. Obendrein haben diese eigentlich zum Schutze abkommandierten Musketiere und Dragoner gewöhnlich die Ortschaften, ihre Bewohner und deren Habseligkeiten – als Beschützer – ausspioniert und dann verraten. Wurde nämlich der bisherige Beschützer – und Spion – unvermutet abberufen, dann brachen seine Kameraden, Raubgesellen und Gaunerbrüder ein und raubten alles, was bislang durch den Schutz der Salva guardia verschont geblieben war, was sie in Wirklichkeit aber für sich selbst hinterlistig und heimtückisch aufbewahrt hatten, und wüteten um so verwegener (pro auso suo) gegen die jämmerlich betrogenen und enttäuschten Menschen, beraubten sie nicht menschlicher und marterten sie“. Auch war das Leben als Salvaguardist nicht ungefährlich. Der Ratsherr Dr. Plummern berichtet (1633); SEMLER, Tagebücher, S. 65: „Eodem alß die von Pfullendorff avisirt, daß ein schwedischer reütter bei ihnen sich befinnde, hatt vnser rittmaister Gintfeld fünf seiner reütter dahin geschickht sollen reütter abzuholen, welliche ihne biß nach Menßlißhausen gebracht, allda in dem wald spolirt vnd hernach zu todt geschoßen, auch den bauren daselbst befohlen in den wald zu vergraben, wie beschehen. Zu gleicher zeit haben ettlich andere gintfeldische reütter zu Langen-Enßlingen zwo schwedische salvaguardien aufgehebt vnd naher Veberlingen gebracht, deren einer auß Pommern gebürtig vnd adenlichen geschlächts sein sollen, dahero weiln rittmaister Gintfeld ein gůtte ranzion zu erheben verhofft, er bei leben gelassen wird“. BLÖTHNER, Apocalyptica, S. 49f. (1629): „Eine Eingabe des Bauern Jacob Löffler aus Langenwetzendorf [LK Greiz] wegen der bei ihm einquartierten »Schutzgarde« schildert die Heldentaten der derselben ungemein plastisch: »Was ich armer Mann wegen anhero zweijähriger hiesigen Einquartierung für groß Ungemach ausstehen müssen, gebe ich in Unterthänigkeit zu vernehmen: Denn erstlichen habe berührte Zeit über 42 ganze 42 Wochen Tag und Nacht bei den Soldaten ich aufwarten, nicht allein viel Mühe und Wege haben, sondern auch welches zum Erbarmen gewesen, Schläge gewärtig zu sein und geprügelt werden zu müssen, 2. habe ich meine geringe Haushaltung wegen jetziger Unsicherheit beiseits setzen, meine Felderlein wüst, öd und unbesamt liegen lassen, daß seither ich im geringsten nichts erbauen, davon samt den Meinigen ich mich hätte alimentieren mögen, 3. haben die Soldaten mir die Gerste, so zu einem Gebräulein Bier ich eingeschüttet, aus den Bottichen genommen, zum Teil mutwilligerweise zerstreut, zum Teil mit sich hinweggenommen, verfüttert und verkauft, 4. haben sie mir das wenige Getreidig, so noch unausgedroschen vorhanden gewesen, mit dem Geströhde aus der Scheune in andere Quartiere getragen, ausgeklopft und ihres Gefallens gebraucht, 5. weil sie an meiner geringen Person sich nicht allzeit rächen können, haben sie mir die Bienen und derselben Stöcke beraubet, umgestoßen und zu Grund und Tode gerichtet, 6. sind von ihnen mir alle Hühner, Gänse und ander Federvieh erschossen, genommen und gefressen worden, meine Wiesen, Raine und Jagen mir dermaßen verödet, daß ich nicht eine einzige Bürde Heu und Grummet von denselben genießen kann, 7. endlich ist von ihnen mir eine Kuh aus dem Stalle, so meinen Geschwistern zuständig gewesen, gezogen, in ein anderes Losament getrieben, geschlachtet und gefressen worden.« Teilweise „kauften“ sich begüterte Bürger Offiziere als Salvaguardia, um sich gegen Übergriffe zu schützen; SUTORIUS, Die Geschichte von Löwenburg. 1. Teil, S. 266. Teilweise wurde nur ein einzelner Salvaguardist einquartiert, teilweise aber ging die Zahl je nach Kriegs- und Ortslage erheblich in die Höhe. 1635 hielt Heinrich Graf Schlick 100 Mann zum Schutz seiner Herrschaft Plan für notwendig; SENFT, Geschichte, S. 124.
[195] des Regiments Joachim v. Molck [Molcke, Molk] [ – ], schwedischer Obrist.
[196] Kornett [schwed. kornett, dän. cornet]: Der Kornett führte die kleinste Einheit der Reiterei mit eigenen Feldzeichen, entsprach der Kompanie; 1 berittene Kompanie hatte in der kursächsischen Armee ca. 125 Pferde, 1 schwedische Reiterkompanie umfasste in der Regel 80 Mann. Der Kornett erhielt ca. 50 fl. Monatssold; z. T. wurden allerdings 240 Rt. (!) in besetzten Städten (1626) erpresst (HEIMATMUSEUM SCHWEDT, Die Uckermarck, S. 15). => Fähnrich; Fahne.
[197] Assignation: Anweisung (zur Einlagerung).
[198] Generalquartiermeister, „Oberstfeldquartiermeister“ [schwed. kvarter allmänna, dän. generalkvartermester]: Der Generalquartiermeister leitete das Quartieramt (mit zwei Oberquartiermeistern und dem Stabsquartiermeister sowie drei weiteren Offizieren), unterstützt von der Kriegskanzlei. Die Eingänge wurden dem Feldmarschall vorgetragen und die Antwortschreiben dementsprechend zur Billigung vorgelegt. Für technische Fragen wurden Ingenieure des Stabs herangezogen. Die mündliche Befehlsübermittlung oblag zwei bis vier Generaladjutanten. Das Quartieramt lieferte je nach Eingang Berichte an den Kaiser, den Hofkriegsrat, Weisungen an die Kommandeure der Feldarmeen, an die örtlichen Kommandeure und Festungskommandeure, an alle zuständigen Verwaltungsbehörden und gab Lageberichte an hohe abwesende Generäle und Nachrichten an die Gesandten des Westfälischen Friedenskongresses heraus. Nach der „Ordnung Wie es mit der verpflegung der Soldaten“ (1630) erhielt er 400 fl. monatlich, bei den Dänen dagegen 500 Rt.; OPEL, Der niedersächsisch-dänische Krieg 2. Bd., S. 171. Der Generalquartiermeister hatte als Dienstvorgesetzter alle Quartiermeister der einzelnen Regimenter unter sich, sein Amt war eine sehr lukrative Einnahmequelle wegen der „Verehrungen“, um Einquartierungen (gerade bei den Winterquartieren) abzuwenden oder zu erleichtern. Zudem war er meist auch Inhaber eines eigenen Regiments, das die besten Quartiere zu erwarten hatte.
[199] WINTER, Möser’s Aufzeichnungen, S. 66f. – N Fernow [ – ], kursächsischer Generalquartiermeister.
[200] Güsten [Salzlandkreis].
[201] Leibkompanie: Mit Leibkompanie oder Obrist-Kompanie wurde im 17. und 18. Jahrhundert die erste Kompanie eines Regiments bezeichnet. Der Obrist und Inhaber des Regiments war gleichzeitig Inhaber der Leibkompanie, was ihm durch die Kompaniewirtschaft zusätzliche Einnahmen verschaffte. Das gleiche galt für die Kompanie (Oberstleutnants-Kompanie), deren Inhaber sein Stellvertreter (Obristleutnant) war, später auch für die Kompanie eines Majors (Majors-Kompanie). Diese Kompanien wurden aber tatsächlich geführt von einem Kapitänleutnant oder StabsKapitän, die im Rang unter einem Hauptmann standen, der gleichzeitig Inhaber einer Kompanie war [wikipedia].
[202] Bernhardt v. Werdensleben [ – ], Bürger in Staßfurt.
[203] Erhard Legat [ – ], Bürger in Staßfurt.
[204] Regimentsquartiermeister [schwed. Regementskvartermästare]: Der Regimentsquartiermeister war der Dienstvorgesetzte aller Quartiermeister des Regiments, ein einträgliches Amt, da ihm viele „Verehrungen“ zukamen, um die Einquartierungen abzuwenden. Ein Quartiermeister erhielt in der kaiserlichen Armee 40 fl. [nach der „Ordnung Wie es mit der verpflegung der Soldaten“ (1630)], in der brandenburgischen Armee im Monat 50 fl. Nach Wallensteins Verpflegungsordnung (1629) standen ihm bei der infanterie 40 Rt. monatlich zu; KRAUSE, Urkunden 1. Bd., S. 460. Regimentsquartiermeister führten in der Regel auch eine eigene Kompanie, was ihnen Sondereinnahmen verschaffte.
[205] Fourier, Fouragier, Fourageur: Der Fourier übte eine ähnliche Aufgabe wie der Quartiermeister aus, indem er vor allem die Verpflegung der Truppe und die Beschaffung von Viehfutter in den besetzten Gebieten sicherstellen sollte. Geschickte Fouriere konnten gerade in ausgezehrten Landstrichen wichtig für das Überleben der Einheiten werden. Nach Wallensteins Verpflegungsordnung (1629) standen ihm 24 Rt. monatlich zu; KRAUSE, Urkunden 1. Bd., S. 460. Die herbei geschafften Nahrungsmittel stammten zum größten Teil aus Plünderungen. Daneben leisteten die z. T. weit herum kommenden Fouriere auch Kundschafterdienste.
[206] Kapitänleutnant [schwed. kaptenslöjtnant, dän. Kaptajnløjtnant]: Der Kapitänleutnant war der Stellvertreter des Kapitäns. Der Rang entsprach dem Hauptmann der kaiserlichen Armee. Hauptmann war der vom Obristen eingesetzte Oberbefehlshaber eines Fähnleins der Infanterie. (Nach der Umbenennung des Fähnleins in Kompanie wurde er als Kapitän bezeichnet.) Der Hauptmann war verantwortlich für Werbung und Soldzahlung, für Disziplin, Ausrüstung und Verpflegung sowie für die Ernennung der untergebenen Führer. Oft war er in erster Linie für die materielle Versorgung der Truppe zuständig und die eigentlichen militärischen Aufgaben wurden von seinem Stellvertreter, dem Kapitänleutnant übernommen. Der Hauptmann marschierte an der Spitze des Fähnleins, im Zug abwechselnd an der Spitze bzw. am Ende. Bei Eilmärschen hatte er zusammen mit einem Leutnant am Ende zu marschieren, um die Soldaten nachzutreiben und auch Desertionen zu verhindern. Er kontrollierte auch die Feldscher und die Feldapotheke. Er besaß Rechenschafts- und Meldepflicht gegenüber dem Obristen, dem Obristleutnant und dem Major. Dem Hauptmann der Infanterie entsprach der Rittmeister der Kavallerie. Junge Adlige traten oft als Hauptleute in die Armee ein.
[207] tribulieren: quälen, plagen, bedrücken, schikanieren. => Tribuliersoldat: zwangseinquartierter Soldat, der die Aufgabe hatte, mittels übermäßigem Essen und Trinken, Einstellen von Pferden, Diebstähle und Verdrängung der Hausinsassen aus ihren Stuben die eingeforderten Kontributionen, „Verehrungen“ aus den Bewohnern besonders in den andersgläubigen Städten und Dörfern herauszupressen.
[208] Rekompens: ständig eingeforderter Ausgleich, eine Entschädigung und Belohnung für geleistete oder noch zu leistende Dienste [z. T. aus noch zu konfiszierenden Gütern; HALLWICH. Wallenstein’s Ende 1. Bd., Nr. 759, S. 628.
[209] entbrechen: befreien, abtun, entledigen, entgehen.
[210] Hunger: Hungerkrisen traten durch Missernten, Wettereinflüsse, Truppendurchzüge, Einquartierungen, Erntezerstörungen, Pferde- und Viehdiebstahl immer wieder auf. Oftmals blieb nur die Flucht ins Heer oder der Anschluss an den Tross. So hatten sich 2.000 hungernde Eichsfelder Pappenheims Soldaten angeschlossen. Ein Berittener oder Knecht in der Musterung hatte immerhin noch zwei Pfd. Fleisch, drei Pfd. Brot, eine Maß Wein und drei Maß Bier pro Tag zu fordern – drei bis fünf Maß Bier je nach Geschlecht pro Tag galten auch sonst als üblich – , was zur raschen Auszehrung einer Landschaft führte, zumal die eingeforderten Naturalabgaben im Laufe der Zeit noch weiter anstiegen und von Jahr zu Jahr neue Verpflegungssätze erfordern. Vom Verpflegungsansatz her war dies eine gewaltige Kalorienmenge, entsprachen doch drei Pfd. (gutes) Brot allein bereits etwa 3.750 kcal. Rechnet man noch über 2.000 kcal für das Fleisch hinzu, ohne Bier und Wein, so wird eine Kalorienzahl zwischen 6.000-7.000 kcal erreicht, was dem Zweieinhalb- bis Dreifachen eines durchschnittlichen Tagesbedarfs entsprochen hätte. Das war wohl Anfang des 17. Jahrhunderts nur Privilegierten vorbehalten, während die Gemeinen nur unzureichend verpflegt wurden. HIPPEL, Bevölkerung, S. 422, schätzt den täglichen Nahrungsbedarf in Württemberg auf knapp 2.400 kcal pro Tag. Vgl. BEHRENDS, Chronik, S. 145f. (1636): „Man gab den Armen von jedem Backvorgang ein Brot, […] welches damals als Krieg, Pest und Hunger hieselbst gar übel hauseten, von armen Leuten nicht für eine geringe Gabe gehalten ward, sintemal man damals oft weder Brot noch Bier und Geld haben konnte, und viele, meistenteils aber die Soldaten Hunde und Katzen, Pferde- und Menschenfleisch fraßen und nicht einmal bekommen konnten“. 1641 heißt es über die Prignitz: „So sind auch alle Dörfer so gar verwüstet, verödet, universaliter et particulariter in Brand gesteckt, die Untertanen Hungers und des milites immanitet [Unmenschlichkeit, Rohheit] halber gestorben und ins Elend [Ausland] verlaufen, dass man in dem ganzen Kreise nach angestellter fleißiger Inquisition bloß 373 Bauersleute, die doch etliche gar wenig ausgenommen, weder Hunde noch Katzen, weniger etliche Lebensmittel haben, besonderen sich vom Obste und wohl ganz unnatürlichen Speisen aufhalten müssen, gefunden worden“. HERRMANN, Ländliche Bevölkerung, S. 86. Der Bieberauer Pfarrer Minck (1635); KUNZ; LIZALEK, Südhessische Chroniken, S. 261: „Durch diesen Hunger verschmachteten viele Leut dermaßen, daß nichts als Haut und Bein an ihnen war, die Haut hing ihnen am Leib wie ein Sack, waren ganz schwarz-gelb, mit weiten Augen, gepläcketen Zähnen, grindicht, krätzig, gelbsichtig, dick geschwollen, febricht [= fiebrig], daß einem grauete, sie anzusehen“. ZILLHARDT, Dreißigjähriger Krieg, S. 161f. (1635): „Dan auß diser teürung und hungersnot ist entstanden noch ein jamer uber alle jamer, nemlich ein sterbet und pestelentz, das vüll taußendt menschen sind zu grundt gangen durch hunger, krieg und pestelenz. Dan durch den hunger ist von denen armen menschen vüll greüwlich und abscheüliches dings auffgefressen worden. Alls nemlich allerley ungereimbten dings: hundt und katzen, meüß und abgangen vüch, roßfleisch, das der schinder und meister uff dem vassen sein fleisch von dem abgangne vüch, als roß, hundt und andere thier, ist hingenomen worden, und haben dannoch einander drumb gerißen und für köstlich gut gehalten. Es ist auch für gut gehalten worden allerley kraut uff dem feld: die distel, die nesle, schersich, hanefüeß, schmerbel, schertele. In suma allerley kraut ist gut gewessen, dan der hunger ist ein guter koch, wie man im sprichwort sagt“. Vgl. auch die Lebensbeschreibung des Gottfried Andreae (1637); DOLLINGER, Schwarzbuch, S. 321: „Doch im Jahr 1637 stieg das Elend auf’s höchste, nachdem kaum 200 Bauern in der untern Pfalz mehr übrig waren, da die übrigen teils an Hunger und Pest bereits gestorben, teils von den Kaiserlichen erwürgt oder als Soldaten weggeschleppt worden waren … Der Hunger aber zwang die Leute zu den unnatürlichsten Nahrungsmitteln: Gras, Kräuter, dürre und grüne Baumblätter, Felle von Tieren; Hunde, Katzen, Ratzen, Mäuse, Frösche und faulendes Aas waren gesuchte Bissen. Die Hungernden erschlugen einander selbst, verzehrten sie, durchwühlten Gottesäcker, erstiegen Galgen und Rad und nahmen die Toten zur Speise weg“. Notiz aus dem Pfarrbuch von Mauern (LK Neuburg/Donau) für 1648: „Viele haben aus Hunger Roßmist gegessen, der Feind hat alles fort; es ist nichts angebaut worden. Viele sind Hungers gestorben, die Überlebenden nähren sich von Wurzeln und Baumblättern und sind froh um die Häute der gefallenen Pferde“. [frdl. Mitteilung von Herrn Fahmüller, Pfeffenhausen]. Der Kitzinger Pfarrer Bartholomäus Dietwar [1592-1670] über 1649; DIETWAR, Chronik, S. 91: „Etliche tausend bayerische Bauern bettelten mit Weib und Kind durchs Land. Darunter waren auch Mörder. Sie stahlen und raubten was sie konnten. Das war Gottes sichtbare Strafe dafür, dass der Kurfürst von Bayern im 30jährigen Kriege viele Tausend armer Leute gemacht hatte. Darum war sein Land im vorigen Jahre durch die Schweden und Franzosen wieder verdorben worden, also dass seine Leute von München und Landshut her das Frankenland durchliefen, das gebettelte Brot dörrten und heim nach Bayern trugen“. Aus Nördlingen wird anlässlich der Belagerung 1634 berichtet; KESSLER, Belagerung, S. 38: „Um diese Zeit sind die Rosse wegen Mangels an Futter so erkrankt und so matt geworden, daß sie häufig einfach hingefallen und verendet sind. Von dem S. H. Schinder Jörg Schmid sind hinter dem Feilturm 2 große Gruben gegraben und die Pferde darin verscharrt worden. Die Armen und Bettelleute aber haben sich auch dabei befunden und haben, wenn man die Pferde hat vergraben wollen, aus großem Hunger ziemlich große Stücke davon herausgeschnitten, das Selbige gekocht und von solchem ihren Hunger gestillt, und gebüßt. Die armen Leute sind zur Nacht, um 12 Uhr, über solches Aas gekommen und haben es davon getragen“. KESSLER, Belagerung, S. 63: „Die kaiserlichen, spanischen, welschen, französischen und deutschen Soldaten sind gleichsam aus dem ausgebrannten Turm herundergefallen und jämmerlich aufeinander gelegen. Die armen Tagelöhner haben die gebratenen Schulterblätter von den Achseln abgenommen und für gutes Schweinefleisch gefressen“. Auch Regimenter wie das des kurkölnischen Obristen Hugo v. Tyrell[i] lösten sich wegen Hunger auf. Der Salemer Mönch Bürster (1644); WEECH, Sebastian Bürsters Beschreibung, S. 196: „Dan ehe muoß der burger sterben zehen mal, ehe der soldat verderben ainmahl“. HÄVECKER, Chronica und Beschreibung, S. 96 (Calbe 1642): „Uber dieses ist dieser Ort auch mit Theurung und Hungersnoth nicht verschonet geblieben. Denn Ao. 1642. hat ein Scheffel Rocken 3. Thl. und mehr gegolten / und man das Getreyde allhier nicht einmal darum erlangen können / sondern es hat dasselbe von andern Orten müssen geholet werden; Die nun kein Geld gehabt / es so theur zu bezahlen / haben sich mit geschroteten Bohnen / Erbsen- und Gersten-Brod behelffen müssen / so aber auch beynöthig gewesen. Dahero viel arme Leute statt des Korns / mit Knoten-Kafft / Wurtzeln aus der Erden sich sättigen / und das Kraut auf dem Felde kochen und essen müssen. Und weil eben in derselben Zeit die Engel- und Schottländer in der Stadt gelegen / sind derer viel wegen Mangel des Brods gestorben / und haben einige den Hunger mit Pferdefleisch zu stillen gesuchet / und das Fleisch des verreckten Viehes gegessen“. Der Zeitzeuge Hanns Kahn aus Klings/Rhön; LEHMANN, Leben und Sterben, S. 172 (1638): „Das Getreide wurde [von den Soldaten] weggeführt. Kein Bauer hatte mehhr Lust zu säen. Keiner hatte mehr Lust zu arbeiten, weil er es doch nicht genießen konnte. Es kam nur das Nötigste in die Erde, und dieses hatten die Soldaten gestohlen. Es kam eine böse Hungersnot. Viele sind gestorben. Die schwedischen Reiter und die Kroaten mussten sich mit kleinem Brot begnügen. Unser Brot gestand damals aus gemahlenen Eicheln, Wicken und wenigem Korn. Die solches hatten, konnten froh sein. Manch reicher Mann ist aus Hunger gestorben […] Man sieht oft, dass es Menschen in der Not an jeder Erklärung mangelt. Mit gesottenem Gras und Aasfleisch glaubten viele, dem Hunger zu entgehen und starben erst recht an den abscheulichen Sachen, die sie verschlangen“. Vgl. auch die zeitgenössische Darstellung von VINCE, Lamentations, S. 35ff. Z. T. sollen sich die verhungernden Soldaten regelrecht zu Tod gefressen haben; PASTORIUS, Kurtze Beschreibung, S. 117 (1634): „Den 26. Decembris zogen die Soissischen Soldaten hinaus / und kamen dargegen 3. Compagnien Schwaben herein von dem Freybergischen Regiment / die hatten meistenteils alle Weiber und 5. biß 6 Kinder / alle sehr verhungert / die frassen alles aus / was sie bekommen kunten / mit solcher Begierde und in solcher Mäng / daß etlichen der Wanst zersprang. Zween Soldaten hatten 35. Glös und 3. Spital Laiblein Brods uff einen Sitz gessen / hatte der eine noch ½ Glos im Munde / da er starbe“. Der Chronist Georg Friedrich Dhein berichtet über die Zustände in der Festung Hanau (1636); KURZ, Das Leben, S. 132: „Und da unter denen Scharmützel von Freund und Feind ein wohl gehaltenes Pferd erlegt wurde, gingen viele des armen Volks hinaus, rissen sich um das Aas, brachten von dem stinkenden Fleisch so viel als möglich war zu ihrem Unterhalt herein, wie denn auch sonsten Pferde-, Esel- und Hundefleisch gekochet wurde auf dem Markt verkaufet. Katzen estimirte man vor Wildbret und etliche allzu Fleisch begierige Leut handelten dem Scharfrichter gedörrtes Schindfleisch ab zu ihrer Speis“. Als Ersatz nahm man auch Gras oder Kräuter, „da viele hundert Menschen schwere Krankheit, Lähmung, Scharbock und die Mundfaulung bekamen, auch etliche Menschen sind auf der Gassen verschmachtet und niedergefallen, auf welches vielfältige Elend so mancher sehr zu Herzen genommen, sehr viele public und privat Almosen gereichet worden, wiwohl dem Elend nicht zu steuern gewesen“. BLÖTHNER, Apocalyptica, S. 118f.: „Anno 1638 ist wieder eine Theuerung nach dem vorigen Krieg und der Pest erfolget, so daß ein Leipziger Scheffel [103, 83 Liter; BW] um 10 G[ulden; BW]. Verkauft worden. Dahero weil die Armen es nicht bezahlen, auch vor den Thüren nichts mehr kriegen kunten, so wurden vor großem Hunger Hunde und Katzen geschlachtet, ja das Aas von dem Schindanger [=> Schindanger; BW] geholet und gefressen, und wollte wenig zureichen, deßwegen viel Leute verhungert und in den Misthaufen gestorben, so vorhin auf dem Lande schöne Güter gehabt; daselbst viel arm Volck sich von hier nach dem Altenburgischen gewendet, woselbst sie auch erhalten worden; Es haben sich auch einige gutthätige Hertzen gefunden, die den Armen wöchendlich ein oder zweymahl zu gewissen Tagen Brod haben mitgetheilet, worunter der Herr Superintendent D. Leyser, Herr Archediakonus M. Rinckard, Herr Bürgermeister Müller wie auch andere wohlhabende Bürger sich mit befunden haben, dass iedweder einen oder zwei Scheffel [1 Scheffel = 112, 15 Liter, BW] kauffte und das hiervon gebackene Brod unter die Armen austheilete, so wollte es doch nicht zulangen, denn die Menge war zu groß, weil offt vor einem solchen Hausse 4, 5, 6 bis 800 Menschen an Männern, Weibern und Kindern gestanden, welche einander sehr gedrenget, darunter viel Leute vom Lande, so vor dem Kriege nicht vor 800 oder 1000 Gulden, ja wohl nicht vor 2000 Gulden gegeben hätten. Wenn nun die Leute ein bißgen Brod erhalten, haben sie es nicht flugs gegessen, sondern nur daran gerochen und haben Gelegenheit gesuchet, ob sie einen Hund oder eine Katze damit fangen können. Wenn sie denn einen Hund bekommen, haben sie denselben an einem Strick bey sich geführet, denen wohl 20 oder 30 arme Leute beyher gefolget, gleichsam als wenn sie mit dem Hunde zu Grabe gehen wollten. Wenn sie nun vor die Stadt auf den Graben kommen sind, da haben sie geschlachtet und gebraten, was sie bekommen, da ist auf dem Graben um die Stadt herumb ein klein Feuer nach dem anderen gewesen, darbey die armen Leute gekocht und an hölzernen Spießen gebraten, was sie nur bekommen. Denn wenn der Cavaller [Abdecker, BW] mit dem Karn ein Aas hinausgeführet, ist das arme Volck häuffig nachgelauffen, und haben ein Stück nach dem anderen davon abgeschnitten. Oder wenn eine Kuh verworfen und das Kalb gleich unzeitig gewesen, haben sie es doch geholet, gekocht, gebraten und alles gegessen. Ja es war das arme Volck so abgemattet und verhungert, daß sie gingen, als wie die Schämen (!) [Schemen; BW] war Gottes Strafe so groß, daß sie gleichsam nicht kunten wegkommen oder an andere Oerter lauffen, sondern lieber hier verhungerten, da es doch, wie obgedacht, im Altenburgischen und an anderen Orten nicht so teuer, auch noch eher Brod vors Geld oder vor den Türen zu bekommen war, als hier. Sonderlich aber wenn der Abend herbey kahm, da hätte es oftmals einen Stein erbarmen mögen, wie das arme Volck winselte und die Nacht über in den Misthauffen schrie und bath. Eins rufte hier, das andere dort, tausendmahl um Gottes-Willen umb ein bißgen Brod, oder nur um ein Krümelgen; ein anders etwa umb ein Trünklein Wasser oder Kosent [Kofent = Dünnbier; BW] und dergeleichen, daß man froh war, wenn es wieder Tag wurde; denn das Elend und große Geschrey kunte man ohne hefftige Gemüths-Bewegung nicht ansehen oder anhören“. Hunger führte u. a. zu Kannibalismus; vgl. „Gründtlicher vnnd warhaffter Bericht / vnnd Erzehlung Der Vorhin vnerhörten Thaten vnd abscheulichen Exempel“ (1638), ohne Seitenangabe: „Herman Seidel / ein frommer Mann / von Offenburg / welcher zu Lichtenau eine Schwester / die Ihm sehr lieb gewesen / vnd derhalben seinen Sohn zu hir geschicket / mit ein wenig nahrung / dieser Knabe kömmet vngehindert fort / alß er nach Lichtenaw kömbt / vnd niemand findet / auch schon im widerkehren ist nach hause zugehen / kömmet er ohn gefehr bey ein Fischerhäußlin / da ers rauchen sihet / vnd wie denn die Jugend vorwitzig / lauffet er hinzu / vnd wird eines Weibes gewar / die beim heerde sitzt / vnd kochet / vnd beynebens schrecklich heulet und weinet / neben dem heerde hencket ein Kind an einem stecken / welcher durch beyde Waden gangen / vnd dz Kind den kopff vnter sich gehangen / ist auffgeschnitten vnd geschlachtet / dieser Knabe lauffet mit angst vnd furcht vmbgeben / biß er nach Offenburg kombt / sagts seinem Vater / dieser zeigts der Obrigkeit an / vnd muß dieser Knabe mit einer ziemlich starcken Guarnison dahin / welchs also befunden / vnd das Weib gleich auch essend vnd weinend finden / haben aber vom Kinde noch funden die 2. Vntertheil / den lincken Arm / vnd Kopff / das andere hat sie schon verzehret gehabt: vñ ist diß Weib / nebenst dem Kinde auff Offenburg genommen worden: alß man sie aber gefraget: wie sie solchen Mord vnd Todschlag gleichwol vbers Hertze bringen können ? hat sie darauff geantwortet / sie hette es nicht gethan / sondern der grausame Hunger / dessen quall vnmenschlich were /das vbrige wolte sie der Obrigkeit befehlen zu verantworten. Hat aber nur 16. Tage nach diesem gelebet“.
[211] Kirchenraub: Kirchenraub galt als eines der abscheulichsten Verbrechen, in den Kriegsartikeln zumindest mit der Todesstrafe bedroht, und wurde nach Art. 172 der „Constitutio Criminalis Carolina“ generell mit dem Tode durch Verbrennung bei lebendigem Leibe bestraft, im Militärstrafrecht mit dem Tod durch den Strang. Mithin war die Bezeichnung „Kirchenräuber“, mit der die kaiserlich-kursächsischen Soldaten bei HAPPE apostrophiert werden, nach dem „Schelm“ eines der schlimmsten Schimpfworte. Mit Befriedigung stellte z. B. der Stassfurter Pfarrer Möser fest, wie Banér Kirchenraub bestrafen ließ; WINTER, Möser, S. 50. Theatrum Europæum Band 3, S. 616f.: „Unter diesen Crabaten und Polacken ward eine scharpffe Kriegs-Disciplin und gute Ordnung halten / wie dann drey ihrer Soldaten / welche in einem Dorff auß einer Kirchen etwas gestohlen / und darüber ergriffen worden / eine harte Straff haben außstehen müssen / in deme sie alle drey an Pfählen angebunden / und lebendig im Feuer verbrandt worden“. Der Erzgebirgschronist Lehmann über schwedische Truppen (1640); LEHMANN, Kriegschronik, S. 117: „Darbei haben Sie keiner Kirchen geschonet, alle Sacristeyen zerhauen, die Altare gestümmelt, die Orgeln zerrißen, den Ornat, Leich- und Altartücher, kelche weggenommen. Den do ist alles Preiß gewesen, kirchen, kirchengeräthe, Gottesäcker, Epitaphia, Crucifixe, die Sie verstümmelt und verbrandt; in ezlichen kirchen ist die strew von Pferden ellenhoch gelegen. In kirchen haben Sie die verborgenen löcher gefunden, drin die alten die Pepstlichen Kirchengeräthe, Monstrantzen, becken, weihkeßel vermauret hatten, und darvon kein einwohner gewust, und mitgenommen, Die Libreyen der Priester geraubet und aufgeladen“. MORGENSTERN, Chronik von Olbernhau, S. 39f.: Pfarrer Pistorius schreibt unter dem 15.1. 1646 über die Plünderung durch Schweden: „Sonntag post circumcisionis Christi festum, d. 4. Jan. umb 10 Uhr vormittag sein ettliche 60 furagierende Pferde u. Knecht in die Pfarr Albernhayn plötzlich eingefallen, in die 56 Scheffel Haber eingesackt, gänss, Hüner undt Endten, von allerlei victualien, Butter, Käse, Bettgeräde und weisse Wäsche, kleider und was sie nur auf Pferde und schlitten aufladen können, weggenommen. Andre in die kirch gebrochen, die Sacristei eröffnet und darinnen sehr viel Sachen, dess Pfarrers kleider, victualien, ettlich fässlein Butter u. viel leinwand hinweggenomben : und biss gegen 3 uhr Abend geplündert, worauf umb 4 Uhr ein andre Parthy wieder in die Pfarr komben, meel und korn eingesacket und gegen die Saigerhütte damit verrucket, also dieses ersten einfalls Schaden sich über die 130 thaler belaufet. Folgender Tage von 6., 7. biss 15. Januar sein zu 200 biss in die 500 Pferde, Mussquetierer und viel räuberische rotten stetig in Dorf Albernhayn logiret, die kirchen, sacrarium, und Heiligthumb sacrilegistice (d. h. tempelräuberisch) beraubet, welches zuvor von ihnen als Feinden nicht beschehen: zwei kostbare Missgewandt, eines von gold gewirkt und gestickt auf die 90 thaler werth, das andre, ein rot Sammets, beide mit sehr schönen von Seid und gold gestückten Crucifix Bildern, und dieses auf 60 thaler werth, neben zwei übergüldenen kelch und Patenen (Hostienteller), ein grosen und kleinen, in den einen gienge 2 seitel, in den andern 1 seitel, was sie werth sein, kann jetzo nit gesagt werden. Was mitt zerbrochen und durchgraben am altar und kirchengebeut, item am Pfarrhauss vor Schaden geschehen, wird ehist kläglich besehen werden: Ohne was dem Pfarrer, alles was er gehabt, verwahret, vergraben zu hauss, in der kirch, an allen Orten und enden, am ettlichen geld, an kleidern, Betten, garn, leinwand, an getrait und gänzlicher nahrung, an seiner Bibliotheca vor schaden geschehen, denn alles kleines und grosses weggenomben und panolethrice (alles zerstörend) verderbet worden ist: weil er blos und übelbekleidet kaum ihren Händen entkomben, alles, alles hinterlassen und den Barbarischen Scythen und Mohametischen Räubern und Unmenschen, recht höllischen, meineidigten bestien zur beut und beraubung all sein Hauss und haab umb rettung des lebens dargeben müssen und von diesen Freibeutern dermassen beschädigt und verderbet ist, als nicht zu schreiben, als nit zu glauben, als nicht wohl mag der schaden geschätzet werden und derselbe über die 200 thaler (ohn das getrait, Pienstöcke und kleinen vieh) sich belaufet. Gott der gerechte, dem wir allein und nicht diesen Türkischen Heiden gesündiget, der wird solches richten und rechnen undmitt zeitlicher und ewiger Bestrafung diese unchristen verdamben und verwerfen“. SCHMIDT, Chronica Cygnea, S. 541 (Zwickau 1633): „Ein anderer [Kaiserlicher; BW] hatte ein grün Taffendes Meßgewandt gestolen / und ihm etliche Sachen / unter andern ein paar Kniebänder daraus machen lassen / dem bekam sein Kirchen-Raub übel. Denn im hinaus ziehen ist er gefallen / und ist ihm ein Wagen über die Beine gangen / der hat ihm beyde Beine / eben an dem Ort / wo die KnieBänder herumb gebunden / zerknirscht / und ihn sonst so übel zugericht / daß er in grossen Schmertzen sterben müssen“.
[212] Dam [Thame, Tam, Damm] Vitzthum [Vitzdum, Vizthum] v. Eckstädt [10.9.1595-21.3.1638], kursächsischer Generalmajor.
[213] Dietrich Freiherr v. Taube [Daube] zu Neukirchen [1594 Maardu [Estland]-29.1.1639 Dresden], kursächsischer Obrist.
[214] Musterung: Der militärische Unternehmer richtete einen Platz, meist in der Nähe einer Stadt, in deren Wirtshäusern oder in Landstrichen ein, die wegen ihrer wirtschaftlichen Krisensituation als besonders geeignet galten, ein, an dem sich die von Werbern mit einem Handgeld geworbenen Söldner oder Rekruten einfanden. Wenn sie gemustert und für tauglich befunden wurden, wurden sie durch den Musterschreiber in Musterrollen eingeschrieben und an ihren Bestimmungsort verbracht. Auf dem ersten Blatt der Musterrolle, der „Prima plana“, waren die wichtigsten Ämter bis hin zu den Unteroffizieren aufgeführt. Die Heeresunternehmer hatten ein Werbepatent, das sie zur Stellung einer festgelegten Anzahl von Soldaten verpflichtete. Konnte die Anzahl nicht erreicht werden, mussten die Werbegelder vom Kriegsunternehmer aus eigener Tasche zurückgezahlt werden. Im Laufe des Krieges wurden so viele Neuanwerbungen notwendig, dass die Werbung trotz steigender Werbegelder immer schwieriger wurde, so dass sich erzwungene Werbungen häuften. Vgl. auch BURSCHEL, Söldner, S. 126f.; LANGER, Hortus, S. 92f. Nürnberg soll sogar im Sommer 1625 100.000 fl. geboten haben, um keinen Musterplatz gewähren zu müssen; KOLLMANN, Der Dänisch-Niederdeutsche Krieg, Nr. 58. Zum Teil erfolgte die Musterung sogar, wenn noch nicht alle Waffen vorhanden waren; GRÄF, Söldnerleben, S. 110; SEMLER, Tagebuch, S. 115 (1633Vgl. die selbstkritischen Äußerungen des schottischen Söldners Sir James Turner [1615-1686; vgl. MURDOCH, SSNE ID: 63], Memoirs, S. 14: „I had swallowed without chewing, in Germanie, a very dangerous maximie, which militarie men there too much follow; which was, that so we serve our master honnestlie, it is no matter what master we serve; so, without examination of the justice of the quarrel, or regard of my dutie to either prince or countrey, I resolved to goe with that ship I first rencounterd”. Teilweise wurden sogar ungemusterte Soldaten als Besatzungstruppen eingesetzt. Vgl. MANKELL, Arkiv, S. 229 (1631 in Arnswalde). HELLER, Rothenburg, S. 308: „In den Musterplätzen wurden die im Auftrag der Regimentsinhaber auf den Werbeplätzen angeworbenen Mannschaften durch einen Kommissar des Kriegsherren […] gemustert: Es wurde der Personalstand aufgenommen, d. h. Stammrollen (damals Musterrollen genannt) angelegt, Waffen, Pferde, Ausrüstung auf Kriegsbrauchbarkeit nachgesehen und die Mannschaft vereidigt. Die Muster- und vor allem die Werbeplätze bildeten eine schwere Landplage und Fürsten und Städte scheuten keine Kosten, ihr Gebiet davon freizuhalten. Wo die Werbetrommel ertönte (umgeschlagen) wurde), strömte das landfahrende Gesindel zugleich mit den nicht viel besseren Gartbrüdern (abgedankte Soldaten, die sich vom Garten, d. h. Betteln im Herumziehen, nährten) zusammen und hielt auch nach Annahme des Werbegeldes nicht die geringste Spur von Kriegszucht; erst mit dem Schwur unterwarfen sie sich dem Kriegsrecht. – Auf eigene Faust verübten die Neugeworbenen Bedrückungen und Erpressungen schwerster Art, legten sich beim Bürger und beim Bauern ein und waren nur durch Geld und reichliche Wegzehrung zum Weiterziehen zu bewegen – allen Vorschriften zum Trotz, die ein Einlagern der zum Musterplatz marschierenden Neugeworbenen nur für eine Nacht erlaubten“.
[215] Korporalschaft: Zug einer Kompanie, die von einem Korporal geführt wurde. Der Korporal war der unterste Rang der Unteroffiziere, der einen Zug als Teil der Kompanie führte. Er erhielt in der kaiserlichen Armee (1630) 12 fl. Sold monatlich. Das entsprach immerhin dem Jahreslohn eines Ochsenknechtes. DESING, Historia auxilia 2. Bd., S. 186: „Corporal ist ein Unter-Officier, der viel zu thun hat: Darumb seynd bey einer Compagnie zwey, drey oder vier. Für seine 15. Mann, welche man eine Rott nennt, empfängt er vom Capitain d’Armes das Gewehr, vom Fourier das Quartier, vom Muster-Schreiber das Geld, vom Sergeanten die Ordre, gehört nit zur Prima plana“.
[216] Kornett: die kleinste Einheit der Reiterei mit eigenen Feldzeichen, entsprach der Kompanie; 1 berittene Kompanie hatte in der kursächsischen Armee ca. 125 Pferde, 1 schwedische Reiterkompanie umfasste in der Regel 80 Mann. Der Kornett erhielt ca. 50 fl. Monatssold; nach Wallensteins Verpflegungsordnung (1629) standen ihm bei der Infanterie 60 Rt. monatlich zu; KRAUSE, Urkunden 1. Bd., S. 460; z. T. wurden allerdings 240 Rt. (!) in besetzten Städten (1626) erpresst (HEIMATMUSEUM SCHWEDT, Die Uckermarck, S. 15). => Fähnrich; Fahne.
[217] WINTER, Möser’s Aufzeichnungen, S. 66ff.
[218] Wolf Heinrich v. Baudissin [1579 (1597 ?) Schloss Lupa-4.7.1646 Elbing (Belschwitz)], schwedischer, dann kursächsischer Generalleutnant. Vgl. http://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=19088.
[219] Gnadenkette: Halsketten, die fürstliche Personen vor dem Aufkommen der Verdienstorden an verdiente Militärs, Höflinge, Beamte etc. oder auch bloß als Zeichen ihrer Huld zu verleihen pflegten; solche Ketten waren öfters mit Münzen oder Medaillen mit dem Bildnis des Spenders, Emblemen, Sprüchen etc. verziert.
[220] HELWIG, Theatrum Historiae Vniuersalis, S. 368.
[221] Ferdinand Sigmund [Sigismund] Freiherr (Reichsgraf) Kurz [Kurtz] v. Senftenau [1592 München-24.3.1659 Wien], Geheimer Rat u. Kämmerer, Reichsvizekanzler (seit 1637).
[222] Altmark: Die Altmark ist eine Region im Norden des Landes Sachsen-Anhalt. Die historische Kulturlandschaft erstreckt sich vom Drawehn im Westen bis an die Elbe im Osten, grenzt südlich an die Magdeburger Börde und nördlich an das Wendland. Der Name Altmark erscheint erstmals 1304 – Antiqua Marchia (Alte Mark) – und bezieht sich auf ihre Bedeutung als westelbisches Ausgangsgebiet bei der Einrichtung der Mark Brandenburg. Darauf beziehen sich auch blumige Charakterisierungen als „Wiege Brandenburgs“ oder gar „Wiege Preußens“. Als Ganzes gehörte sie seit der Gründung der Mark Brandenburg zu dieser Markgrafschaft und dem daraus hervorgegangenen preußischen Staat. Die Altmark wird heute in den Altmarkkreis Salzwedel und den Landkreis Stendal untergliedert. Erst seit der Landkreis Stendal auch östlich der Elbe gelegene Gebiete umfasst, werden diese, historisch zu Jerichower Land und Prignitz gehörend, gelegentlich mit zur Altmark gezählt [nach Wikipedia].
[223] KUNATH, Kursachsen, S. 200.
[224] Camill [Kamil, Grant Moros, Johann] Rudolf [Rudolfo Giovanni] Freiherr (1632) auf Hohenelbe, Eglitz und Platten, Graf (1636) v. Morzin [Marazin, Marazini, Marrazino, Marzin, Marotzin, Morazin] [um 1585-1646 Prag], kaiserlicher Feldmarschall.
[225] Johan Banér [Bannier, Panier, Panner] [23.6./3.7.1596 Djursholm-20.5.1641 Halberstadt], schwedischer Feldmarschall. Vgl. BJÖRLIN, Johan Baner.
[226] Parchim [LK Ludwigslust-Parchim]; HHSD XII, S. 77f.
[227] Havelberg [LK Stendal]; HHSD X, S. 217ff.
[228] Kyritz [LK Ostprignitz/Ruppin].
[229] Neuruppin [LK Ostprignitz/Ruppin].
[230] KUNATH, Kursachsen, S. 203.
[231] Jerichow [LK Jerichower Land]; HHSD XI, S. 228ff.
[232] Rathenow [LK Havelland]; HHSD X, S. 333f.
[233] Musketier [schwed. musketerare, musketör, dän. musketeer]: Fußsoldat, der die Muskete führte. Die Muskete war die klassische Feuerwaffe der Infanterie. Sie war ein Gewehr mit Luntenschloss, bei dem das Zündkraut auf der Pulverpfanne durch den Abzugsbügel und den Abzugshahn mit der eingesetzten Lunte entzündet wurde. Die Muskete hatte eine Schussweite bis zu 250 m. Wegen ihres Gewichts (7-10 kg) stützte man die Muskete auf Gabeln und legte sie mit dem Kolben an die Schulter. Nach einem Schuss wichen die Musketiere in den Haufen der Pikeniere zurück, um nachladen zu können. Nach 1630 wurden die Waffen leichter (ca. 5 kg) und die Musketiere zu einer höheren Feuergeschwindigkeit gedrillt; die Schussfolge betrug dann 1 bis 2 Schuss pro Minute (vgl. BUßMANN; SCHILLING, 1648, 1. Bd., S. 89). Die zielfähige Schussweite betrug ca. 300 Meter, auf 100 Meter soll die Kugel die damals übliche Panzerung durchschlagen haben. Die Treffsicherheit soll bei 75 Metern Entfernung noch 50 % betragen haben. Die Aufhaltewirkung war im Nahbereich sehr hoch, die Getroffenen sollen sich förmlich überschlagen haben. Je nach Entfernung sollen jedoch im Normalfall nur 5-7% aller abgegebenen Schüsse eine Wirkung im Ziel gehabt haben. Vgl. WALLHAUSEN, Kriegskunst zu Fuß. Zudem rissen sie auf etwa 10 Meter Entfernung etwa dreimal so große Wundhöhlen wie moderne Infanteriegeschosse. Ausführlich beschrieben wird deren Handhabung bei ENGERISSER, Von Kronach nach Nördlingen, S. 544ff. Eine einfache Muskete kostete etwa 2 – 3 ¼ Gulden, die qualitativ besseren Suhler Waffen das Doppelte, so dass seine Ausrüstung nicht so kostenintensiv war. Die Muskete löste das Handrohr ab. Die ab 1630 im thüringischen Suhl gefertigte schwedische Muskete war etwa 140 cm lang bei einer Lauflänge von 102 cm und wog etwa 4,5 – 4,7 kg bei einem Kaliber von zumeist 19,7 mm. Sie konnte bereits ohne Stützgabel geschossen werden, wenngleich man diese noch länger zum Lade- und Zielvorgang benutzte. Die Zerstörung Suhls durch Isolanos Kroaten am 16./26.10.1634 geschah wohl auch in der Absicht, die Produktionsstätten und Lieferbetriebe dem Bedarf der schwedischen Armee endgültig zu entziehen. BRNARDÍC, Imperial Armies I. Für den Nahkampf trug er ein Seitengewehr – Kurzsäbel oder Degen – und schlug mit dem Kolben seiner Muskete zu. In aller Regel kämpfte er jedoch als Schütze aus der Ferne. Deshalb trug er keine Panzerung, schon ein leichter Helm war selten. Eine einfache Muskete kostete etwa 3 ¼ Gulden, die qualitativ besseren Suhler Waffen das Doppelte, so dass seine Ausrüstung nicht so kostenintensiv war. Im Notfall wurden die Musketiere auch als Dragoner verwendet, die aber zum Kampf absaßen. MAHR, Monro, S. 15: „Der Musketier schoß mit der Luntenschloßmuskete, die wegen ihres Gewichtes [etwa 5 kg] auf eine Gewehrgabel gelegt werden mußte. Die Waffe wurde im Stehen geladen, indem man den Inhalt der am Bandelier hängenden hölzernen Pulverkapseln, der sog. Apostel, in den Lauf schüttete und dann das Geschoß mit dem Ladestock hineinstieß. Verschossen wurden Bleikugeln, sog. Rollkugeln, die einen geringeren Durchmesser als das Kaliber des Laufes hatten, damit man sie auch bei Verschmutzung des Laufes durch die Rückstände der Pulvergase noch einführen und mit Stoff oder Papier verdämmen konnte. Da die Treffgenauigkeit dieser Musketen mit glattem Lauf auf die übliche Kampfentfernung von maximal 150 Metern unter 20 Prozent lag, wurde Salvenschießen bevorzugt. Die Verbände waren dabei in sog. Treffen aufgestellt. Dies waren Linien zu drei Gliedern, wobei das zweite Treffen etwa 50 Schritt, das dritte 100 Schritt hinter der Bataille, d. h. der Schlachtlinie des ersten Treffens, zu stehen kamen, so daß sie diese bei Bedarf rasch verstärken konnten. Gefeuert wurde gliedweise mit zeitlichem Abstand, damit für die einzelnen Glieder Zeit zum Laden bestand. Ein gut geübter Musketier konnte in drei Minuten zwei Schuß abgeben. Die Bleigeschosse bis zu 2 cm Kaliber [vgl. auch GROTHE, Auf die Kugeln geschaut, S. 386, hier 16, 8-19,5 mm] verformten sich beim Aufprall auf den Körper leicht, und es entstanden schwere Fleischwunden. In den Kämpfen leisteten Feldscherer erste Hilfe; doch insgesamt blieb die medizinische Versorgung der Verwundeten mangelhaft. Selbst Streifschüsse führten oft aufgrund der Infektion mit Tetanus zum Tode, erst recht dann schwere Verletzungen“. Der Hildesheimer Arzt und Chronist Dr. Jordan berichtet 1634, dass sich unter den Gefallenen eines Scharmützels auch ein weiblicher Musketier in Männerkleidern gefunden habe; SCHLOTTER, Acta, S. 194. Der Bad Windheimer Chronist Pastorius hält unter 1631 fest; PASTORIUS, Kurtze Beschreibung, S. 100: „1631. Den 10. May eroberte der General Tylli die Stadt Magdeburg / plünderte sie aus / eine Jungfrau hatte ihres Bruders Kleider angezogen / und sich in ein groß leeres Weinfaß verstecket / ward endlich von einem Reuter gefunden / der dingte sie für einen Knecht / deme sie auch drey Monat treulich die Pferde wartete / und als in einem Treffen der Reuter umkam / und sie von denen Schweden gefangen gen Erffurt kam / ließ sie sich für einen Musquetirer unterhalten / dienete fünff Jahr redlich / hatte in etlichen Duellen mit dem Degen obsieget / wurde endlich durch eine Müllerin / wo sie im Quartier lag / verrathen / daß sie ein Weib wäre / da erzehlete sie der Commendantin allen Verlauff / die name sie zu einer Dienerin / kleidete sie / und schenckte ihr 100. Ducaten zum Heyrath-Guthe“. Weiter gibt es den Fall der Clara Oefelein, die schriftliche Aufzeichnungen über ihren Kriegsdienst hinterlassen haben soll. Allerdings heißt es schon bei Stanislaus Hohenspach (1577), zit. bei BAUMANN, Landsknechte, S. 77: „Gemeiniglich hat man 300 Mann unter dem Fenlein, ist 60 Glied alleda stellt man welsche Marketender, Huren und Buben in Landsknechtskleyder ein, muß alles gut seyn, gilt jedes ein Mann, wann schon das Ding, so in den Latz gehörig, zerspalten ist, gibet es doch einen Landsknecht“. Bei Bedarf wurden selbst Kinder schon als Musketiere eingesetzt (1632); so der Benediktiner-Abt Gaisser; STEMMLER, Tagebuch 1. Bd., S. 181f.; WALLHAUSEN, Kriegskunst zu Fuß, S. 43ff., über die Bedienung; BRNARDÍC, Imperial Armies I, S. 33ff.; Vgl. KEITH, Pike and Shot Tactics; EICKHOFF; SCHOPPER, 1636, S. 59ff.
[234] Fehrbellin [LK Ostprignitz-Ruppin]; HHSD X, S. 172.
[235] Garlitz, heute Ortsteil von Märkisch Luch [LK Havelland].
[236] Leibregiment: Als Leibregiment wurde im 17. Jahrhundert im Heiligen Römischen Reich, in Dänemark und in Schweden diejenigen Regimenter bezeichnet, deren Inhaber der regierende Landesherr war. Ihm standen zudem die sich daraus im Rahmen der Regiments- bzw. Kompaniewirtschaft ergebenden Einnahmen zu. Ein Leibregiment hatte daher eine grundsätzlich andere Funktion als die Leibkompanie eines Obristen. Zudem waren in der Regel die Ausstattung und Verpflegung besser als in anderen Regimentern bzw. wurden von den Neugeworbenen eingefordert.
[237] Erik Klarson Slang [Slange, Schlange, Schlang, Schleng, Schläge] [1600-2.11.1642 Breitenfeld], schwedischer Generalmajor.
[238] Bötzow, heute Ortsteil von Oberkrämer [LK Oberhavel].
[239] SCHRÖER, Havelland, S. 79f.; Brandenburg [Stadtkr.]; HHSD X, S. 135ff.
[240] WINTER, Möser’s Aufzeichnungen, S. 68. So auch GEIß, Chronik, S. 100.
[241] Moritz Albrecht v. Dehn-Rothfelser [22.12.1603-7.12.1635 in der Schlacht bei Kieseritz], kursächsischer Obristwachtmeister. Diese Verwechslung findet sich dann folgerichtig bei GEISS, Chronik der Stadt Staßfurt, S. 100.
[242] Johan [Hans] Freiherr v. Wachtmeister [1609-1652 Lübeck], schwedischer Generalmajor, Reichsrat.
[243] Contenance: Zurückhaltung, Selbstbeherrschung.
[244] Werben (Elbe) [LK Stendal].
[245] Generalleutnant: Der Generalleutnant vertrat den General bzw. Feldherrn und war in der kaiserlichen, kurbayerischen, dänischen und schwedischen Armee der höchste Befehlshaber und Stellvertreter des Kaisers und des Königs/der Königin, mit weitgehenden politischen und militärischen Vollmachten. Über ihm stand nur noch der „Generalissimus“ mit absoluter Vollmacht. Als Rekompens erhielt er für seine Leistungen Landzuweisungen (zumeist aus eroberten Gebieten oder den sogenannten „Rebellengütern“) sowie die Erhebung etwa in den Grafen- oder Herzogsstand. Als Stellvertreter seines Dienstherrn führte er Verhandlungen mit den Ständen, erzwang die Depossedierung von Adligen und Absetzung von Territorialherrn in den besetzten Gebieten und lenkte durch seine Abgesandten auch Friedensverhandlungen. Wichtige Träger der gesamten Organisation des Kriegswesens waren dabei die Generalkriegskommissare und die Obristen, die in der Regel nach ihm oder nach seinen Vorschlägen bestallt wurden.
[246] Patrick [Patricius, Peter, Padruig, Patkell] Ruthven [Ruthwen, Rutwen, Ruthuen, Rudtwein, Redwen, Reddewin, Retwin, Rittwein, Rudven, Rödwijn, Rödven, Rödwen, Rutwein, Rüttwein, „Rotwein“] of Forth and Brentfort [ca. 1572 Ballindean-24.1.1652 in oder bei Buxtehude], schwedischer Feldmarschall.
[247] Generalmajor [schwed. generalmajor, dän. generalmajor]: Der Generalmajor nahm die Aufgaben eines Generalwachtmeisters in der kaiserlichen oder bayerischen Armee war. Er stand rangmäßig bei den Schweden zwischen dem Obristen und dem General der Kavallerie, bei den Kaiserlichen zwischen dem Obristen und dem Feldmarschallleutnant.
[248] Axel [Achsel] Graf Lille [Lillie, Lilie, Lielie, Axellilly, Lilli] v. Löfstad [23.7.1603-20.12.1662], schwedischer Generalmajor.
[249] Artillerie: Zur Wirksamkeit der Artillerie vgl. ENGLUND, Verwüstung Deutschlands, S. 424f.: „Sowohl bei sogenannten Kernschüssen als auch bei Visierschüssen zielte man mit dem Geschützrohr in mehr oder weniger waagrechter Position. Ein in dieser Position eingestellter Neunpfünder hatte eine Reichweite von etwas über 350 Metern. Dann schlug die Kugel zum erstenmal auf dem Boden auf, wonach sie regelmäßig einen Sprung machte und noch einmal 350 bis 360 Meter flog, bevor sie kraftlos erneut aufprallte – acht von zehn Kugeln sprangen mindestens dreimal auf. (Der Abprall hing davon ab, ob der Boden eben oder buckelig und uneben war.) Die Kugel flog die ganze Zeit in Mannshöhe. Sie konnte also auf ihrer gesamten Bahn töten und verwunden, und wenn sie im rechten Winkel durch eine dünne Linie von Männern schlug, pflegte sie im Durchschnitt drei Mann zu töten und vier oder fünf zu verwunden, aber es kam auch vor, daß eine einzige Kugel 40 Menschen auf einen Schlag tötete. Menschen und Tiere wurden meistens mit einem hohen und entsetzlichen Reißgeräusch zerfetzt. Es gibt Beschreibungen von Schlachten dieses Typs – wie es aussah, wenn brummende Vollkugeln in die von Pulverdampf eingehüllten und dicht gestaffelten Reihen aufrecht stehender Männer einschlugen: In der Luft über den Verbänden sah man dann eine kleine Kaskade von Waffenteilen, Rucksäcken, Kleidern, abgerissenen Köpfen, Händen, Beinen und schwer identifizierbaren menschlichen Körperteilen. Der tatsächliche Effekt beruhte in hohem Grade auf der Größe der Kugel. Leichte wie schwere Geschütze schossen im großen und ganzen ihre Kugeln mit der gleichen Anfangsgeschwindigkeit ab, etwas unter 500 Meter in der Sekunde, doch je größer die Kugel war – das Kaliber in Pfund bezeichnet das Kugelgewicht – , desto höhere Geschwindigkeit und Durchschlagskraft hatte sie, wenn sie ihr Ziel erreichte: die Beine und Muskeln und Zähne und Augäpfel eines Menschen auf der anderen Seite des Feldes“. Der technische Aufwand war beträchtlich bei 60-Pfündern rechnete man für 8 Tage à 30 Schuss 3 Ztr. Pulver, 13 Wagen mit 99 Pferden, dazu 3 Knechte u. 2 Büchsenmeister sowie deren Zubehör. „Vom Nürnberger Stückegießer Leonhard Loewe ist die Rechnung für die Herstellung zweier jeweils 75 Zentner schwerer Belagerungsgeschütze erhalten, die auf den heutigen Wert hochgerechnet werden kann. An Material- und Lohnkosten verlangte Loewe 2.643 Gulden, das sind ca. 105.000 bis 132.000 Euro. Das Material und der Feuerwerker-Lohn für den Abschuss einer einzigen 24-pfündigen Eisenkugel aus den „Halben Kartaunen“ kostete fünf Reichstaler – mehr als die monatliche Besoldung eines Fußsoldaten“. EICKHOFF; SCHOPPER, 1636, S. 81.
[250] Adam v. Pfuel [Pfull, Pfuhls, Phuell, Pfuell, Pfuhl] [1604-5.2.1659 Helfta], schwedischer Generalleutnant.
[251] Herman Wrangel [29.6.1587 Estland-11.12.1643 Riga], schwedischer Feldmarschall. Vgl. auch die Erwähnungen bei BACKHAUS, Brev 1-2.
[252] Bagage: Gepäck; Tross. „Bagage“ war die Bezeichnung für den Gepäcktrain des Heeres, mit dem die Soldaten wie Offiziere neben dem Hausrat auch ihre gesamte Beute abtransportierten, so dass die Bagage während oder nach der Schlacht gern vom Feind oder von der eigenen Mannschaft geplündert wurde. Auch war man deshalb darauf aus, dass in den Bedingungen bei der freiwilligen Übergabe einer Stadt oder Festung die gesamte Bagage ungehindert abziehen durfte. Manchmal wurde „Bagage“ jedoch auch abwertend für den Tross überhaupt verwendet, die Begleitmannschaft des Heeres oder Heeresteils, die allerdings keinen Anspruch auf Verpflegungsrationen hatte; etwa 1, 5 mal (im Anfang des Krieges) bis 3-4mal (am Ende des Krieges) so stark wie die kämpfende Truppe: Soldatenfrauen, Kinder, Prostituierte 1.-4. Klasse („Mätresse“, „Concubine“, „Metze“, „Hure“), Trossjungen, Gefangene, zum Dienst bei der Artillerie verurteilte Straftäter, Feldprediger, Zigeuner als Kundschafter und Heilkundige, Feldchirurg, Feldscherer, Handwerker, Sudelköche, Krämer, Marketender, -innen, Juden als Marketender, Soldatenwitwen, invalide Soldaten, mitlaufende Zivilisten aus den Hungergebieten, ehemalige Studenten, Bauern und Bauernknechte („Wintersoldaten“), die während der schlechten Jahreszeit zum Heer gingen, im Frühjahr aber wieder entliefen, Glücksspieler, vor der Strafverfolgung durch Behörden Davongelaufene, Kriegswaisen etc. KROENER, „ … und ist der jammer nit zu beschreiben“; LANGER, Hortus, S. 96ff.
[253] Wispel: 1 Wispel = 24 Scheffel = 1348, 224 Liter (Mark Brandenburg).
[254] Thomas Banck [ – ], schwedischer Obrist.
[255] Wittenberg [LK Wittenberg]; HHSD XI, S. 504ff.
[256] Naumburg (Saale) [Burgenlandkreis].
[257] Dorf Zechlin [LK Ostprignitz- Ruppin].
[258] Burg [LK Jerichower Land].
[259] Augustin v. Hanau [10.8.1591-24.8.1661 Gamig], kursächsischer, kaiserlicher Obrist u. Generalwachtmeister.
[260] Johann Georg Freiherr Strein [Streun, Streiner] v. Schwarzenau [Štrejnové ze Švarcenavy] u. Ungarschitz [1600-1663], kursächsischer u. kurbrandenburgischer Obrist.
[261] Möckern [LK Jerichower Land].
[262] Wanzleben, heute Ortsteil von Wanzleben-Börde [LK Börde]; HHSD XI, S. 481ff.
[263] Joachim v. Mitzlaff [Metzlaff, Meitzlaff, Mizlau] [ -nach 1655], schwedischer Obrist, Generalkriegskommissar, dann kaiserlicher Obrist.
[264] Calbe/Saale [Salzlandkreis]; HHSD XI, S. 65ff. Vgl. HERTEL, Geschichte der Stadt Calbe.
[265] Bernburg [Salzlandkr.]; HHSD XI, S. 37ff.
[266] Lüder v. Stralendorf [Stralendorff, Strallendorff] [ – ], schwedischer Obrist.
[267] Georg Wilhelm v. Lohausen [Lohaussen, Lochhaussen] [ -16.5.1644], schwedischer Obrist.
[268] Sir Johann [Hans] Baronet Drake [Dracke] v. Asch af Hagelsrum [ -1653], schwedischer Obrist.
[269] Stendal [LK Stendal]; HHSD XI, S. 447ff.
[270] Adam v. Pfuel [Pfull, Pfuhls, Phuell, Pfuell, Pfuhl] [1604-5.2.1659 Helfta], schwedischer Generalleutnant.
[271] Haldensleben [LK Börde]; HHSD XI, S. 174ff.
[272] Johann v. der Brink [Brinck, Princk, Brinken, Brincken] [ – ], schwedischer Obrist.
[273] Baltzar Nyman [Nieman, Neumann] [ – ], schwedischer Obristleutnant, Obrist.
[274] Halberstadt [LK Harz]; HHSD XI, S. 169ff.
[275] Gorleben [LK Lüchow-Dannenberg].
[276] Untersteckung, Unterstoßung, „Unterstellung“, „Unterhaltung“: (zwangsweise) Eingliederung von (insbesondere gefangen genommenen) Soldaten in bestehende unvollständige Verbände. „Die ‚Untersteckung‘ von gefangenen Soldaten des Kriegsgegners war in der frühen Neuzeit allgemein üblich, wurde für gewöhnlich von den Betroffenen ohne Widerstände akzeptiert und scheint gar nicht selten die Zusammensetzung eines Heeres erheblich verändert zu haben“ (BURSCHEL, Söldner, S. 158). Die „Relation deren Geschichten / Ritterlichen Thaten und Kriegßhandlung“, S. 12, berichtet, wie Bucquoy mansfeldische Söldner zur Unterstellung zwang: „Dann als mann sie (in der Zahl ohngefehr 1200.) gen Crumaw bracht / hat man sie Rotten vnd Hauffen weiß in Kammern so eng zusammen gesperrt / daß sie weder sitzen noch niderligen können / auch neben dem wenig Essen / das man ihn vorgestellt / ihnen gar nichts zu tricken geben / vnd es also etliche Tag vber / mit inen getrieben / Sie dardurch zu nötigen / daß sie dem Keyser ihre Dienst versprechen müsten / als auch geschehen. Dann nach dem sie auffs eusserst allerhand Ungemach außgestanden / vnnd etliche Tag kein tropffen zu trincken vberkommen / haben sie fast alle vnder solchem erschröcklichen Joch vnd Zwang sich schmücken vnd biegen / vnd dem Feind ihre Dienst zusagen müssen“. In der kurbayerischen Armee – Maximilian I. von Bayern war grundsätzlich gegen die Untersteckung wegen der Unzuverlässigkeit in Schlachten – wurden sie als Kugelfang beim Angriff oder Sturm auf eine Stadt vorausgeschickt; SEMLER, Sebastian Bürsters Beschreibung, S. 67. Franz von Mercy hatte nach seinem Sieg bei Tuttlingen (24.11.1643) an die 2000 Franzosen untergesteckt. HEILMANN, Kriegsgeschichte, S. 69f. Doch wurden schon seit dem Böhmischen Krieg Gefangene, die die Untersteckung verweigerten, oft hingerichtet. HELLER, Rothenburg, S. 158: (1645): „Die [bayr.] Furir aber haben alle Häußer, wo Franz. oder Weimar. gelegen, außgesucht und was sie hinterlaßen, alles weggenommen. Wie sie denn im güldenen Greifen einen Weimarischen Feldscherer sampt seiner Feldtruhen, welcher allhie geblieben und hernach wollen nach Hauß ziehen in Holstein, ertapt, übel gemartert und geschlagen, endlich mit sich hinweggefürt und, wie man gesagt, weilen er ihnen nit wollen dienen, auf dem Feld erschoßen“. MAHR, Monro, S. S. 157, bei der Einnahme der Schanze bei Oppenheim: „Als unsere anderen Leute sahen, daß das Schloß gefallen war, rannten sie los, die vorgelagerte Schanze zu erstürmen, in der sich neun Kompanien Italiener mit ihren Fahnen befanden. Ihre Offiziere sahen nun, daß das Schloß hinter ihnen überrumpelt war und daß der Angriff vor ihnen losbrach, da warfen sie ihre Waffen weg und riefen nach Quartier, die ihnen auch gewährt wurde. Ihre Fahnen wurden ihnen abgenommen. Da sie alle bereit waren, in unsere Dienste zu treten, wurden sie vom König Sir John Hepburn zugewiesen, der nicht nur ihr Oberst wurde, sondern auch ein guter Schutzherr, der sie in guten Quartieren unterbrachte, bis sie neu eingekleidet und bewaffnet waren. Aber sie zeigten sich undankbar und blieben nicht, sondern liefen in Bayern alle davon. Nachdem sie einmal die warme Sommerluft verspürt hatten, waren sie vor dem nächsten Winter alle verschwunden“. Teilweise beschaffte man über sie Informationen; SEMLER, Tagebücher, S. 70f. (1633): „Wie beschehen vnd seyn nahendt bei der statt [Überlingen; BW] vier schwedische reütter, so auf dem straiff geweßt, von vnsern tragonern betretten [angetroffen; BW], zwen darvon alsbald nidergemacht, zwen aber, so vmb quartier gebeten, gefangen in die statt herein gebracht worden. Deren der eine seines angebens Christian Schultheß von Friedland [S. 57] auß dem hertzogthumb Mechelburg gebürtig vnder der kayßerlichen armada siben jahr gedient vnd diesen sommer zu Newmarckht gefangen vnd vndergestoßen [am 30.6.1633; BW] worden: der ander aber von Saltzburg, vnderm obrist König geritten vnd zu Aichen [Aichach; BW] in Bayern vom feind gefangen vnd zum dienen genötiget worden. Vnd sagte der erste bei hoher betheurung vnd verpfändung leib vnd lebens, dass die schwedische vmb Pfullendorff ankomne vnd noch erwartende armada 24 regimenter starck, vnd werde alternis diebus von dem Horn vnd hertzogen Bernhard commandirt; führen 4 halb carthaunen mit sich vnd ettlich klainere veld stückhlin. Der ander vermainte, daß die armada 10.000 pferdt vnd 6.000 zu fůß starckh vnd der so geschwinde aufbruch von Tonawerd [Donauwörth; BW] in diese land beschehen seye, weiln man vernommen, daß die kayserische 8000 starckh in Würtemberg eingefallen“. => Kriegsgefangene.
[277] CHEMNITZ, Königl. Schwedischen ]…] Kriegs, 4. Buch, 6. Kap., S. 950f.
[278] Bernau [LK Barnim]; HHSD X, S. 125f.
[279] Templin [LK Uckermark]; HHSD X, S. 375f.
[280] Magdeburg; HHSD XI, S. 288ff.
[281] Mansleben: nicht identifiziert.
[282] Barby [Salzlandkreis]; HHSD XI, S. 31ff.
[283] Bernburg [Salzlandkreis]; HHSD XI, S. 37ff.
[284] Stralsund [LK Vorpommern-Rügen]; HHSD XII, S. 292ff.
[285] Axel Gustafsson Oxenstierna Greve af Södermore [16.6.1583 Fanö bei Uppsala-28.1.1654 Stockholm], schwedischer Reichskanzler. Vgl. WETTERBERG, Axel Oxenstierna; FINDEISEN, Axel Oxenstierna; BACKHAUS (Hg.), Brev 1-2.
[286] Leipzig; HHSD VIII, S. 178ff.
[287] Moritzburg: „Mit dem Frieden von Prag (1635) erkannte der Kaiser den Herzog August von Sachsen-Weißenfels als neuen Erzbischof an. Während einer erneuten Belagerung durch die Schweden brach am 6. Januar 1637 ein Feuer in der Burg aus. Die gesamten oberen Stockwerke der West- und Nordseite sowie die Kapelle wurden zerstört. Die Besatzung kapitulierte daraufhin. Am 19. März 1639 sprengten sächsische Truppen die Südwest-Bastion mit einer am Fundament angebrachten Mine um die jetzt schwedische Besatzung zur Aufgabe zu zwingen, was drei Tage später dann auch geschah. August, der Sohn des sächsischen Kurfürsten wurde daraufhin als Erzbischof eingesetzt. Er setzte bei seinem Vater Johann Georg von Sachsen durch, dass die sächsischen Truppen die Festung räumten, um der Burg ihre strategische Anziehungskraft zu nehmen. Ein Neutralitätsvertrag zwischen August und den Schweden hielt den weiteren Krieg von Halle ab“ [wikipedia].
[288] Halle a. d. Saale; HHSD XI, S. 177ff.
[289] Johann Fabian v. Ponickau [1584-1641], kursächsischer Obristleutnant.
[290] Naumburg [Burgenlandkreis]; HHSD XI, S. 341ff.
[291] Merseburg [Saalekreis]; HHSD XI, S. 322ff.
[292] Weißenfels [Burgenlandkreis]; HHSD XI, S. 487ff. Vgl. REICHEL, Weißenfels.
[293] KUNATH, Kursachsen, S. 204f.
[294] Schönermark, heute Ortsteil von Mark Landin [LK Uckermark].
[295] Angermünde [LK Uckermark]; HHSD X, S. 6f.
[296] Joachim v. Schleinitz [Schleuniz, Schweinitz] (der Jüngere) [ -21.7.1644], kursächsischer Obristleutnant, Obrist, Generaloberkriegskommissar.
[297] ENDERS, Die Uckermark, S. 315f.
[298] Wolf Heinrich v. Baudissin [1579 (1597 ?) Schloss Lupa-4.7.1646 Elbing (Belschwitz)], schwedischer, dann kursächsischer Generalleutnant. Vgl. http://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=19088.
[299] Gnadenkette: Halsketten, die fürstliche Personen vor dem Aufkommen der Verdienstorden an verdiente Militärs, Höflinge, Beamte etc. oder auch bloß als Zeichen ihrer Huld zu verleihen pflegten; solche Ketten waren öfters mit Münzen oder Medaillen mit dem Bildnis des Spenders, Emblemen, Sprüchen etc. verziert.
[300] HELWIG, Theatrum Historiae Vniuersalis, S. 368.
[301] Perleberg [Kr. Westprignitz/Perleberg]; HHSD X, S. 308ff.
[302] Perleberg [LK Stendal]; HHSD X, S. 308ff.
[303] KUNATH, Kursachsen, S. 214f.
[304] Naumburg [Burgenlandkreis]; HHSD XI, S. 341ff.
[305] Torsten Stålhandske [Stolhanscha, Stahlhandschuh, Stahlhanndtschuch, Stalhans, Stallhans, Stalhansch, Stallhuschl, Stalhanß, Stall-Hanß, Stallhaus, Stallhausen, Stolhanski, Starrhase, Lo Stallo, Lo Stallans, Statehornes] [1594 Porvoo/Borgå (Finnland)-21.4./1.5.1644 Haderslev/Nordschleswig], schwedischer Generalmajor. Vgl. http://www.kansallisbiografia.fi/english/?id=2342.
[306] Eilenburg [LK Nordsachsen]; HHSD XI, S. 100ff.
[307] KUNATH, Kursachsen, S. 216.
[308] Lüchow [LK Lüchow-Dannenberg]; HHSD II, S. 306f.
[309] Johann Graf v. Sporck [Sporgk, Spurgk, Spork, Sperckh] [um 1601 Westerloh-6.8.1679 Heřmanův Městec], kurbayerischer, kaiserlicher Feldmarschallleutnant.
[310] Lüneburg [LK Lüneburg]; HHSD II, S. 311ff.
[311] Johann Graf v. Götz [Götzen, Götze] [1599 Zehlendorf-6.3.1645 bei Jankau gefallen], kaiserlicher Feldmarschall. Vgl. ANGERER, Aus dem Leben des Feldmarschalls Johann Graf von Götz.
[312] Georg Herzog v. Braunschweig-Lüneburg [17.2.1582 Celle-2.4.1641 Hildesheim], kaiserlicher Obrist, 1631 schwedischer General. Vgl. DECKEN, Herzog Georg.
[313] Friedrich IV. Herzog v. Braunschweig-Lüneburg-Celle [28.8.1574-10.12.1648] 1636-1648 Fürst v. Lüneburg.
[314] August (II.) der Jüngere [10.4.1579 Dannenberg-17.9.1666 Wolfenbüttel] Herzog zu Braunschweig-Lüneburg, Fürst v. Braunschweig-Wolfenbüttel, regierte 1635-1666 u. galt als einer der gelehrtesten Fürsten seiner Zeit.
[315] Matthias [Matteo] [di] Gallas [Galas, Galasso], Graf v. Campo, Herzog v. Lucera] [17.10.1588 Trient-25.4.1647 Wien], kaiserlicher Generalleutnant. Vgl. REBITSCH, Matthias Gallas; KILIÁN, Johann Matthias Gallas.
[316] N. St.: Neuer Stil, auch styl. nov.: nach neuer Zeitrechnung, nach dem Gregorianischen Kalender, der mit der Reform Papst Gregors XIII. von 1582 den Julianischen Kalender (stylus vetus) abgelöst hat. Die meisten Protestanten jedoch wollten den neuen Kalender lange Zeit nicht übernehmen. Um nach dieser neuen Zeitrechnung zu datieren, mussten 10 Tage zum Datum des alten Kalenders dazugezählt werden.
[317] DECKEN, Herzog Georg 3. Bd., S. 118f.
[318] Requisition: Anforderung.
[319] Kloster Meding: 1241 gegründetes Zisterzienserkloster, das1336 unter Beibehaltung seines Namens Medingen an den unweit gelegenen Ort Tzellensen an der Ilmenau verlegt wurde.
[320] DECKEN, Herzog Georg 3. Bd., S. 123f.
[321] Heinrich v. Stammer [ -27.11.1637 in Stettin hingerichtet], schwedischer Obrist.
[322] Stettin [Szczecin]; HHSD XII, S. 280ff.
[323] METEREN, Meterani Novi 4. Bd., S. 584; THEATRUM EUROPAEUM 3. Bd., S. 857f., 884.
[324] KRUSENSTJERN, Selbstzeugnisse, S. 111f.
[325] Billeben [Kyffhäuserkreis].
[326] Rockensußra [Kyffhäuserkreis].
[327] HAPPE II 178 v; mdsz.thulb.uni-jena.de.
[328] Holzsußra [Kyffhäuserkreis].
[329] Friedrich Unger [Ungar, Hungar], genannt „Masslechner“ [ – ], kursächsischer, dann kaiserlicher Obrist.
[330] Korporal [schwed. korpral, dän. korporal]: Der Korporal war der unterste Rang der Unteroffiziere, der einen Zug als Teil der Kompanie führte. Er erhielt in der kaiserlichen Armee (1630) 12 fl. Sold monatlich; „Ordnung Wie es mit der verpflegung der Soldaten“. Das entsprach immerhin dem Jahreslohn eines Ochsenknechtes, in besetzten Städten (1626) wurden z. T. monatlich 24 Rt. erpresst; HEIMATMUSEUM SCHWEDT, Die Uckermark, S. 15. Nach Wallensteins Verpflegungsordnung (1629) standen ihm bei der Infanterie 16 Rt. monatlich zu; KRAUSE, Urkunden 1. Bd., S. 461. DESING, Historia auxilia 2. Bd., S. 186: „Corporal ist ein Unter-Officier, der viel zu thun hat: Darumb seynd bey einer Compagnie zwey, drey oder vier. Für seine 15. Mann, welche man eine Rott nennt, empfängt er vom Capitain d’Armes das Gewehr, vom Fourier das Quartier, vom Muster-Schreiber das Geld, vom Sergeanten die Ordre, gehört nit zur Prima plana“. LAVATER, KRIEGSBüchlein, S. 60: „Die Corporalen sollen gute / redliche / und versuchte Soldaten seyn / die schreiben / lesen / und rechnen können. In dem commandieren sollen sie gleiche ordnung halten / die Schiltwachten zu guter zeit aufstellen / und ihr Ansehen bey den Soldaten erhalten: Sie sollen gantz eiserne Ladstecken / Krätzer / und Kugelzieher an ihren Musqueten haben / daß sie den Soldaten zu hülff kommen mögen“.
[331] im Original (falsche) Korrektur aus Rochauischen.
[332] Gräfentonna, heute Ortsteil von Tonna [LK Gotha]; HHSD IX, S. 162ff.
[333] HAPPE II 179 r; mdsz.thulb.uni-jena.de.
[334] Kelbra [LK Mansfeld-Südharz]; HHSD XI, S. 236f.
[335] Badra [Kyffhäuserkreis].
[336] Hohnstein, Burg [LK Nordhausen]; HHSD IX, S. 205f.
[337] HAPPE II 167 r-168 v; mdsz.thulb.uni-jena.de.
[338] Sondershausen [Kyffhäuserkreis]; HHSD IX, S. 402ff.
[339] Hachelbich [Kyffhäuserkreis].
[340] Bad Berka [LK Weimarer Land]; HHSD IX, S. 27f.
[341] Jechaburg [Kyffhäuserkreis].
[342] Bebra, heute Stadttteil von Sondershausen [LK Kyffhäuserkreis]; HHSD IX, S. 41.
[343] Keula [Kyffhäuserkreis]; HHSD IX, S. 233.
[344] Großbrüchter [Kyffhäuserkreis].
[345] Kleinbrüchter [Kyffhäuserkreis].
[346] Toba [Kyffhäuserkreis]; HHSD IX, S. 441.
[347] Urbach [Unstrut-Hainich-Kreis].
[348] Schlotheim [Unstrut-Hainich-Kreis], HHSD IX, S. 385.
[349] Volkenroda; Kloster [Unstrut-Hainich-Kreis]; HHSD IX, S. 453ff.
[350] Kirchheilingen [Unstrut-Hainich-Kreis].
[351] Bothenheilingen [Unstrut-Hainich-Kreis].
[352] HAPPE II 165 r-165 v; mdsz.thulb.uni-jena.de.
[353] Krakeel: Zank, Streit, Zerwürfnis, Gekrache, Auftritt, Lärm, Empörung, Konflikt, Handgemenge, Donnern, Trubel, Auseinandersetzung, Geräusch, Erhebung, Geklirr, Kontroverse, Ausschreitung, Gedonner.
[354] Vivers: Lebensmittel.
[355] Fourage: Viehfutter, auch Unterkunft und Verpflegung für die jeweilige Einheit. Die Fourage musste von der betreffenden Garnisonsstadt und den umliegenden Dörfern aufgebracht werden und war an sich genau geregelt; vgl. auch die „Königlich Schwedische Kammer-Ordre“ Torstenssons vom 4.9.1642 bei ZEHME, Die Einnahme, S. 93ff. Wrangels Kammerordnung, Bregenz, 20.2.1647, sah vor; HELLER, Rothenburg, S. 362: „Fourage: Auf jedeß Dienst Pferd Monatlich 8 Scheffel Haber Erfurtisch Meeß [1 Scheffel = 59, 6132 Liter], 360 Pfund Hewe, 6 Gebund Stroh; auf die Bagagepferd wird halb so viel Futter alß auf ein Dienst Pferd gereicht“. Natürlich wurde gegen die Bestimmungen immer wieder verstoßen.
[356] Peukendorf [Kyffhäuserkreis].
[357] Christian Günther I. Graf zu Schwarzburg-Hohenstein [11.5.1578-25.11.1642].
[358] Gemeint ist hier ein Salvagardist. => Salvaguardia: Ursprünglich kaiserlicher Schutzbrief, durch den der Empfänger mit seiner Familie und seiner ganzen Habe in des Kaisers und des Reichs besonderen Schutz und Schirm genommen wurde; zur öffentlichen Bekräftigung dieses Schutzes wurde dem Empfänger das Recht verliehen, den kaiserlichen Adler und die Wappen der kaiserlichen Königreiche und Fürstentümer an seinen Besitzungen anzuschlagen. Der Schutzbrief bedrohte jeden Angreifer mit Ungnade und Strafe. Im 30jährigen Krieg militärische Schutzwache; Schutzbrief (Urkunde, die, indem sie geleistete Kontributionen und Sonderzahlungen bestätigte, gegen weitere Forderungen schützen sollte, ggf. durch militärische Gewalt des Ausstellers); auch: sicheres Geleit; eine oft recht wirkungslose Schutzwache durch abgestellte Soldaten, in schriftlicher oder gedruckter Form auch Salvaguardia-Brief genannt, die meist teuer erkauft werden musste, und ein einträgliches Geschäft für die zuständigen Kommandeure darstellten. Teilweise wurden entsprechende Tafeln an Ortseingängen aufgestellt, „Salvaguardia“ an die Türen der Kirchen (HERRMANN, Aus tiefer Not, S. 55) geschrieben oder für die ausländischen Söldner ein Galgen angemalt. Die 1626 von Tilly erlassene Schultheißen-Ordnung hatte festgelegt: „Wer salua Guardia mit wortten oder that violirt, den solle niemandt zu verthädigen understehen, sonder welcher hoch oder nider Officir ein dergleichen erfahren mag, der solle den muthwilligen verbrecher sobalden zu dem Provosen schaffen, dem Schultheysen neben einandtwortung bey sich unrecht befundenen sachen und guetter hiervon berichten ohn einred, die Restitution und was bey der sachen underlauffen möcht dass Gericht entscheiden lassen, und welcher einem andern sein gewonnen beuth abnimbt oder an seinem freyen verkauff nachtheilig verhindert, den solle Schultheyss zur Restitution anhalten und noch darzu mit straffen hart belegen“. ZIEGLER, Dokumente II, S. 986. Der Abt Veit Höser (1577 – 1634) von Oberaltaich bei Straubing; SIGL, Wallensteins Rache, S. 140f.: „Da die Schweden so grausam wüteten und sich wie eine Seuche immer weiter ausbreiteten, alle Dörfer mit Raub, Mord und Jammer heimsuchten, erbaten die Bürger ab und zu von den Kapitänen der Weimaraner eine Schutzwache, die bei ihnen meist Salva Guardia heißt. Erhielten sie diesen Schutz zugesagt, so wurde jeweils ein Musketierer zu Fuß oder zu Pferd in das betreffende Dorf, die Ortschaft, den Markt abgestellt. Dieser sollte die herumstreifenden Soldatenhorden, kraft eines vom Kapitän ausgehändigten schriftlichen Mandats, im Zaume halten, ihre Willkür beim Rauben und Plündern einschränken. […] Es ist aber nicht zu bestreiten, dass eine solche Schutzwache unseren Leuten oder den Bewohnern anderer Orte, denen auf ihre Anforderung eine Salva Guardia zugestanden wurde, keinen Vorteil brachte. Im Gegenteil, sie schlugen ihnen vielmehr zum Schaden aus und waren eine Belastung. Offensichtlichen Nutzen dagegen hatten nur die Kapitäne, denn ihnen mussten die Leute gleich anfangs die ausgehandelte Geldsumme vorlegen oder wenigstens wöchentlich die entsprechende Rate (pensio) entrichten. Kurz, wie Leibeigene oder Sklaven mussten sie blechen, was die Kapitäne verlangten. Ich habe nur einen Unterschied zwischen den Orten mit und denen ohne Salva Guardia festgestellt: Die Dörfer ohne Schutzgeleit wurden früher, jene mit einer Salva Guardia erst später ausgeplündert. Da nämlich die Schweden vom Plündern nicht ablassen konnten, solange sie nicht alles geraubt hatten, so raubten und plünderten sie entweder alles auf einmal (sodaß sie nicht mehr zurückkommen mußten) oder sie ließen allmählich und langsam bei ihren Raubzügen alles mitgehen, bis nichts mehr zu holen war. Obendrein haben diese eigentlich zum Schutze abkommandierten Musketiere und Dragoner gewöhnlich die Ortschaften, ihre Bewohner und deren Habseligkeiten – als Beschützer – ausspioniert und dann verraten. Wurde nämlich der bisherige Beschützer – und Spion – unvermutet abberufen, dann brachen seine Kameraden, Raubgesellen und Gaunerbrüder ein und raubten alles, was bislang durch den Schutz der Salva guardia verschont geblieben war, was sie in Wirklichkeit aber für sich selbst hinterlistig und heimtückisch aufbewahrt hatten, und wüteten um so verwegener (pro auso suo) gegen die jämmerlich betrogenen und enttäuschten Menschen, beraubten sie nicht menschlicher und marterten sie“. Auch war das Leben als Salvaguardist nicht ungefährlich. Der Ratsherr Dr. Plummern berichtet (1633); SEMLER, Tagebücher, S. 65: „Eodem alß die von Pfullendorff avisirt, daß ein schwedischer reütter bei ihnen sich befinnde, hatt vnser rittmaister Gintfeld fünf seiner reütter dahin geschickht sollen reütter abzuholen, welliche ihne biß nach Menßlißhausen gebracht, allda in dem wald spolirt vnd hernach zu todt geschoßen, auch den bauren daselbst befohlen in den wald zu vergraben, wie beschehen. Zu gleicher zeit haben ettlich andere gintfeldische reütter zu Langen-Enßlingen zwo schwedische salvaguardien aufgehebt vnd naher Veberlingen gebracht, deren einer auß Pommern gebürtig vnd adenlichen geschlächts sein sollen, dahero weiln rittmaister Gintfeld ein gůtte ranzion zu erheben verhofft, er bei leben gelassen wird“. BLÖTHNER, Apocalyptica, S. 49f. (1629): „Eine Eingabe des Bauern Jacob Löffler aus Langenwetzendorf [LK Greiz] wegen der bei ihm einquartierten »Schutzgarde« schildert die Heldentaten der derselben ungemein plastisch: »Was ich armer Mann wegen anhero zweijähriger hiesigen Einquartierung für groß Ungemach ausstehen müssen, gebe ich in Unterthänigkeit zu vernehmen: Denn erstlichen habe berührte Zeit über 42 ganze 42 Wochen Tag und Nacht bei den Soldaten ich aufwarten, nicht allein viel Mühe und Wege haben, sondern auch welches zum Erbarmen gewesen, Schläge gewärtig zu sein und geprügelt werden zu müssen, 2. habe ich meine geringe Haushaltung wegen jetziger Unsicherheit beiseits setzen, meine Felderlein wüst, öd und unbesamt liegen lassen, daß seither ich im geringsten nichts erbauen, davon samt den Meinigen ich mich hätte alimentieren mögen, 3. haben die Soldaten mir die Gerste, so zu einem Gebräulein Bier ich eingeschüttet, aus den Bottichen genommen, zum Teil mutwilligerweise zerstreut, zum Teil mit sich hinweggenommen, verfüttert und verkauft, 4. haben sie mir das wenige Getreidig, so noch unausgedroschen vorhanden gewesen, mit dem Geströhde aus der Scheune in andere Quartiere getragen, ausgeklopft und ihres Gefallens gebraucht, 5. weil sie an meiner geringen Person sich nicht allzeit rächen können, haben sie mir die Bienen und derselben Stöcke beraubet, umgestoßen und zu Grund und Tode gerichtet, 6. sind von ihnen mir alle Hühner, Gänse und ander Federvieh erschossen, genommen und gefressen worden, meine Wiesen, Raine und Jagen mir dermaßen verödet, daß ich nicht eine einzige Bürde Heu und Grummet von denselben genießen kann, 7. endlich ist von ihnen mir eine Kuh aus dem Stalle, so meinen Geschwistern zuständig gewesen, gezogen, in ein anderes Losament getrieben, geschlachtet und gefressen worden.« Teilweise „kauften“ sich begüterte Bürger Offiziere als Salvaguardia, um sich gegen Übergriffe zu schützen; SUTORIUS, Die Geschichte von Löwenburg. 1. Teil, S. 266. Teilweise wurde nur ein einzelner Salvagardist einquartiert, teilweise aber ging die Zahl je nach Kriegs- und Ortslage erheblich in die Höhe. 1635 hielt Heinrich Graf Schlick 100 Mann zum Schutz seiner Herrschaft Plan für notwendig; SENFT, Geschichte, S. 124.
[359] HAPPE II 167 r- 168 v; mdsz.thulb.uni-jena.de.
[360] Jonitz, heute Teil von Waldersee, Stadtteil von Dessau-Roßlau.
[361] Vockerode, heute Ortsteil von Oranienbaum-Wörlitz [LK Wittenberg].
[362] Törten, heute Stadtteil von Dessau-Roßlau.
[363] Mosigkau, heute Stadtteil von Dessau-Roßlau.
[364] WÜRDIG; HEESE, Dessauer Chronik, S. 223 (hier als „dänische“ ? bezeichnet).
[365] Mühlhausen [Unstrut-Hainich-Kreis]; HHSD IX, S. 286ff.
[366] Hans XIV. v. Rochow [Rochaw, Rohau] [18.8.1596 Zinna-16.9.1660 Stülpe], kursächsischer Obrist.
[367] JORDAN, Mühlhausen, S. 258f.
[368] Ebeleben [Kyffhäuserkreis]; HHSD IX, S. 84f.
[369] HAPPE II 180 v-181 r; mdsz.thulb.uni-jena.de.
[370] HAPPE II 183 v; mdsz.thulb.uni-jena.de.
[371] Christian Ernst v. Knoch [Knoche] [10.7.1608 Harzgerode-3.12.1656], kursächsischer Obristleutnant, Obrist.
[372] Dresden; HHSD VIII, S. 66ff.
[373] Stolpen [Sächsische Schweiz-Osterzgebirge]; HHSD VIII, S. 340f.
[374] Radeberg [LK Bautzen]; HHSD VIII, S. 292f.Vgl. auch WECK, Der Chur-Fürstlichen Sächsischen weitberuffenen Residentz- und Haupt-Vestung Dresden [ …], Nürnberg 1680, S. 162.
Veröffentlicht unter Miniaturen
Verschlagwortet mit D
Kommentare deaktiviert für Dehn-Rotfelser [Dhen, Dehnaw, Dähn, Dähne, Dühne, Dehm, Dehme, Dyherrn], Moritz Adolf von
Ruebland [Rüblandt, Rübländer, Rübeland, Rübelant, Rubland, Rubeland, Rutlandt, Rudländer, Tubland], Johann Christoph Freiherr von der [de]
Ruebland [Rüblandt, Rübländer, Rübeland, Rübelant, Rubland, Rubeland, Rutlandt, Rudländer], Johann Christoph Freiherr von der [de]; Obrist [um 1600-1655]
Johann Christoph Freiherr von der [de] Ruebland [Rübländer, Rübeland, Rübelant, Rubland, Rutlandt, Rudländer, Tubland] [um 1600-1655] [1] stand als Obrist[2] und Generalquartiermeister[3] in kaiserlichen Diensten.
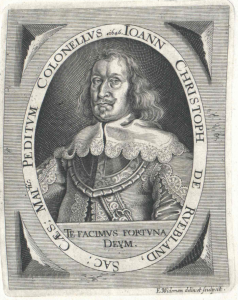 1638 hatte er noch unter Piccolomini[4] gedient. Am 11.1.1638 schrieb er aus Brüssel an Piccolomini: Er sei beim Kardinal-Infanten und den spanischen Ministern zur Audienz gewesen und habe sich dort über das zögernde Einhalten der Versprechungen zur finanziellen Unterstützung der kaiserlichen Armee beschwert. Der Kardinal-Infant habe die Einhaltung der Verträge und großen Geldmengen zugesagt.[5] Ferdinand III.[6] wandte sich am 16.3. aus Pressburg[7] an Piccolomini: Er schicke Instruktionen, die ihm Ruebland einhändigen solle und informierte ihn über den ungünstigen Verlauf des Krieges am Niederrhein.[8] Am 20.3. schrieb Piccolomini aus Brüssel an Ruebland und berichtete ihm über die verlorene Schlacht bei Rheinfelden.[9] Die Stadt Aachen[10] sei bedroht, Caretto di Grana treffe Vorkehrungen zu deren Verteidigung. Auch Köln[11] rüste sich, Kurfürst Ferdinand von Köln[12] habe Truppeneinquartierungen im Stift Stablo[13] bewilligt.[14] Piccolomini informierte Ruebland am 22.3.1638: Er habe die Befehle an Johann von Götz[15] abgeschickt. Suys habe 1.500 jüngst in Lüttich[16] angeworbene und in Maastricht[17] stationierte französische Soldaten überfallen und geschlagen. Johann und Bernard de Voord seien aus französischen Diensten zum Kaiser übergetreten. Er, Piccolomini, habe sie dem Kaiser empfohlen.[18] Von Juli bis Ende September hielt Ruebland Piccolomini weiter über Kriegsgeschehnisse auf dem Laufenden, unter anderem über den Vormarsch seines Regiments in Luxemburg, die Lage der Kaiserlichen in Württemberg und Baden etc.[19]
1638 hatte er noch unter Piccolomini[4] gedient. Am 11.1.1638 schrieb er aus Brüssel an Piccolomini: Er sei beim Kardinal-Infanten und den spanischen Ministern zur Audienz gewesen und habe sich dort über das zögernde Einhalten der Versprechungen zur finanziellen Unterstützung der kaiserlichen Armee beschwert. Der Kardinal-Infant habe die Einhaltung der Verträge und großen Geldmengen zugesagt.[5] Ferdinand III.[6] wandte sich am 16.3. aus Pressburg[7] an Piccolomini: Er schicke Instruktionen, die ihm Ruebland einhändigen solle und informierte ihn über den ungünstigen Verlauf des Krieges am Niederrhein.[8] Am 20.3. schrieb Piccolomini aus Brüssel an Ruebland und berichtete ihm über die verlorene Schlacht bei Rheinfelden.[9] Die Stadt Aachen[10] sei bedroht, Caretto di Grana treffe Vorkehrungen zu deren Verteidigung. Auch Köln[11] rüste sich, Kurfürst Ferdinand von Köln[12] habe Truppeneinquartierungen im Stift Stablo[13] bewilligt.[14] Piccolomini informierte Ruebland am 22.3.1638: Er habe die Befehle an Johann von Götz[15] abgeschickt. Suys habe 1.500 jüngst in Lüttich[16] angeworbene und in Maastricht[17] stationierte französische Soldaten überfallen und geschlagen. Johann und Bernard de Voord seien aus französischen Diensten zum Kaiser übergetreten. Er, Piccolomini, habe sie dem Kaiser empfohlen.[18] Von Juli bis Ende September hielt Ruebland Piccolomini weiter über Kriegsgeschehnisse auf dem Laufenden, unter anderem über den Vormarsch seines Regiments in Luxemburg, die Lage der Kaiserlichen in Württemberg und Baden etc.[19]
Der Benediktiner-Abt von St. Georgen im Schwarzwald,[20] Georg Gaisser [1595-1655],[21] erwähnt ihn in seinem Tagebuch: „13.[11.1638; BW] Horst, Truckhmüller [Druckmüller; BW], Capon [Kapoun; BW] Rublandt, [Johann; BW] Wolf und andere Obersten erschienen, nachdem sie auf ihrem neuerlichen Zuge das Schloß Gutenberg[22] vergeblich angegriffen, das Wiesental verheert und sich einer Beute von etwa 300 Stück Vieh und 100 Pferden bemächtigt hatten, infolge Rückberufung bei der Eschinger Musterung, von wo sie, in die untere Markgrafschaft beordert, den Weg hier vorbei nahmen“.[23]
Im Dezember hielt sich Piccolomini noch immer in Brüssel auf. Am 6.12.1638 schloss er im Namen des Kaisers mit Gamarra im Namen des Kardinal-Infanten einen 12 Punkte-Vertrag über die gegenseitige Hilfeleistung und Vorbereitung der Kampagne des Jahres 1639 ab:
1. Piccolominis Armee wird auf 24.000 Mann, davon 6.000 Reiter ergänzt. Außerdem verbleiben mehrere Regimenter unter Lamboys Kommando.
2. Mit ihrer Teilnahme am Kampf gegen Frankreich ermöglicht die kaiserliche Armee dem Kardinal-Infanten, die nötige Anzahl von Soldaten zur Verteidigung gegen die Holländer abzukommandieren.
3. Gegen Frankreich wird ein Angriffskrieg, in Deutschland ein Verteidigungskrieg geführt werden.
4. Der Kardinal-Infant stellt das Rekrutengeld für die Regimenter Lamboys sowie für die Ergänzung der Regimenter Piccolominis zur Verfügung.
5. Derselbe stellt die Mittel für Piccolominis Artillerie zur Verfügung und wird dessen Armee vom Beginn der Kampagne an bis zur Rückkehr in die Winterquartiere besolden.
6. Der Kaiser trifft solche Vorkehrungen im Reich, dass kaiserliche Truppen in keinem Fall von Flandern abkommandiert werden müssen.
7. Auf Kosten des Kardinal-Infanten werden bis 2.000 Kroaten oder Polen angeworben und Piccolominis Truppen angegliedert.
8. Die 1.000 Mann zählenden Regimenter Rueblands werden gleichfalls vom Kardinal-Infanten besoldet, jedoch auf Reichsgebiet gelegt und erst zu Beginn der Kampagne Piccolominis Truppen angegliedert.
9. An den günstigsten Orten werden rechtzeitig Magazine für den Vormarsch der Armee errichtet und der Kardinal-Infant besorgt die Distribution der Vorräte.
10. Der Kaiser sorgt für ausreichende Reserven an Proviantwagen und Pferden.
11. Für die mit der Befestigung besetzter Orte und deren Eroberung verbundenen Ausgaben teilt der Kardinal-Infant der Armee Piccolominis Minister zu, die über die nötigen Geldsummen verfügen werden.
12. Das Datum des Beginns der Kampagne wird auf den 1.4. festgesetzt.[24]
Vom 20.3. bis zum 15.4.1639 informierte Ruebland Piccolomini weiter über den Zustand seiner Regimenter, deren Ergänzungen durch Werbungen,[25] den beschwerlichen Marsch durch Thüringen und die kriegerischen Aktionen der Schweden (die Brandschatzung Kulmbachs).[26]
Das „Theatrum Europaeum“[27] fasst zusammen: „Gelangen solchemnach an das Eichsfelde / von demselben etwas weniges zu erzehlen / in welchem sich der von Königsmarck / neben andern / eben wohlherum getummelt hat. Die unterthanen dieses Ländleins haben vielmahls hart herwider gehalten / dardurch sie ihres erlittenen Schadens eigene Verursacher geworden. Im Aprilen seynd bey ihnen zwey Käiserliche Regimenter[28] / das Rubländische und Hesterische einquartiret gelegen / welche hin und wider ohne Widerstand gestreiffet / beschädiget / und die Recruiten in Thüringen zerstöret. Der General King gieng diesen Monat über 3000. zu Roß starck / und that ihnen hieran Einhalt. Die Schwedische auß Erfurt[29] haben sich etlichemahl bemühet / selbiges Völcklein zur Contribution[30] zu bringen / seyn aber iedesmahl unverrichter Sachen zurück kommen. Im Eingang deß Junii zogen die Käiserliche herauß / der von Grießheim aber behielte / als Ober-Amptmann / noch hundert Tragoner[31] / das Ländlein darmit vor Schwedischer Contribution zu schützen / und solche hergegen von seinen Benachbarten zu fordern / welches ihm doch über angewendeten starcken Ernst nicht gelingen wolte. Dann nachdeme gedachte beyde Käiserliche Regimenter auß dem Ländlein abgezogen waren / und der Ober-Amptmann sich seines Intents würcklich gelüsten liesse / wurde der Obriste von Königsmarck / so die Kingische Trouppen zu Pferd zugleich führete / benebens dem Plettenbergischen und anderm Fußvolck / derer beyder man an der Weser bey Münden[32] damals nicht bedorffte / nach dem Eichsfeld commandiret / den Ober-Amptmann im Zwang / welchem aber der Obriste Eppe / so hiebevor Hessisch gewesen / auß dem Stifft Oßnabrück in eil zu vermeynter Hülffe kam.
Dann als nun dieser zu Duderstatt[33] mit 1000. abgemüdetem Volck zu Roß ankommen / und etwas außzuruhen gedachte / waren ihme die Schwedischen zu schnell und starck auff den Halß kommen / hatten ihn zeitlich in Unordnung / und was sich zu Pferd nach dem Salberg begeben / in die Flucht gebracht / ihn darauff nechstens mit seinem Uberrest in Duderstatt eingesperret gehalten / und so bald das Fußvolck mit der Artillerie ankame / den Orth beschossen / welchen er keinen Tag gehalten / sondern sich ergeben / und darinnen / sammt denen / die sich zu ihme retiriret hatten / in 500. starck gefangen genommen worden: Und obwohlen der Ober-Amptmann mehr obgedachte zwey Käiserliche Regimenter wieder zurück beruffen / seynd sie doch bey so gestalten Sachen bald durch und auff Saltzungen[34] zu gegangen / und haben den Orth geplündert / von dannen nach dem Fuldischen[35] / und wo sie hin erfordert waren / sich wendende / dannenhero der von Königsmarck den Meister gespielet / und ausserhalb vorerwehnter Gefangener von den Zerstreueten noch vielmehr zur Beut bekommen. Ob auch wohl der Ober-Amptmann sich auff Gleichenstein[36] sich innen halten / der gleichwol auch Rüstenberg[37] in eil mit etwas Fußvolck vom Land besetzet / und doch endlich mit Accord sich ergeben. Worauff sich andere Städtlein deß Eichsfeldes / und unter denselben Heiligenstatt[38] zum ersten auch ergaben / dardurch unter die Contribution gebracht / der Ober-Amptmann aber / darum / daß er im Accord[39] keinen Orth / wohin er geführet werden sollen / ernennet / auch einen im Accord mit begriffenen verpartiret hatte / ungestellter seiner Soldaten / in Arrest genommen wurde“.[40]
Am 9.5.1639 schrieb der kaiserliche Kriegssekretär Johann Friedrich Fischer aus Wien an Piccolomini: Melchior von Hatzfeldt sei mit 4.000 Kürassierern[41] und 5.000 Infanteristen in der Nähe von Würzburg[42] anmarschiert. Ferdinand III.[43] habe beschlossen, ihm, Piccolomini, nicht nur die angeforderten 500 Reiter, sondern auch die Regimenter Ruebland und Heister zu überlassen. Er, Fischer, begnüge sich mit den 6.000 von Piccolomini abkommandierten Infanteristen und warte auf Soldaten aus Mailand, wohin er einen weiteren Kurier mit der Bitte um Hilfe entsandt habe. Er glaube, dass die Regimenter Gallas und Lodron anrücken sollten und dass man zusammen mit Hatzfeldt, den Ungarn[44] und Kroaten,[45] die unter Isolano und Földváry unterwegs seien, insgesamt 30.000 Mann zur Verteidigung der Erbländer aufstellen könne.[46]
Der schwarzburg-sondershausische Hofrat Volkmar Happe[47] erwähnt ihn in seiner „Thüringischen Chronik“: „Den 14. [24.5.1639; BW] ist der Keyserliche Obriste Rübelant mit seinen Reutern morgens frühe umb 3 Uhr vor Greußen[48] kommen. Als aber die Schweden von dannen auch hinweg gewesen, hat er die Reuter im Felde füttern lassen. Er aber ist mit wenigen in die Stadt geritten und hat darinnen gefrühstücket, ist darnach wieder friedlich zurücke nach dem Eichsfeld gezogen. Zu Clingen[49] und Westgreußen[50] aber haben seine Reuter übel gehauset und unter anderm den Leuthen alle ihre Pferde und Viehe genommen“.[51] „Den 8. Juni [18.6.1639, BW] ist ein Keyserlicher Lieutenant mit in die fünftzig Pferde starck aus dem Eichsfeld anhero kommen. Deme haben wir für das Rubelandische und Heisterische Regiment zwantzig Pferde geben müssen, worzu aus dem Clingischen Theile sieben gegeben worden, als eines von Clingen, eines von Großenehrich,[52] eines von Wenigenehrich[53] und Amte Rohnstedt,[54] drey aus dem Ebeleben,[55] eines von denen von Heringen[56] und Großmehlra.[57] Noch eines ist von Holzthaleben[58] kommen, das ist dem Verwalter, Tobiae Schuhearten, verkauft worden, hat es an Herrn S. Ernst Tentzeln Geldern bekommen“.[59]
Am 17.7. schrieb Piccolomini an den Kardinal-Infanten: Die Unsicherheit über die gegnerischen Pläne erlaube es ihm nicht, sich vom Kriegsschauplatz zu entfernen. Er habe Meldungen über gegnerische Truppenkonzentrationen bei Montmédy[60] sowie über die Vorbereitungen und den Marsch Châtillons gegen Thionville[61] erhalten. Seiner Meinung nach müssten die Stellungen zwischen Sambre und Maas bewacht und Quesnoy[62] und Avesnes[63] gehalten werden. Ludwig XIII. wolle angeblich selbst kommen und Guise[64] besetzen; die Städte Hesdin[65] und Durlan[66] seien auch bedroht. Man dürfe die Armee nicht durch eine Abkommandierung schwächen, ebenso müssten die von Beck kommandierten Reserven und das Regiment Ruebland am Ort bleiben.[67] Am 29.7. teilte Beck aus Thionville Piccolomini mit, der von ihm, Beck, in Givet[68] zurückgelassene Obrist habe gemeldet, dass Charlemont[69] sehr schwach besetzt sei und Obrist Jacob zwischen Philippeville[70] und Marienbourg[71] stehe. Er habe nur das 500 kroatischen Reitern und wenigen Infanteristen bestehende Regiment Heister sowie das 130 Reiter zählende Regiment Ruebland zur Verfügung. Der Gegner treffe große Vorbereitungen bei Metz;[72] Meldungen zufolge sei 28.7. Ludwig XIII. nach Verdun[73] gekommen. Proviant und Munition würden hingebracht und täglich kämen Verstärkungen an. Einige Truppen habe der König in Mouzon[74] gelassen, scheinbar für einen Angriff auf Juois.[75]
Am 11.1.1640 hatte Piccolomini aus Schüttenhofen[76] Ruebland zugesagt, er werde das für die Erneuerung seines Regiments notwendige Geld, nämlich 20 Rt. pro Dragoner und 25 Rt. pro Arkebusier,[77] erhalten. Die Zeit sei gekommen, da jeder Obrist die Pflicht habe, sich persönlich an die Spitze seines Regiments zu stellen, keine überflüssigen Beschwerden zu erheben. Für einen Wechsel der Quartiere bleibe keine Zeit mehr, die Kürassierregimenter seien wegen ihrer Bewährung den Dragonern vorgezogen worden.[78] Piccolomini informierte am 24.1.1640 den Kardinal-Infanten, Bruck, Gall und Ruebland würden auf seinen Befehl hin an die Elbe vorrücken.[79] Am 24.1. schrieb Obrist de Bechamp aus Janowitz[80] an Piccolomoni: Ein bis nach Kauřim [81] vorgedrungener Späher habe gemeldet, dass er den Gegner nirgends erblickt habe und dass auch die Bevölkerung nirgends auf ihn gestoßen sei. Er bemühe sich um die Aufrechterhaltung der Verbindung zu Ruebland; dieser sei, seinen Ermittlungen nach, noch nicht nach Kuttenberg[82] gekommen und so warte er in Janowitz[83] auf weitere Befehl. Ferner habe er alle Elbe-Übergänge von Königgrätz[84] nach Brandeis[85] rekognosziert und insgesamt fünf gezählt.[86] Am 28.1. schrieb Piccolomini am Maximilian von Trauttmansdorff: Für den Kampf gegen die Schweden sei er gerüstet; er habe die Armee zum Angriff auf die einzelnen Elbstädte aufgeteilt und Bechamp und Ruebland ihre Aufgaben zugewiesen; Fernemont stehe bei Kolin.[87]
Die weitere Entwicklung in Böhmen beschreibt das „Theatrum Europaeum“: „Es liessen unterdessen die Käis. die Brücken an der Gissera[88] / als zu Drassnitz[89] und Jungen-Buntzel[90] / auch anderer Orten / repariren / welcher Mangel sie / benebenst der Witterung sehr auffgehalten / auff die Bannierische zu tringen / und hatten doch im Nachhauen nicht geringen Schaden zugefüget.
Dieweiln nun Banner sich zur Böhmischen Leyppa[91] / und dort herum gesetzet / im Rücken aber Melnick[92] / Rauditz[93] / Leutmaritz[94] noch gar nicht verlassen / sondern gering besetzet : Als konten die Käiserlichen nicht anderst / dann die Gissera auffwerts gehen / als nach Eycha[95] und Tornau[96] / gegen der Gabel[97] und Leyppe / dem Banner den Paß / wo müglich / abzuschneiden / der ihnen aber / unangesehen sie in 16000. starck dahinwerts gezogen / zuvor kommen / und starck genug war / darum sie ihme nach Beschaffenheit der Oerter und Pässen / nicht also / wie sie wol gerne wollten / beyzukommen vermochten / der Obriste Rubländer aber wurde mit mehrerm Volck versehen / und in Jungen-Buntzel[98] geleget / gegen den Schwedischen zu partiren“.[99] Ruebland nannte sich selbst „Kommandant zu Leitmaritz und des ganzen Elbstroms“. [99a]
Das „Theatrum Europaeum“ berichtet: „Den Obristen von Rosen wurden von seinem Major Johann von Ratschin / vom alten Regiment 6. Compagnien zugebracht / darum konnte er abermahlen nicht fey[r]en / sondern nahme seinen Vetter Wolmaren / den Tollen zu sich / und überfiele noch selbige Nacht / von Ziegenhain auß / deß Croatischen Obristens / Petern Logy [Losy; BW] Regiment und Quartier zu Allendorff[100] / die noch andere 6. Compagnien Rubländischer Tragoner bey sich hatten, darüber der Obriste durch einen Pistolen-Schuß selbsten verwundet worden / der sich deßwegen auff den Kirchhoff salviret / aber sein Obrister Lieutenant[101] todt geblieben / in angestecktem Quartier neun Standarten verbronnen / ein Standarte und ein Capitäin[102] mit Beuten und Pferden darvon geführet / und sie alle so hefftig aufgeschlagen worden / daß wann der Obriste Fetuari nicht nahe im Anzuge gewesen / so wäre dieses gantze Regiment gantz und gar zu scheitern gegangen“.[103] Das „Theatrum Europaeum“ berichtet weiter: „Der von Hatzfeld ging nach den 10. 20. Octobris vor geendigter Dorstischen Expedition über die Weser / und legte sich vor Münden an der Werra[104] Casselischen Gebieths / das wollte Cassel[105] nachdencklich und beschwerlich fallen / zeit währender Goßlarischer[106] Handlung dergestalt tribuliret zu werden / darum solches nach Nothdurfft geändert wurde / und hat man Käis. theils um Glimpff willen Ursach gehabt hiermit nachzulassen. Der Käiserliche Obriste Rubland wurde mit Reuterey und Fuß-Volck nach Duderstat[107] / ins Eychsfeld / und gegen Mühlhausen[108] geschicket / was möglich / einzunehmen / deme der / von Hatzfeld bald folget : Um den 19. 29. Ocrobris waren die Schwedischen auß beyden Oertern / auch Gleichen[109] oder Gleichenstein[110] / doch nicht ohne Accord, schon getrieben / und sollte es nunmehr auch Göttingen gelten: Doch gienge Herr General von Hatzfeld durchs Eychsfeld nach Thüringen und Erffurt[111] / davon bald folgen wird“.[112]
Im November 1641 war Ruebland im Eichsfeld stationiert,[113] im Dezember 1641 in Duderstadt.[114] Happe notiert: „Den 6. [16.; BW] [Dezember] habe ich wieder einen mühseligen Tag gehabt, denn 1.) habe ich wegen der borische [bayerischen; BW] Reuter zu Ebeleben, 2.) wegen der Rübelandischen zu Keula, 3.) wegen der Gonzagischen zu Greußen, 4.) wegen der Gonzagischen alhier zu Sondershausen[115] und entlichen 5.) mit denen Walischen [Wahl; BW] viel zu thun gehabt“.[116]
Im Juli 1642 war Ruebland Kommandant in Glatz[117] und berichtete Melchior von Hatzfeldt von dem Überfall auf Braunau.[118] Am 22.8. schrieb Erzherzog Leopold Wilhelm[119] aus dem Feldlager vor Groß-Glogau[120] an Rudolf Graf Colloredo: Seinen Brief vom 13.8. mit der Mitteilung von der Bereitstellung von 2.000 Kanonenkugeln und 100 Ztr. Schießpulver habe er erhalten. Das genannte Kriegsmaterial solle der Armee zugeführt werden, da es für die Operationen vor Glogau gebraucht werde; den Transport von Glatz nach Glogau würden Soldaten Rueblands besorgen. Er, Leopold Wilhelm, habe auch beim böhmischen Statthalter ausgiebige Hilfe angefordert.[121]
Im April 1643 informierte Ruebland aus Glatz Piccolomini über den schwedischen Vormarsch in der Lausitz und in Mähren. Auch wenn Piccolomini, nun mit der Absicht, nach Spanien zu gehen, sich nach Wien begäbe, würde ihm der Kaiser seiner Meinung nach die Einwilligung verweigern, denn die Anwesenheit des Gegners in einem Erbland erfordere mehr als je den Einsatz tapferer Generäle und fähiger Führer.[122] Der kaiserliche Hauptmann Cernilau informierte Ruebland am 20.5. aus Landeshut:[123] Am heutigen Tag sei der Gegner vor Schweidnitz[124] anmarschiert und werde mit 1.000 Mann, 500 Pferden und vieler Bagage für die Nacht sein Lager bei Schönau,[125] 2 Meilen vor Löwenberg,[126] aufschlagen. Zweifellos marschierten diese Truppen zur Armee, was auch sein Vertrauensmann in Schweidnitz bestätigt habe. Er, Cernilau, brauche dringend Hilfe, da der Gegner ihn mit Sicherheit überfallen werde und die Landeshuter Garnison mit 300 Mann schwach sei.[127] Ruebland schrieb einen Tag später an Gallas,[128] von verschiedenen Stellen seien ihm Berichte zugegangen, dass der Gegner aus Schweidnitz ausgerückt und zweifellos zu einem Angriff gerüstet sei.[129] Für die folgenden Jahre fehlen Erwähnungen.
Am 1. September 1647 war Enckevort mit dem Fußregiment Ruebland und aus Konstanz[130] herangeführter Artillerie vor Ravensburg[131] gerückt und hatte durch sein bloßes Erscheinen die schwedische Besatzung verführet, die Stadt eilig zu verlassen und sich nach Überlingen[132] zurückzuziehen. Damit war dem Gegner die Communication zwischen Überlingen und Memmingen[133] abgeschnitten. Es reift die Zeit, den Fuß wieder weiter ins Reich zu stellen und dafür ein Corpus aufzurichten, hatte Enckevort angesichts seiner bisherigen Erfolge gefordert. Am 29. September war Enckevort mit seinem und dem Rueblands zur Belagerung Memmingens vor die Stadt gerückt.
„Memmingen gehörte seit 1286 zum Kranz der Reichsstädte. Sie lagen im Westen, besonders im Südwesten, und nannten sich ‚Des Heiligen Reiches freie Städte‘, untertan allein dem Kaiser, als Gemeinwesen frei und selbst verwaltet. Memmingen war mit Mauern und Toren gut bewehrt und besaß ein eigenes ländliches Territorium von zwölf Dörfern. In Memmingen hatte die Reformation Einzug gehalten. Die Stadt war im Ulmer Waffenstillstand[134] vom Kurfürsten von Bayern[135] den Schweden eingeräumt worden, was er konnte, denn es hatte eine bayrische Besatzung. Ob er über eine Reichsstadt verfügen durfte, ist eine andere Frage.
Am 29. September 1647 traf Generalfeldzeugmeister[136] von Enkevoer bei Memmingen ein. Seine beiden Fußregimenter ‚Enkevoer‘ und ‚Rübland‘ folgten. Kurfürst Maximilian von Bayern war mit dem kaiserlich-bayrischen Rekonjunktur-Rezeß vom 7. September wieder an die Seite des Kaisers getreten. Bis zum 28. September hatten die Bayern acht Fußregimenter, drei Reiterregimenter und das Dragonerregiment Bartels vor den Toren Memmingens versammelt. – Es waren die Fußregimenter Cobb, Fugger, Marimont, Mercy, Ners, Royer, Reuschenberg und Winterscheid, die Reiterregimenter La Pierre, Jung-Kolb und Walpott-Bassenheim sowie das Dragoner-Regiment Bartels. – Ihre Streitmacht umfasste 83 Kompanien. Die bayrische Belagerungsartillerie mit dem Fuhrpark an ‚Stückwagen‘, auf denen die schweren Rohre, Lafetten, Kugel- und Munitionswagen mit Pulver, Pech und Petarden,[137] Kränen, Winden und Zugbrücken wurde von 1.074 Pferden bewegt. Noch mehr Dienstpferde der Reiterei und Zugpferde des Tross'[138] kamen hinzu. Am 30. September übernahm Enkevoer ganz selbstverständlich als der ranghöchste General das Kommando vor Memmingen. Zu seiner Rangautorität kam zweifellos sein persönliches Ansehen, bestätigt durch seine jüngsten Erfolge.
Am 28. September war Feldmarschall Wrangel der Brief zugestellt worden, mit dem der Kurfürst von Bayern den Waffenstillstand mit Schweden widerrief.[139] Zwei Tage zuvor hatte Wrangel ein französisches Eingreifen in Süddeutschland als höchst ungewiß bezeichnet.[140] Der bayrisch-französische Waffenstillstand bestand noch – und hat über die Zeit der Belagerung hinaus gehalten.
Feldmarschall[141] Holzappel versorgte Enkevor mit Lageorientierungen: ‚Der Kriegszustand hat sich so weit geändert, daß wir uns mit den Churbayrischen numehr über das Erz(gebirge) aus dem Königreich ins Meissensche gezogen und entschlossen, dem feindt auf den Hals zu gehen, welcher den einkommenden Zeitungen nach bey Zeitz[142] stehe. Ob er nun aber an die Elbe oder in Niedersachsen gehen wirdt, solches kann man noch nicht eigentlich wissen‘ (Lageorientierung vom 18. Oktober).[143] Kaiserliche und Bayern konnten Memmingen belagern, ohne schwedische oder französische Entsatzversuche befürchten zu müssen.
Enkevoer nahm sein Hauptquartier im Dorfe Buxheim[144] nordwestlich von Memmingen, nahe der Iller. Die drei bayrischen Generalwachtmeister[145] de Lapier, Rouyer und Winterscheid mit ihren Frauen und Enckevort allein bezogen verschiedene Häuser und Säle in der Kartause des Klosters zu Buxheim. Zwischen Buxheim und Hart[146] errichteten die acht bayerischen Fußregimenter ein befestigtes Lager. Die beiden kaiserlichen legte Enkevoer in den Ort Hart, südwestlich Memmingen. Im Süden und Südosten schloß sich die Masse der bayerischen Reiterei bis nach Memmingerberg[147] an. In diesem Dorf stand das Reiterregiment Walbott und kontrollierte die ostwärts führende Straße nach Mindelheim.[148] Rund um das Dorf wurden Schanzen aufgeworfen. Über die Dörfer Grünenfurt,[149] Amendingen[150] und Egelsee[151] fand der Belagerungsring aus Schanzen und Redouten in einem nordöstlichen und nördlichen Bogen wieder Anschluß an die Iller. Damit war Memmingen vollständig eingeschlossen.
Die nächsten Städte, auf die man sich zur Versorgung stützte, waren Mindelheim im Osten und Leutkirch[152] im Südwesten. Nach Mindelheim wurden die transportfähigen Verwundeten in feste Unterkünfte gefahren. Leutkirch mußte Brot liefern und ‚etliche Persohnen und Pferdt hinunder in das Lager nacher Buxheimb schicken und dann Wochentlich offgemelten General Enckenfort einen Wagen – den die Burger den Freßwagen nenneten – mit allerhand zur Kuchen dienende Sachen, so jedesmal 100 Gulden kostete‘.[153]
Schon am 20. September hatte der bayrische Generalwachtmeister de Lapier mit seiner Reiterei die Stadt von aller Zufuhr abgeschnitten. Kurfürst Maximilian forderte in einem Mahnschreiben den Magistrat auf, weder mit Rat und Tat den Schweden zu helfen, noch der Bürgerschaft zu erlauben, gegen die Waffen des Heiligen Reiches Widerstand zu leisten. Vielmehr solle der Magistrat den Kommandanten dahin bringen, ohne Verzug mit seinen Kriegsvölkern abzuziehen, um allen ‚Extremitäten und Gefahren vorzubeugen, in die sonst die Reichsstadt geraten würde“.[154]
Der Söldner Peter Hagendorf[155] unter dem Kommando von Winterscheid hat in seinem Tagebuch eine kurze Beschreibung der Belagerung hinterlassen: „Den 27. September angekommen zu Memmingen im Jahr 1647. Unser Lager aufgeschlagen bei dem Kloster Buxheim. Bald mit Schanzen und Laufgräben gearbeitet und zwei Batterien davor gelegt. Auf der großen Batterie hat mein Oberst Winterscheid als Generalwachtmeister kommandiert. Darauf sind gestanden 2 dreiviertel halbe Kartaunen,[156] 4 halbe Kartaunen, 2 Schlangen.[157] Auf der kleinen Batterie hat kommandiert der Oberst Rouyer [Royer; BW], sind ebensoviel Kanonen daselbst gestanden. Damit haben sie nichts anderes geschossen als glühende Kugeln.[158] Noch haben wir 4 Feuer-Mörser gehabt[159] und geschossen Tag und Nacht. Den 5. Oktober sind sie ausgefallen, uns von den Batterien weggetrieben und 5 Stück vernagelt.[160] Überdem haben sie noch etliche Ausfälle getan. Aber wir haben sie bald wieder hineingejagt. Überdem haben wir uns besser versehen und die Mauern und ihre Batterien mit Kanonen und Minen verwüstet, daß sie sich haben müssen ergeben.
Wir haben auch etliche Male die Schanzen gestürmt, so das Krugstor und das Westertor, aber nichts gerichtet, außer viel Volk verloren. Den 23. November im Jahr 1647 haben sie akkordiert, den 25. November abgezogen. Darin sind gelegen 350 Mann. Der Oberst Przyemsky hat hier kommandiert. Mit Sack und Pack sind sie abgezogen, sind eskortiert worden bis nach Erfurt“.[161]
Der Chronist Christoph Schorer, Sohn des namensgleichen Dr. jur. Christoph Schorer, Memminger Ratsadvokat und über zwei Jahre bei den Westfälischen Friedensverhandlungen anwesend, hat dagegen in seiner „Memminger Chronick“ (1660) den Verlauf der Belagerung aus der Sicht der Betroffenen ausführlich dargestellt.
„Der Kommandant Memmingens, Obrist Sigismund Przyemski, ein gebürtiger Pole, befehligte nur zwischen 400 und 500 Mann, darunter etwa 70 Reiter. Dennoch war er zu äußerstem Widerstand entschlossen. Über die Neutralität Bayerns machte er sich keine Illusionen. Die Kaiserlichen und Bayerischen waren ihm an Zahl und Artillerie um ein Vielfaches überlegen. Für Przyemski zählte seine gute Versorgungslage mit Lebensmitteln und Munition sowie die fortgeschrittene Jahreszeit. Mit jedem neuen Herbsttag würden die Belagerer mehr den Unbilden der Witterung ausgesetzt sein, während seine schwedische Besatzung den Schutz der festen Unterkünfte hatte. Es kam darauf an, die Verteidigungskraft seiner Soldaten so lange wie möglich zu erhalten und den an sich schon hohen Verteidigungswert der Festung weiter zu erhöhen.
Am 21. September, einen Sonnabend, ließ der Kommandant die Bürgerschaft auf die Zunfträume kommen und forderte sie durch seinen Major auf, die Stadt zusammen mit der Besatzung zu verteidigen. Die Bürger weigerten sich unter Hinweis auf ihre kaiserliche Obrigkeit. Sie seien ungewollt als ein ‚subjektum passivum‘ unter die schwedische Besatzung geraten. Damit spielten sie auf den Ulmer Waffenstillstand an, der ihre Reichsstadt ungefragt an die Schweden ausgeliefert hatte.
Am anderen Tage ließ Przyemski an mehreren Stellen einen Verteidigungsaufruf anschlagen, den Marktplatz während der Sonntagspredigt einzäunen, von Soldaten unter Gewehr umstellen und seine Kavallerie in den Gassen und am Markt aufreiten.
Er rief den Magistrat und die Bürger durch Trommelschläger bei Strafe für Leib und Leben auf den Markt und in die Einzäunung. Dort stand er selbst auf einem Podest. Die Bürger, welche den Gottesdienst besucht hatten, wurden sogleich von den Kirchenstufen zu ihm gelenkt. Jetzt sprach Przyemski, zuerst zum Rat, dann zu den einzelnen Zünften. Sie sollten an Ort und Stelle erklären, ob sie ihn als Kommandanten anerkennen, zu ihm halten und ihm und seinen Soldaten bei der Verteidigung der Stadt beistehen wollten; diejenigen, die sich nicht dazu verstehen wollten, sollten auf die Seite treten, an denen werde er eine scharfe Exekution vornehmen lassen – und der Scharfrichter wartete schon, für alle sichtbar. Niemand trat auf die Seite und der Magistrat beriet sich kurz. ‚Nachdem nun die Bürger solchen Ernst und Gewalt gesehen, haben sie in sein (Przyemskis) Begehren gezwungen einwilligen müssen‘.
Zweihundert Handwerksgesellen wurden ausgewählt, bewaffnet und zum Wachdienst unter Aufsicht der regulären Truppe eingeteilt. Für seine Soldaten reduzierte der Kommandant damit das ermüdende Wachestehen. Alle erwachsenen Einwohner, Männer wie Frauen, mußten sich einüben, etwa ausbrechende Feuer zu löschen. Bürger der Stadt, hereingeflohene Bauern aus den umliegenden zu Memmingen gehörenden Dörfern, meist aber die Gesindeleute wurden zum Schanzdienst vor den Mauern herangezogen. Auch Frauen mußten mit hinaus. Vor zwei besonders gefährdeten Stadttoren ließ der Kommandant Erdbastionen aufwerfen und durch ein ‚Ravelin‘ verbinden. Vier schon vorhandene Außenwerke ließ er verstärken, und das alles in der kurzen Zeitspanne von etwa Mitte September bis Anfang Oktober. Einen Müllersknecht, der den Schanzdienst eigenmächtig verlassen hatte, ließ er zur Abschreckung an den Pranger stellen und einen Bauern, der lässig gearbeitet hatte, an den Pfahl auf dem Markt. Während fast der ganzen Zeit der Belagerung wurde geschanzt und gebaut, denn erst mit der Anlage der Annäherungsgräben (Approchen) deckten die Belagerer ihre Angriffsrichtungen auf. Zerstörte oder beschädigte Erdwerke ließ Przyemski ohne Verzug – bei Tag und Nacht – neu aufrichten oder ausbessern. Immer wieder gab es dabei Verluste. Einmal wurde ‚ein Mägdlein beym Schantzen tod geschossen‘, später eine erwachsene Magd.[162] Das Dach über dem Pfarrhof ließ Przyemski abtragen und in der so gewonnenen Feuerstellung eine schwedische Geschützbatterie auffahren, welche die Kaiserlichen und Bayrischen nicht zum Schweigen brachten.
Die Besatzung wagte elf Ausfälle, teils zu Pferd, teils zu Fuß, einmal sogar mit ‚zwey Regiments-Stücklein‘.[163] Mit mehreren dieser Vorstöße drang sie bis in die Approchen vor. Jedesmal kam es dabei zu blutigen Nahkämpfen mit Blankwaffen und Handgranaten (die es schon gab). Ein Ausfall am 5. Oktober mit 150 Mann und allen schwedischen Reitern führte bis in die Geschützstellungen des Belagerungskorps. Die kaiserlich-bayrischen Truppen verloren dabei fünf Gefallene, 49 Verwundete und 17 Gefangene, außerdem fünf Kanonen, die unbrauchbar ‚genagelt‘ wurden. Nach einem Ausfall am 10. Oktober, bei dem die Bayern 20 Tote und 52 Verwundete beklagen mußten, wurde für den folgenden Tag eine beiderseitige Waffenruhe vereinbart, in der die Toten geborgen und übergeben wurden. Bei einem Nachtangriff der Schweden erlitt das Regiment Rübland hohe Verluste, nach Aussagen von Gefangenen waren angeblich 50 Mann gefallen, die ‚Gequetschten‘ (Verwundeten) nicht gerechnet. Bei ihren Ausfällen hatte die schwedische Besatzung das Überraschungsmoment meist für sich. Von der Stadtmauer und den Toren konnte sie schwächer besetzte Abschnitte bei den Kaiserlichen und den Reichsvölkern ausmachen und dort ihre Angriffe ansetzen,wobei sie sich gedeckt in dem Graben vor der Stadtmauer bereitstellte, solange er in ihrem Besitz war.
Die Belagerer standen an vielen Stellen bis zu den Knieen im Wasser ihrer Approchen. Dennoch hatte die Belagerung erhebliche Fortschritte gemacht. Die Belagerten hatten zwar, nicht zuletzt wegen der ‚Beihilfe‘ der Bürgerschaft, stärkeren Widerstand geleistet, als von Enckevoer vermutet. Doch hatten sich die Fußsoldaten der Reichsvölker an einigen Stellen bis zum Graben vor der Stadtmauer vorgeschanzt und vorgekämpft. Dabei hatten sie die ‚Kontre-Escarpe‘ durchbrechen müssen, die ‚Gegenböschung‘ vor der Stadtmauer, die in den Stadtgraben hinab führt. Die Schweden mußten ihre Ausfälle einstellen. Enckevoer am 5. November: ‚ … seither meinem jüngsten an Euer Execellenz (Holzappel) Bericht seindt unsere Werkhe, nach geschehener Durchbrüch und Eroberung der Contrescarpa, bis in den (Stadt)graben gebracht, daß nuhn zu allem ernstlichen Angriff geschritten (werden kann). undt nechstens, wann die schier auch zu endt geführte minen zu ihrer völligen Anfertigen gelangt sein werden, ein guter Effectus dierser Operation … zu hoffen (ist)‘.[164]
Die Entscheidung mußte der unterirdische Minenkampf und die Belagerungsartillerie bringen. Bis Mitte Oktober waren 53 Bergknappen zur Unterstützung des Belagerungskorps eingetroffen. Sie unterstanden einem Bergmeister und drei Berghauptleuten. Das Krugstor und das Lindauer Tor standen dem Lager der bayrischen Fußregimenter am nächsten. Gegen beide Tore wurden die ersten unterirdischen Stollen, die ‚Minen‘, vorangetrieben. Die Schweden hatten den Erdaushub beobachtet, trieben in Richtung auf die Minen einen Gegengraben vor und bauten einen quer dazu verlaufenden Abschnitt, um von dort in die Minen eindringen zu können. Dennoch ließen die Belagerer unter dem von den Schweden errichteten Erdwerk am Lindauer Tor am 5. November die erste Sprengkammer detonieren. Die Sprengung zeigte kaum Wirkung. Möglicherweise war der Stollen wegen der schwedischen Gegengräben zu tief angelegt worden. Die andere Mine gegen das Krugstor wurde von den Schweden entdeckt und zugeschüttet.
Am 6. November wurde eine zweite Kammer unter dem Erdwerk vor dem Lindauer Tor gezündet, diesmal mit mehr Erfolg, das Werk wurde beschädigt, aber noch nicht zerstört. Die Mine gegen das Krugstor stellten bayrische Fußtruppen nach einem Gegenangriff wieder her und die Knappen ließen eine neue Pulverladung am 7. November ‚springen‘, wieder ohne nennenswerten Effekt. Dennoch stürmten die Belagerer gegen das Werk rechts vom Krugstor, das zuvor sturmreif geschossen worden war. Sie waren bereits auf und in dem Werk, als die Schweden einen Gegenstoß führten, der die Eingedrungenen wieder zurückwarf. Es wurde so hart und erbittert gekämpft, daß die Angreifer wieder sechs Gefallene und 68 Verwundete bergen mußten. Am Tage darauf schossen die Schweden in die Stollen vor dem Krugstor. ‚Deshalb wurde mit der Mine ein und einen halben Klafter[165] zurückgegangen, selbige mit starken Brettern und großen Nägeln festgemacht, nach diesem auf der rechten Hand eine Kammer verfertigt und darin drei Tonnen Pulver gethan und dann für den Gebrauch verwahrt‘. Diese Sprengladung warf nur einige Palisaden um. Doch die folgenden Sprengungen unter den Erdwerken brachten Einsturz und Tod, wie die beim Lindauer Tor am 11. November. Neun ‚contraminierende‘ Soldaten der Schweden kamen dabei ums Leben, ‚etliche Soldaten und Schantzleut wurden auch empor gehebt, die aber beym Leben erhalten worden …‘. Teils wurden die den Stadtmauern vorgelagerten Erdwälle und Böschungen zum Einsturz gebracht, teils wurde so gesprengt, daß der Stadtgraben zugeschüttet wurde Erst dann, bei freiem Schußfeld gegen die Steinmauern und Tore der Stadt, konnte die Belagerungsartillerie ihre volle Wirkung entfalten. Gegen die Erdwerke richteten die Kanonen mit ihren Vollkugeln und damaligen Granaten wenig aus.
An schwerer bayrischer Artillerie, an ‚Stücken‘, waren vor Memmingen sechs Mörser und 20 großkalibrige Kanonen in Feuerstellung. Die Mörser oder Böller ‚warfen‘ Eisenkugeln, Steinkugeln, Granaten und Feuerballen im Steilfeuer in die Stadt. Die Kanonen auf ihren aufgeworfenen Bastionen schossen im meist direkten Richten mit flacher Flugbahn gegen die Tore und gegen die beabsichtigten oder vorgetäuschten Einbruchsstellen in der Stadtmauer. Am Abend des 5. Oktober wurde – wohl als Antwort auf den gelungenen Ausfall der Schweden – eine grausam erdachte Kanonade eröffnet. Neben dem ohrenbetäubenden Dauerbeschuß mit explodierenden Granaten und schweren Vollkugeln wurden an die 50 Feuerballen, schon im Fluge brennend, in die Stadt geworfen. Zwei Stadel mit noch ungedroschenem Getreide gerieten in Brand, auf den lodernden und funkensprühenden Flammenherd richtete die Belagerungsartillerie jetzt alle Rohre und schoß im zusammengefaßten Geschütz- und Mörserfeuer in das neue, gut sichtbare Ziel. Bei den Löscharbeiten ‚geriet alles in große Unordnung und ein jeder das seinige zu salviren trachtete‘. Die Brände wurden kaum noch gelöscht, Wasser kam nicht mehr herbei, die beiden nächst stehenden Wohnhäuser fingen Feuer. Przyemski erschien ‚in eigener Persohn‘. Die ihren Hausrat wegtragen wollten, ließ er mit Schelten und Schlägen davon abbringen, trieb sie wieder zum Wasserschleppen und ließ von seiner Begleitung den herausgeretteten Hausrat aufnehmen und in die Flammen werfen. Die Menschen löschten wieder, ihre einzige Chance, verbliebenes Hab und Gut zu retten: ‚ … daher durch des Kommandanten Fleiß und Vorsichtigkeit verhütet wurde, daß das Feuer weiter kam‘. Przyemski publizierte erneut einen Befehl, wonach alle Scheunen und Häuser von Stroh zu räumen waren und es nur noch unter freiem Himmel, in Gärten und an abgelegenen Orten, gestapelt werden durfte. Am 19. Oktober brach noch einmal an drei Stellen zugleich Feuer in der Stadt aus, das aber bald gelöscht werden konnte.
Gleich anderen erfolgreichen militärischen Befehlshabern war es Przyemski in die Wiege gelegt, bei Freund wie Feind die Psyche zu beeinflussen. Einmal wurde eine Soldatenfrau aus dem kaiserlich-bayrischen Troß aufgegriffen und vor ihn gestellt. Er schenkte ihr einen halben Taler, damit sie sich in der Stadt Weißbrot kaufe, und schickte sie dann mit dem Brot zu den ihrigen vor der Mauer zurück. Man kann sich ausmalen, was sie dort alles zu erzählen hatte. Von Hungersnot in der Festung wird sie nichts berichtet haben. Wie Przyemski die Bürger zur Teilnahme an der Verteidigung Memmingens brachte, wie er dabei seinen Major vorschickte, wie er Stimmung und Haltung der Bürger teste, wie er auf dem Marktplatz selbst sprach, einzeln zum Rat und zu den Zünften, mit der sichtbaren Drohung seiner bewaffneten Soldaten und des Scharfrichters, wie er seine Ansprache aufbaute, das alles war ein psychologisches Meisterstück. Einen Tag nach dem 5. Oktober, nach der gerade noch unter Kontrolle gebrachten Feuersbrunst, als ‚alles voller Schrecken und Angst‘, versammelten sich Frauen der Stadt, die Przyemski mit einem Fußfall bitten wollten, daß er rechtzeitig einen Übergabevertrag schloß, damit Stadt und Bürgerschaft samt ‚Weib und Kindern‘ nicht zu Grunde gingen. Er ließ sie gar nicht erst vor, sondern ausrichten, er wisse auch ohne sie sehr wohl, was er zu tun und zu lassen habe. Sie sollten sich heim begeben und das ihre tun. Wenn sie aber etwa wieder bei ihm vorstellig werden wollten, und selbst wenn es noch mehr seien und dabei die vornehmsten Frauen der Stadt, so werde er sie trotzdem alle ohne Ausnahme nach draußen zum Schanzen führen lassen. In dieser Antwort lag zugleich eine unverhohlene Warnung an den Rat der Stadt, kein Weiberregiment zuzulassen.
Przyemski tat viel, damit das Geld seinen Wert behielt, ‚daß in Brodt, Korn, Fleisch, Schmaltz und andern Sachen kein Aufschlag oder Steigerung fürlieff, sondern alles in dem Preiß bleiben mußte, wie es vor der Belagerung gewesen. Wer darüber that, gegen den verfuhr er mit strenger Execution‘. Auch mit drakonischen Strafen hätte er wohl auf Dauer den Geldwert nicht stabil halten können, wenn die notwendigen Lebensmittel zur Neige gegangen wären. Aber die im Menschen schlummernde Bereicherungssucht und den Wucher dämpfte er doch. An Grundnahrungsmitteln waren genügend Vorräte angelegt und den Sommer 1647 über aufgestockt worden. Die einfachen Soldaten gaben den Bürgern Memmingens immer wieder zu verstehen, daß ihr Kommandant und seine Offiziere sehr erfahren seien. Nie wurde bei den einfachen Soldaten Unwillen oder Ungeduld bemerkt. Sie ‚hatten solchen Eyffer und Begierd, daß die Verletzte, ehe sie gar heil worden, den Posten, wan sie nur kondten, zu eileten. Wann ein Ernst oder Anstalt zum Stürmen wahrgenommen worden, seyn auch der Officier Knecht und Jungen mit Gewehr auff die Werck geloffen und helffen fechten, ob sie dessen schon kein Befelch gehabt‘.
Insgesamt verschossen die Belagerer bis in die zweite Hälfte November um die 5.200 Schuß aus Kanonen und Mörsern. Sie verbrauchten dabei etwa 550 Zentner Pulver und 140 Zentner Lunten. Allein an die bayrischen Fußvölker waren rund 125.000 Musketenkugeln ausgegeben worden. Die schwedische Besatzung verbrauchte etwa 200 Zentner Pulver.
Am 12. November war ein Feldtrompeter[166] Enckevoers vor die Stadtmauer Memmingens geritten. Auf gekennzeichnete Trompe-ter, die bestimmte Signale schmetterten, wurde nicht geschossen; sie waren die Parlamentäre zwischen feindlichen Truppen und den Kriegsparteien. Der Trompeter überbrachte ein Schreiben Enckevoers, ‚darinnen guter Accord[167] zu geben anerbotten‘, die Aufforderung, die Stadt durch einen Vertrag zu übergeben. Und der Trompeter rief über die Mauer, man habe sechs Minen fertig, die sofort gezündet werden könnten. ‚Extremitäten und Gefahren‘ wurden immer größer, ein Sturm auf die Stadt, nachdem Minen die Breschen gesprengt hatten, die Freigabe der Stadt zur Plünderung[168] und Willkür für die stürmenden Soldaten, nach damaligem Kriegsbrauch, praktiziert von allen Armeen. Der Trompeter wurde nicht in die Stadt eingelassen, sondern mit einer mündlichen Antwort ‚manierlich‘ abgewiesen.
Endlich, am 20. November, schickte Przyemski seinen Trompeter zu Enckevoer mit dem Wunsch, ihn sprechen zu wollen. Zunächst machte Enckevoer zur Bedingung, daß ein schwedischer Major und ein bayrischer Obristwachtmeister gegenseitig als Geiseln auf Zeit genommen wurden. Dann schwiegen alle Waffen. Przyemski ritt im Vertrauen auf das ihm gegebene Kavaliersehrenwort Enckevors zu ihm, um über die Übergabe zu verhandeln. Hauptgrund war der Mangel an Kugeln und Pulver. Am Ende der Belagerung hatten die Bürger als Bleiersatz ihr Zinngeschirr abgeben müssen und in Memmingen ‚hat man nach der Schwedischen Abzug mehr nicht dann nur zwei Tonnen Pulver, an Bley und Kugeln aber fast nichts gefunden‘.
Przyemski ritt in die Stadt zurück, er war mit den ersten Übergabebedingungen nicht einverstanden. Die beiden Geiseln wurden zurückgestellt, die Feindseligkeiten wieder aufgenommen. Doch stürmen ließ Enckevoer noch nicht, noch wartete er zu und vertraute seiner Kriegserfahrung. Am 22. November nahm die Belagerungsartillerie die Beschießung wieder auf, am Abend wurden zusätzlich Granaten geworfen und zwei Häuser zerstört. Jetzt wurde der Rat der Stadt bei Przyemski vorstellig und schilderte die Not. Przyemski zeigte sich zunächst erzürnt – er schickte aber doch ein Schreiben mit neuen Übergabepunkten an Enckevoer.
Schon seit Wochen hielt Przyemski Reiter auf dem Markt in Bereitschaft und ließ sie in den Gassen patrouillieren, ‚damit von Burgern und Inwohnern nichts wider die Schwedische Völcker practicirt werde‘. Am Abend des 23. November traf die Antwort der kaiserlich-bayrischen Belagerer bei Przyemski ein. Ein bereits von Enkevoer abgezeichneter ‚Accord‘ zur Übergabe der Reichsstadt, mit dem eigenhändigen Zusatz Enkevoers, ‚daß es dabey sein Verbleiben haben werde‘. Dieses Angebot war sein letztes.
Unterschrieben wurde der Übergabevertrag von Przyemski für die schwedische Seite, von Enkevoer, Lapier, Rouyer und Winterscheid für die kaiserlich-bayrische. Enckevoer hat die drei bayerischen Generalwachtmeister mit unterzeichnen lassen, das honorierte ihren Anteil am Belagerungserfolg und enthob ihn langatmiger Rechtfertigung der Übergabebindungen vor Kurfürst Maximilian. Die kaiserlich-bayrischen Truppen besetzten das ihnen eingeräumte Krugstor. Die beiderseitig gemachten Gefangenen wurden ohne Zahlung oder Verrechnung von Lösegeld ausgewechselt. Die Schweden hatten 55 Tote und etwa 60 Verwundete. Sie begruben ihre Toten und setzten die gefallenen Offiziere in der Sankt Martinskirche bei. Am 25. November zog die schwedische Besatzung in mustergültiger Ordnung mit noch 260 Musketieren[169] und 66 Reitern unter 12 wehenden Fahnen ab. Alle mobilen Waffen und 20 Bagagewagen führten sie mit. 100 bayrische Reiter eskortierten sie durch die eigenen Reihen in Lichtung auf Leipheim an der Donau. Enkevoer und Przyemski nahmen nebeneinander stehend den Ausmarsch ab.
Przyemskis Marschziel war die zentral gelegene Festung Erfurt, der große schwedische Etappenplatz zwischen Ostsee und Süddeutschland, zwischen Niedersachsen und Böhmen, zwischen Schlesien im Osten und Hessen im Westen. Sein Marsch führte ihn von Leipheim[170] zur Festung Schweinfurt,[171] von da zur Festung Königshofen im Grabfeldgau,[172] nach Suhl,[173] dann über den Thüringer Wald nach Erfurt. In Erfüllung der Übergabebedingungen wurden die zurückgelassenen schwedischen Verwundeten versorgt und gepflegt. Auch ihnen war freier Abzug nach Gesundung zugesichert“.[174]
„Am schwersten hatte das kaiserlich-bayrische Belagerungskorps gelitten. 199 Soldaten waren gefallen, 478 verwundet worden und 285 hatten die Fahnenflucht den harten Bedingungen und tödlichen Gefahren der Belagerung vorgezogen. Über 900 Mann, oder – in der durchschnittlichen Iststärke kaiserlicher Regimenter am Kriegsende gerechnet – fast drei Fußregimenter waren bei der Belagerung verloren gegangen.
Zwar war Memmingen mit dem Ulmer Waffenstillstand den Schweden von Kurfürst Maximilian selbst eingeräumt worden, im herbstlichen Rekonjunktions-Rezeß mit dem Kaiser aber hatte Maximilian sich auch den schwäbischen Reichskreis ausbedungen, um seine Reichsarmee zu unterhalten. Damit der ganze Kreis vor dem Winter in Kontribution gesetzt werden konnte, mußte Memmingen erobert werden. Deshalb hatte Maximilian seine Armee geteilt, deshalb zwölf Regimenter vor Memmingen beordert und nicht alle Truppen Feldmarschall Gronsfeld unterstellt. Für die weiteren Operationen spielte Memmingen keine Rolle mehr, doch Maximilians Fixierung auf Memmingen hat nicht nur an den kaiserlich-bayrischen Kräften gezehrt, sie hat auch die Konzentration der Kräfte bei der Hauptarmee vermindert.
Der polnisch-schwedische Kommandant Przyemski hingegen hat während seiner energischen, an Initiativen reichen und psychologisch geschickten Verteidigung Memmingens – in der Phase des Rückzugs der schwedischen Armee – starke kaiserlich-bayrische Kräfte gebunden. Den 29. September 1647 trat Wrangel seinen Rückzug zur Weser an, an dem Tag war das bayrische Belagerungskorps vor Memmingen vollständig versammelt, an dem Tage traf Enkevoer ein, die Belagerung begann. Die acht Wochen der Belagerung war die Zeit der höchsten Gefährdung der schwedischen Hauptarmee. Wenn Caspar Schoch mit seinem Reiterregiment den Ausschlag für die Operationsfreiheit der Kaiserlichen in Schwaben gegeben hat, so trug Sigismund Przyemski dazu bei, die schwedische Hauptarmee bei ihrem schwierigen Rückzug zu entlasten. Operativ gesehen war die Belagerung von Memmingen ein schwerer Fehler der kaiserlich-bayrischen Seite“.[175]
Bei einem Nachtangriff der schwedischen Besatzung erlitt das Regiment Ruebland hohe Verluste. Nach Aussagen vion Gefangenen waren fünfzig Mann gefallen, die Verwundeten nicht eingerechnet. Nach der Belagerung Memmingens erholte sich das Regiment in Leutkirch, bevor es nach Nördlingen[176] abkommandiert wurde.
„ ‚Zum Jahresende, am 18. Dezember 1647, kamen der Generalfeldzeugmeister Enkeford und der Obrist Rübland mit zwei Regimentern Fußvolk an um sich verpflegen zu lassen; ungeachtet, dass bereits vier andere Kompanien in der Stadt lagen. Der Rat sandte den Syndicus Scribonium zur Kaiserlichen Majestät in Prag um die pure Impossibilität (Unmöglichkeit) zu repraesentieren (darzulegen), sowie die unerträgliche Last zu deprecieren (um sich dafür zu entschuldigen, dass die Stadt die auferlegten Lasten nicht zu leisten in der Lage wäre). Der Syndicus hatte zwar Audienz, aber er brachte weder Hilfe noch einigen Trost mit. Währenddessen lagen die hohen Offiziere in der Stadt, die Soldaten auf den Dörfern. Sie brachen alles Eisen-Werk aus den Häusern und trieben Handelsgeschäfte damit. Die Stadt musste täglich 800 Pfd. Brot, 200 Pfd. Fleisch, 400 Maß Bier und 30 Säcke mit Hafer herausschaffen.’ (Pa)“.[177]
Ferdinand III. hatte am 22.1.1648 wegen der Beschwerden Eberhards III. von Württemberg und auch des kaiserlichen Generalfeldmarschalls Holzappel den Regimentern Enckevort und Ruebland, das ohnehin wohl der Remontierung[178] bedurfte, den Aufbruchsbefehl nach Böhmen erteilt, was jedoch später wieder rückgängig gemacht wurde. „Die geplante große Operation Melanders wurde abgeblasen. Der Kaiser gab Befehl, die Regimenter Enckevoirt und Ruebland und alle Völker Bönninghausens[179] aus Schwaben abzuziehen; besetzt bleiben sollten nur Lindau,[180] Asperg,[181] Rottweil,[182] Offenburg[183] und Wülzburg.[184] Bönninghausen möge sich im kaiserlichen Hoflager zu Prag einfinden, sein Oberkommissar Hafner erhalte durch Traun eine neue Verwendung. Über diesen hatte Bönninghausen noch am 30. Januar Traun geschrieben, Hafner sei ‚zwar ein guter frommer Mann‘, aber so ängstlich, daß er Kurbayern und die Reichsstände mehr als Ihre Majestät fürchte. Nun ordnete Melander in einem Schreiben, das Bönninghausen, der sich in Windsheim[185] aufhielt, am 12. Februar erhielt, an, auf kaiserlichen Wunsch sollten die Besatzungen von Windsheim, Weißenburg[186] und Rothenburg[187] und die Regimenter Enckevoirt und Ruebland zur Hauptarmee stoßen. Die sechs zum Regiment Conti gehörigen Fähnlein hätten nach Iglau[188] in Böhmen zu marschieren; der Kaiser werde Ordre geben, ob auch die beiden Regimenter Enckevoirt und Ruebland ‚zur völligen remonta‘ in Böhmen Quartiere nehmen sollten. Am 13. Februar erteilte Melander Anweisung zum Aufbruch des Regiments Ruebland nach Ochsenfurt,[189] da man die Frühjahrskampagne beginnen werde“.[190]
Um weitere Hinweise unter Bernd.Warlich@gmx.de wird gebeten !
[1] Vgl. die Erwähnungen bei KELLER; CATALANO, Die Diarien.
[2] Obrist: I. Regimentskommandeur oder Regimentschef mit legislativer und exekutiver Gewalt, „Bandenführer unter besonderem Rechtstitel“ (ROECK, Als wollt die Welt, S. 265), der für Bewaffnung und Bezahlung seiner Soldaten und deren Disziplin sorgte, mit oberster Rechtsprechung und Befehlsgewalt über Leben und Tod. Dieses Vertragsverhältnis mit dem obersten Kriegsherrn wurde nach dem Krieg durch die Verstaatlichung der Armee in ein Dienstverhältnis umgewandelt. Voraussetzungen für die Beförderung waren (zumindest in der kurbayerischen Armee) richtige Religionszugehörigkeit (oder die Konversion), Kompetenz (Anciennität und Leistung), finanzielle Mittel (die Aufstellung eines Fußregiments verschlang 1631 in der Anlaufphase ca. 135.000 fl.) und Herkunft bzw. verwandtschaftliche Beziehungen (Protektion). Der Obrist ernannte die Offiziere. Als Chef eines Regiments übte er nicht nur das Straf- und Begnadigungsrecht über seine Regimentsangehörigen aus, sondern er war auch Inhaber einer besonderen Leibkompanie, die ein Kapitänleutnant als sein Stellvertreter führte. Ein Obrist erhielt in der Regel einen Monatssold von 500-800 fl. je nach Truppengattung. Daneben bezog er Einkünfte aus der Vergabe von Offiziersstellen. Weitere Einnahmen kamen aus der Ausstellung von Heiratsbewilligungen, aus Ranzionsgeldern – 1/10 davon dürfte er als Kommandeur erhalten haben – , Verpflegungsgeldern, Kontributionen, Ausstellung von Salvagardia-Briefen – die er auch in gedruckter Form gegen entsprechende Gebühr ausstellen ließ – und auch aus den Summen, die dem jeweiligen Regiment für Instandhaltung und Beschaffung von Waffen, Bekleidung und Werbegeldern ausgezahlt wurden. Da der Sold teilweise über die Kommandeure ausbezahlt werden sollten, behielten diese einen Teil für sich selbst oder führten „Blinde“ oder Stellen auf, die aber nicht besetzt waren. Auch ersetzten sie zum Teil den gelieferten Sold durch eine schlechtere Münze. Zudem wurde der Sold unter dem Vorwand, Ausrüstung beschaffen zu müssen, gekürzt oder die Kontribution unterschlagen. Vgl. BELLINCKHAUSEN; TEGEDER; KREIENBRINK, der osnabrugischen handlung, S. 277: „Wir burger mußen alle wochen unse contribution zahlen, die obristen nehmmens geldt zu sich, und die gemeinen soldaten mußen hunger leyden“. Der Austausch altgedienter Soldaten durch neugeworbene diente dazu, ausstehende Soldansprüche in die eigene Tasche zu stecken. Zu diesen „Einkünften“ kamen noch die üblichen „Verehrungen“, die mit dem Rang stiegen und nicht anderes als eine Form von Erpressung darstellten, und die Zuwendungen für abgeführte oder nicht eingelegte Regimenter („Handsalben“) und nicht in Anspruch genommene Musterplätze; abzüglich allerdings der monatlichen „schwarzen“ Abgabe, die jeder Regimentskommandeur unter der Hand an den Generalleutnant oder Feldmarschall abzuführen hatte; Praktiken, die die obersten Kriegsherrn durchschauten. Zudem erbte er den Nachlass eines ohne Erben und Testament verstorbenen Offiziers. Häufig stellte der Obrist das Regiment in Klientelbeziehung zu seinem Oberkommandierenden auf, der seinerseits für diese Aufstellung vom Kriegsherrn das Patent erhalten hatte. Der Obrist war der militärische ‚Unternehmer‘, die eigentlich militärischen Dienste wurden vom Major geführt. Das einträgliche Amt – auch wenn er manchmal „Gläubiger“-Obrist seines Kriegsherrn wurde – führte dazu, dass begüterte Obristen mehrere Regimenter zu errichten versuchten (so verfügte Werth zeitweise sogar über 3 Regimenter), was Maximilian I. von Bayern nur selten zuließ oder die Investition eigener Geldmittel von seiner Genehmigung abhängig machte. Im April 1634 erging die kaiserliche Verfügung, dass kein Obrist mehr als ein Regiment innehaben dürfe; ALLMAYER-BECK; LESSING, Kaiserliche Kriegsvölker, S. 72. Die Möglichkeiten des Obristenamts führten des Öfteren zu Misshelligkeiten und offenkundigen Spannungen zwischen den Obristen, ihren karrierewilligen Obristleutnanten (die z. T. für minderjährige Regimentsinhaber das Kommando führten; KELLER, Drangsale, S.388) und den intertenierten Obristen, die auf Zeit in Wartegeld gehalten wurden und auf ein neues Kommando warteten. Zumindest im schwedischen Armeekorps war die Nobilitierung mit dem Aufstieg zum Obristen sicher. Zur finanziell bedrängten Situation mancher Obristen vgl. dagegen OMPTEDA, Die von Kronberg, S. 555. Da der Obrist auch militärischer Unternehmer war, war ein Wechsel in die besser bezahlten Dienste des Kaisers oder des Gegners relativ häufig. Der Regimentsinhaber besaß meist noch eine eigene Kompanie, so dass er Obrist und Hauptmann war. Auf der Hauptmannsstelle ließ er sich durch einen anderen Offizier vertreten. Ein Teil des Hauptmannssoldes floss in seine eigenen Taschen. Ertragreich waren auch Spekulationen mit Grundbesitz oder der Handel mit (gestohlenem) Wein (vgl. BENTELE, Protokolle, S. 195), Holz, Fleisch oder Getreide. II. Manchmal meint die Bezeichnung „Obrist“ in den Zeugnissen nicht den faktischen militärischen Rang, sondern wird als Synonym für „Befehlshaber“ verwandt. Vgl. KAPSER, Heeresorganisation, S. 101ff.; REDLICH, German military enterpriser; DAMBOER, Krise; WINKELBAUER, Österreichische Geschichte Bd. 1, S. 413ff.
[3] Generalquartiermeister: Der Generalquartiermeister leitete das Quartieramt (mit zwei Oberquartiermeistern und dem Stabsquartiermeister sowie drei weiteren Offizieren), unterstützt von der Kriegskanzlei. Die Eingänge wurden dem Feldmarschall vorgetragen und die Antwortschreiben dementsprechend zur Billigung vorgelegt. Für technische Fragen wurden Ingenieure des Stabs herangezogen. Die mündliche Befehlsübermittlung oblag zwei bis vier Generaladjutanten. Das Quartieramt lieferte je nach Eingang Berichte an den Kaiser, den Hofkriegsrat, Weisungen an die Kommandeure der Feldarmeen, an die örtlichen Kommandeure und Festungskommandeure, an alle zuständigen Verwaltungsbehörden und gab Lageberichte an hohe abwesende Generäle und Nachrichten an die Gesandten des Westfälischen Friedenskongresses heraus. Der Generalquartiermeister hatte als Dienstvorgesetzter alle Quartiermeister der einzelnen Regimenter unter sich, sein Amt war eine sehr lukrative Einnahmequelle wegen der „Verehrungen“, um Einquartierungen (gerade bei den Winterquartieren) abzuwenden oder zu erleichtern. Zudem war er meist auch Inhaber eines eigenen Regiments, das die besten Quartiere zu erwarten hatte.
[4] Vgl. BARKER, Piccolomini. Eine befriedigende Biographie existiert trotz des reichhaltigen Archivmaterials bis heute nicht. Hingewiesen sei auf die Arbeiten von ELSTER (=> Literaturregister).
[5] BADURA; KOČĺ, Der große Kampf, Nr. 548.
[6] Vgl. HENGERER, Kaiser Ferdinand III.; HÖBELT, Ferdinand III.
[7] Pressburg [Bratislava, ungarisch Pozsony].
[8] BADURA; KOČĺ, Der große Kampf, Nr. 572.
[9] Rheinfelden (Baden) [LK Lörrach]; HHSD VI, S. 659. 21.2./3.3.1638: Doppelschlacht bei Rheinfelden: Herzog Bernhard von Sachsen-Weimar schlägt die Kaiserlichen unter Savelli und Johann von Werth. Sperreuter, Werth und Savelli geraten in Gefangenschaft.
[10] Aachen; HHSD III, S. 1ff.
[11] Köln; HHSD III, S. 403ff.
[12] Vgl. FOERSTER, Kurfürst Ferdinand von Köln.
[13] Stablo [Stavelot; Belgien, Prov. Lüttich].
[14] BADURA; KOČĺ, Der große Kampf, Nr. 575.
[15] Vgl. ANGERER, Aus dem Leben des Feldmarschalls Johann Graf von Götz.
[16] Lüttich [Liège; Belgien].
[17] Maastricht [Niederlande, Provinz Limburg]
[18] BADURA; KOČĺ, Der große Kampf, Nr. 578.
[19] BADURA; KOČĺ, Der große Kampf, Nr. 655.
[20] St. Georgen im Schwarzwald [LK Schwarzwald-Baar-Kreis].
[21] KRUSENSTJERN, Selbstzeugnisse, S. 93f. Vgl. auch SCHULZ, Strafgericht.
[22] Gutenberg, heute Ortsteil v. Lenningen [LK Esslingen].
[23] STEMMLER, Tagebuch Bd. 2, S. 775 (2. Auflage 1984, heute noch erhältlich bei Stabsstelle Archiv von 79002 Villingen-Schwenningen).
[24] BADURA; KOČĺ, Der große Kampf, Nr. 724.
[25] Werbung: Der jeweilige Kriegsherr schloss mit einem erfahrenen Söldner (Obrist, Obristleutnant, Hauptmann) einen Vertrag (das sogenannte „Werbepatent“), in dem er ihn eine festgelegte Anzahl von Söldnern anwerben ließ. Dafür wurde ihm einer der von Städten und Territorien wegen der Ausschreitungen gefürchteten „Musterplätze“ angewiesen. Zudem erhielt der Werbeherr eine vereinbarte Geldsumme, mit der er die Anwerbung und den Sold der Geworbenen bezahlen sollte (vgl. „Werbegeld“). Manchmal stellte der Werbende auch Eigenmittel zur Verfügung, beteiligte sich so an der Finanzierung und wurde zum „Gläubiger-Obristen“ des Kriegsherrn. Zudem war der Werbeherr zumeist Regimentsinhaber der angeworbenen Truppen, was ihm zusätzliche beträchtliche Einnahmen verschaffte. Manche Rekruten wurden von den Werbeoffizieren doppelt gezählt oder unerfahrene, z. T. invalide und mangelhaft ausgerüstete Männer als schwerbewaffnete Veteranen geführt, um vom Obristen eine höhere Summe ausgezahlt zu erhalten. Auch Hauptleute, meist adliger Herkunft, stellten Kompanien oder Fähnlein auf eigene Kosten dem Kriegsherrn bzw. einem Obristen zur Verfügung, um dann in möglichst kurzer Zeit ihre Aufwendungen wieder hereinzuholen und noch Gewinne zu erzielen, was zu den üblichen Exzessen führen musste. Teilweise wurde die Anwerbung auch erschlichen oder erzwungen. Auf der Straße eingefangene Handwerker wurden für Wochen ins Stockhaus gesteckt und durch die Erschießung von Verweigerern zum Dienst gezwungen; SODEN, Gustav Adolph II, S. 508. In einem Bericht aus Wien (Dezember 1634) heißt es: „Aus Schwaben und Bayern kommen wegen der großen Hungersnoth viele tausend Menschen auf der Donau herab, so dass man immer von Neuem werben und die Regimenter complettiren kann“. SODEN, Gustav Adolph III, S. 129. JORDAN, Mühlhausen, S. 90f. (1637) über den Werbeplatz Sporcks: „Den 4. April ist er wieder mit etlichen Völkern zurückgekommen und hat sich mit denselben hier einquartiret und seinen Werbeplatz hier gehabt, hat auch viel Volk geworben, wie denn die Eichsfelder und andere benachbarte häufig zuliefen und Dienst nahmen, nur ass sie ins Quartier kamen und die Leute aufzehren konnte. Viele trieb auch der Hunger. Als es aber ans Marchiren gehen sollte, so wurde aus dem Marchiren ein Desertieren“. Für Anfang 1643 heißt es über die Werbemethoden des schwedischen Kommandanten in Erfurt, Caspar Ermes; JORDAN, Mühlhausen, S. 97: „In diesem Jahre legte abermals der Commandant von Erfurt einen Capitän mit einer Compagnie Infanterie in die Stadt, um Soldaten zu werben. Weil sie aber nicht viel Rekruten bekamen, so machten sie einen listigen Versuch. Sie warfen Geld in die Straße; wenn nun jemand kam und es aufhob, so sagten sie, er hätte Handgeld genommen, er müsse nun Soldat werden. Im Weigerungsfalle steckten sie solchen Menschen in den Rabenturm, wo er so lange mit Wasser und Brod erhalten wurde, bis er Soldat werden wollte“. Vgl. RINKE, Lippe, S. 20f.; PLATH, Konfessionskampf, S. 482.
[26] BADURA; KOČĺ, Der große Kampf, Nr. 771; Kulmbach; HHSD VII, S. 379f.
[27] Hildesheim; HHSD II, S. 228ff. Zu den Kriegsereignissen in Hildesheim vgl. auch PLATHE, Konfessionskampf.
[28] Regiment: Größte Einheit im Heer: Für die Aufstellung eines Regiments waren allein für Werbegelder, Laufgelder, den ersten Sold und die Ausrüstung 1631 bereits ca. 135.000 fl. notwendig. Zum Teil wurden die Kosten dadurch aufgebracht, dass der Obrist Verträge mit Hauptleuten abschloss, die ihrerseits unter Androhung einer Geldstrafe eine bestimmte Anzahl von Söldnern aufbringen mussten. Die Hauptleute warben daher Fähnriche, Kornetts und Unteroffiziere an, die Söldner mitbrachten. Adlige Hauptleute oder Rittmeister brachten zudem Eigenleute von ihren Besitzungen mit. Wegen der z. T. immensen Aufstellungskosten kam es vor, dass Obristen die Teilnahme an den Kämpfen mitten in der Schlacht verweigerten, um ihr Regiment nicht aufs Spiel zu setzen. Der jährliche Unterhalt eines Fußregiments von 3000 Mann Soll-Stärke wurde mit 400- 450.000 fl., eines Reiterregiments von 1200 Mann mit 260.-300.000 fl. angesetzt. Zu den Soldaufwendungen für die bayerischen Regimenter vgl. GOETZ, Kriegskosten Bayerns, S. 120ff.; KAPSER, Kriegsorganisation, S. 277ff. Ein Regiment zu Fuß umfasste de facto bei den Kaiserlichen zwischen 650 und 1.100, ein Regiment zu Pferd zwischen 320 und 440, bei den Schweden ein Regiment zu Fuß zwischen 480 und 1.000 ((offiziell 1.200 Mann), zu Pferd zwischen 400 und 580 Mann, bei den Bayerischen 1 Regiment zu Fuß zwischen 1.250 und 2.350, 1 Regiment zu Roß zwischen 460 und 875 Mann. Das Regiment wurde vom Obristen aufgestellt, von dem Vorgänger übernommen und oft vom seinem Obrist-Leutnant geführt. Über die Ist-Stärke eines Regiments lassen sich selten genaue Angaben finden. Das kurbrandenburgische Regiment Carl Joachim von Karberg [Kerberg] sollte 1638 sollte auf 600 Mann gebracht werden, es kam aber nie auf 200. Karberg wurde der Prozess gemacht, er wurde verhaftet und kassiert; OELSNITZ, Geschichte, S. 64. Als 1644 der kaiserliche Generalwachtmeister Johann Wilhelm von Hunolstein die Stärke der in Böhmen stehenden Regimenter feststellen sollte, zählte er 3.950 Mann, die Obristen hatten 6.685 Mann angegeben. REBITSCH, Gallas, S. 211; BOCKHORST, Westfälische Adlige.
[29] Erfurt; HHSD IX, S. 100ff.
[30] Kontribution: Kriegssteuer, die ein breites Spektrum an Sach- oder Geldleistungen umfasste, wurden im Westfälischen als „Raffgelder“ bezeichnet; SCHÜTTE, Dreißigjähriger Krieg, Nr. 45, S. 127; LEHMANN, Kriegschronik, S. 34, Anm. (1632): „Contribution eine große straffe, Sie erzwingt alles, was sonst nicht möglich ist“. Sie wurde auf Grundlage einer Abmachung zwischen Lokalbehörden (zumeist Städten) und Militärverwaltung erhoben. Die Kontribution wurde durch speziell geschultes, z. T. korruptes Personal (vgl. WAGNER; WÜNSCH, Gottfried Staffel, S. 122ff.) zumeist unter Androhung militärischer Gewalt oder unter Androhung des Verlusts des Bürgerrechts, des Braurechts, der Benutzung der Allmende, den säumigen Bürgern „das Handwerk zu legen“ etc. (vgl. NÜCHTERLEIN, Wernigerode), und der Zunagelung der Haustüren (JORDAN, Mühlhausen, S. 76 (1633)) eingetrieben. Den Zahlenden wurde als Gegenleistung Schutz gegen die Übergriffe des Gegners in Aussicht gestellt. Nicht selten mussten an die beiden kriegführenden Parteien Kontributionen abgeführt werden, was die Finanzkraft der Städte, Dörfer und Herrschaften sehr schnell erschöpfen konnte. Auch weigerte sich z. T. die Ritterschaft wie im Amt Grimma erfolgreich, einen Beitrag zu leisten; LORENZ, Grimma, S. 667. Vgl. REDLICH, Contributions; ORTEL, Blut Angst Threnen Geld, der diese Euphemismen für Erpressungen, erwartete oder erzwungene „Verehrungen“ etc. auflistet. BELLINCKHAUSEN; TEGEDER; KREIENBRINK, der osnabrugischen handlung, S. 268, über die schwedische Einquartierung Dezember 1633 in Osnabrück: Die Soldaten „sagen und klagen, sie bekommen kein geld, da doch stets alle wochen die burger ihr contribution ausgeben mußen, dan das kriegsvolck sagt, das ihr obristen und befehlhaber das geldt zu sich nehmmen und sie mußenn hunger und kummer haben, werden zum stehlen verursacht“ Die ausführlichste Darstellung der Erpressung von Kontributionen durch Besatzungstruppen findet sich bei NÜCHTERLEIN, Wernigerode, S. 73ff. => Hrastowacky.
[31] Dragoner (frz. dragon): leichter Reiter, der auch zu Fuß focht, benannt nach den mit Drachenkopf (dragon) verzierten Reiterpistolen, nach KEITH, Pike and Shot Tactics, S. 24, aus dem Holländischen „dragen“ bzw. „tragen“. Der Dragoner war ein berittener Infanterist (der zum Gefecht absaß), da das Pferd zu schlecht war, um mit der Kavallerie ins Gefecht reiten zu können. Berneck, Geschichte der Kriegskunst, S. 136. Auch äußerlich war der Dragoner nicht vom Infanteristen zu unterscheiden. Zudem verfügte in der schwedischen Armee 1631/32 etwa nur die Hälfte der Dragoner überhaupt über ein Pferd. Oft saßen daher zwei Dragoner auf einem Pferd. Falls überhaupt beritten, wurden die Dragoner als Vorhut eingesetzt, um die Vormarschwege zu räumen und zu sichern. Zum Teil wurden unberittene Dragoner-Einheiten im Kampf auch als Musketiere eingesetzt. „Arbeiter zu Pferd“ hat man sie genannt. Eine Designation vom 13.7.1643 über die Verwendung des Werbegeldes bzw. die Abrechnung für einen Dragoner stellt 44 Gulden 55 Kreuzer in Rechnung. Vgl. WALLHAUSEN, Kriegs-Kunst zu Pferd.
[32] Hann. Münden; HHSD II, S. 333f.
[33] Duderstadt [LK Göttingen]; HHSD II, S. 123f.
[34] [Bad] Salzungen [Wartburgkreis]; HHSD IX, S. 36ff.
[35] Fulda; HHSD IV, S. 154ff.
[36] Gleichenstein, Burg [Kreis Eichsfeld]; HHSD IX, S. 147.
[37] Rusteberg [Kreis Eichsfeld], HHSD IX, S. 365f.
[38] Heiligenstadt [Kreis Eichsfeld]; HHSD IX, S. 186ff.
[39] Akkord: Übergabe, Vergleich, Vertrag; Vergleichsvereinbarungen über die Übergabebedingungen bei Aufgabe einer Stadt oder Festung sowie bei Festsetzung der Kontributionen und Einquartierungen durch die Besatzungsmacht. Angesichts der Schwierigkeiten, eine Stadt oder Festung mit militärischer Gewalt einzunehmen, versuchte die militärische Führung zunächst, über die Androhung von Gewalt zum Erfolg zu gelangen. Ergab sich eine Stadt oder Festung daraufhin ‚freiwillig‘, so wurden ihr gemilderte Bedingungen (wie die Verschonung von Plünderungen) zugebilligt. Garnisonen zogen in der Regel gegen die Verpflichtung ab, die nächsten sechs Monate keine Kriegsdienste beim Gegner zu leisten. Zumeist wurden diese Akkorde vom Gegner unter den verschiedensten Vorwänden bzw. durch die Undiszipliniertheit ihrer Truppen nicht eingehalten.
[40] THEATRUM EUROPAEUM Bd. 4, S. 79f.
[41] Kürassier: Kürisser, Kyrisser, Corazzen (franz. Cuirasse für Lederpanzer (cuir = Leder). Die Kürassiere waren die älteste, vornehmste – ein gerade daher unter Adligen bevorzugtes Regiment – und am besten besoldete Waffengattung. Sie gehörten zu den Eliteregimentern, der schweren Reiterei, deren Aufgabe im Gefecht es war, die feindlichen Linien zu durchbrechen, die Feinde zur Flucht zu nötigen und damit die Schlacht zu entscheiden. Sie trugen einen geschwärzten Trabharnisch (Brust- und Rückenharnisch, den „Kürass“), Ober- und Unterarmzeug, eiserne Stulphandschuhe, Beinschienen und Stulpstiefel mit Sporen, Schwert oder Säbel und zwei lange Reiterpistolen, die vor dem Aufsitzen gespannt wurden. Im späten 16. Jahrhundert wurde es in der schweren Reiterei üblich, einen knielangen Küriss ohne Unterbeinzeug zu tragen. Der Kürass wurde mit 15 Rt. veranschlagt. SKALA, Kürassiere; WALLHAUSEN, Kriegs-Kunst zu Pferd. Nach LICHTENSTEIN, Schlacht, S. 42f., musste ein dänischer Kürassier mit einem mindestens16 „Palmen“ [1 Palme = 8, 86 cm] hohen Pferd, Degen u. Pistolen antreten. Der Kürass kostete ihn 15 Rt. Er durfte ein kleineres Gepäckpferd u. einen Jungen mitbringen. Der Arkebusier hatte ebenfalls Pferd, Degen u. Pistolen mitzubringen, durfte aber ein 2. Pferd nur halten, wenn er v. Adel war. Für Brust- u. Rückenschild musste er 11 Rt. zahlen. Der Infanterist brachte den Degen mit u. ließ sich für das gelieferte Gewehr einen Monatssold im ersten halben Jahr seines Dienstes abziehen. Bei der Auflösung des Regiments erhielten die Soldaten sämtl. Waffen mit einem Drittel des Ankaufspreises vergütet, falls der Infanterist noch nicht 6 Monate, der Kavallerist noch nicht 10 Monate gedient hatte; andernfalls mussten sie die Waffen ohne jede Vergütung abliefern. Der Kürassier erhielt für sich u. seinen Jungen täglich 2 Pfd. Fleisch, 2 Pfd. Brot, 1/8 Pfd. Butter oder Käse u. 3 „Pott“ [1 Pott = 4 Glas = 0, 96 Liter] Bier. Arkebusier u. Infanterist bekamen die Hälfte. Die tägliche Ration betrug 12 Pfd. Heu, Gerste oder Hafer je nach den Vorräten. An das Kommissariat musste der Kürassier für Portion u. Ration monatlich 7 Rt., an den Wirt im eigenen oder kontribuierenden Land musste der Kürassier 5, der Unteroffizier 4, der Sergeant 3, Arkebusier u. Infanterist 2 1/2 Rt. zahlen. Im besetzten Land, das keine Kontributionen aufbrachte, wurde ohne Bezahlung requiriert. Ein Teil des Handgeldes wurde bis zum Abschied zurückbehalten, um Desertionen zu verhüten, beim Tode wurde der Teil an die Erben ausbezahlt. Kinder u. Witwen bezogen einen sechsmonatlichen Sold. Zu den schwedischen Kürassierregimentern vgl. die Bestimmungen in der Kapitulation für Efferen, Adolf Theodor [Dietrich], genannt Hall => „Miniaturen“. Des Öfteren wurden Arkebusierregimenter in Kürassierregimenter umgewandelt, falls die notwendigen Mittel vorhanden waren.
[42] Würzburg; HHSD VII, S. 837ff.
[43] Vgl. HENGERER, Kaiser Ferdinand III.; HÖBELT, Ferdinand III.
[44] Ungarn: Schriftlich erwähnt werden „hussarones“ (ursprünglich Grenzsoldaten in den ungarischen Festungen) erstmals 1481 in einem lateinischen Schreiben des Ungarnkönigs Matthias Corvinus (1443-1490). Die Husaren hatten sich bereits zu schwer gepanzerten Reitern entwickelt. Sie trugen Helme im türkischen Stil (Zischäggen), Brust- und Armpanzer, mit Eisenblech beschlagene Schilde (bezeichnet als „Tartschen“), schwere Säbel (Sarrass), Streitkolben und Lanzen, außerdem einen Panzerstecher (hegyestőr, „Pikenschwert“). Falls die Lanze beim ersten Ansturm brach, wurde dieses drei- oder vierkantige Schwert mit einer etwa 150 cm langen Klinge auf den Oberschenkel gesetzt und als Stoßwaffe benutzt. Zur zeitgenössischen Einschätzung vgl. REISNER, Aber auch wie voriges tags, S. 456f. (1619): „Es ist zwar ein außerlesen schön ungerisches Kriegsvolckh, aber auch außerlesene Freybeutter; so mit stelen und rauben niemand verschonen; lassen nichts liegen, ziehen die leutt – freund oder feind – ganz nacket auß oder hawens wol gar nieder“. Eine ganz ähnliche Klage findet sich auch in dem Wiener Bericht vom 27. Oktober [1619]: „Die Hungern haußen gar übel auch bei den Evangelischen sine omni discretione, hauen alles nieder, plündern und verbrennen alles, so erbärmlich ist; wann sie alßo procediren, möchte waß anderst drauß entstehen“.
[45] Kroaten: (kroatische Regimenter in kaiserlichen und kurbayerischen Diensten), des „Teufels neuer Adel“, wie sie Gustav II. Adolf genannt hatte (GULDESCU, Croatian-Slavonian Kingdom, S. 130). Mit der (älteren) Bezeichnung „Crabaten“ (Crawaten = Halstücher) wurden die kroatischen Soldaten, die auf ihren Fahnen einen Wolf mit aufgesperrtem Rachen führten führten [vgl. REDLICH, De Praeda Militari, S. 21], mit Grausamkeiten in Verbindung gebracht, die von „Freireutern“ verübt wurden. „Freireuter“ waren zum einen Soldaten beweglicher Reiterverbände, die die Aufgabe hatten, über Stärke und Stellung des Gegners sowie über günstige Marschkorridore und Quartierräume aufzuklären. Diese Soldaten wurden außerdem zur Verfolgung fliehender, versprengter oder in Auflösung begriffener feindlicher Truppen eingesetzt. Diese Aufgabe verhinderte eine Überwachung und Disziplinierung dieser „Streifparteyen“ und wurde von diesen vielfach dazu genutzt, auf eigene Rechnung Krieg zu führen. Zum anderen handelte es sich bei „Freireutern“ um bewaffnete und berittene Bauern, die über Raubzüge Verwirrung hinter den feindlichen Linien schufen. Sie taten dies entweder mit Erlaubnis ihrer Kommandierenden, als integraler Bestandteil der kaiserlichen Kriegsführung, oder aber unerlaubter Weise – nicht ohne dabei z. T. drakonische Strafen zu riskieren. Diese „Freireuter“ stahlen und plünderten auf Bestellung der eigenen Kameraden sowie der Marketender, die ihrerseits einen Teil ihrer Einnahmen an die Obristen und Feldmarschälle abzuführen hatten. An Schlachten nahmen sie in der Regel nicht teil oder zogen sogar auch in der Schlacht ab. Zudem war „Kroaten“ ein zeitgenössischer Sammelbegriff für alle aus dem Osten oder Südosten stammenden Soldaten. Ihre Bewaffnung bestand aus Arkebuse, Säbel (angeblich „vergiftet“; PUSCH, Episcopali, S. 137; MITTAG, Chronik, S. 359, wahrscheinlich jedoch Sepsis durch den Hieb) und Dolch sowie meist 2 Reiterpistolen. Jeder fünfte dieser „kahlen Schelme Ungarns“ war zudem mit einer Lanze bewaffnet. SCHUCKELT, Kroatische Reiter; GULDESCU, Croatian-Slavonian Kingdom. Meist griffen sie Städte nur mit Überzahl an. Die Hamburger „Post Zeitung“ berichtete im März 1633: „Die Stadt Hoff haben an vergangenen Donnerstag in 1400. Crabaten in Grundt außgeplündert / vnnd in 18000 Thaller werth schaden gethan / haben noch sollen 1500. fl. geben / dass sie der Kirchen verschonet / deßwegen etliche da gelassen / die andern seind mit dem Raub darvon gemacht“. MINTZEL, Stadt Hof, S. 101. Zur Grausamkeit dieser Kroatenregimenter vgl. den Überfall der Kroaten Isolanis am 21.8.1634 auf Höchstädt (bei Dillingen) THEATRUM EUROPAEUM Bd. 3, S. 331f.; bzw. den Überfall auf Reinheim (Landgrafschaft Hessen-Darmstadt) durch die Kroaten des bayerischen Generalfeldzeugmeisters Jost Maximilian von Gronsfelds im Mai 1635: HERRMANN, Aus tiefer Not, S. 148ff.; den Überfall auf Reichensachsen 1635: GROMES, Sontra, S. 39: „1634 Christag ist von uns (Reichensächsern) hier gehalten, aber weil die Croaten in der Christnacht die Stadt Sontra überfallen und in Brand gestecket, sind wir wieder ausgewichen. Etliche haben sich gewagt hierzubleiben, bis auf Sonnabend vor Jubilate, da die Croaten mit tausend Pferden stark vor Eschwege gerückt, morgens von 7-11 Uhr mittags mit den unsrigen gefochten, bis die Croaten gewichen, in welchem Zurückweichen die Croaten alles in Brand gestecket. Um 10 Uhr hats in Reichensachsen angefangen zu brennen, den ganzen Tag bis an den Sonntags Morgen in vollem Brande gestanden und 130 Wohnhäuser samt Scheuern und Ställen eingeäschert. Von denen, die sich zu bleiben gewaget, sind etliche todtgestoßen, etlichen die Köpfe auf den Gaßen abgehauen, etliche mit Äxten totgeschlagen, etliche verbrannt, etliche in Kellern erstickt, etliche gefangen weggeführet, die elender gewesen als die auf der Stelle todt blieben, denn sie sind jämmerlich tractirt, bis man sie mit Geld ablösen konnte“. LEHMANN, Kriegschronik, S. 61, anlässlich des 2. Einfall Holks in Sachsen (1632): „In Elterlein haben die Crabaten unmanbare Töchter geschendet und auf den Pferden mit sich geführet, in und umb das gedreid, brod, auf die Bibel und bücher ihren mist auß dem hindern gesezt, In der Schletta [Schlettau] 21 bürger beschediget, weiber und Jungfern geschendet“. LANDAU, Beschreibung, S. 302f. (Eschwege 1637). Auf dem Höhepunkt des Krieges sollen über 20.000 Kroaten in kaiserlichen Diensten gestanden haben. In einem Kirchturmknopf in Ostheim v. d. Rhön von 1657 fand sich ein als bedeutsam erachteter Bericht für die Nachgeborenen über den Einfall kroatischer Truppen 1634; ZEITEL, Die kirchlichen Urkunden, S. 219-282, hier S. 233-239 [Frdl. Hinweis von Hans Medick, s. a. dessen Aufsatz: Der Dreißigjährige Krieg]. Vgl. BAUER, Glanz und Tragik; neuerdings KOSSERT, „daß der rothe Safft hernach gieng…“ http://home.arcor.de/sprengel-schoenhagen/2index/30jaehrigekrieg.htm: „Am grauenhaftesten hatte in dieser Zeit von allen Städten der Prignitz Perleberg zu leiden. Die Kaiserlichen waren von den Schweden aus Pommern und Mecklenburg gedrängt worden und befanden sich auf ungeordnetem Rückzug nach Sachsen und Böhmen. Es ist nicht möglich, alle Leiden der Stadt hier zu beschreiben.
Am ehesten kann man sich das Leid vorstellen, wenn man den Bericht des Chronisten Beckmann über den 15. November 1638 liest: ‚… Mit der Kirche aber hat es auch nicht lange gewähret, sondern ist an allen Ecken erstiegen, geöffnet und ganz und gar, nicht allein was der Bürger und Privatpersonen Güter gewesen, besonders aber auch aller Kirchenschmuck an Kelchen und was dazu gehöret, unter gotteslästerlichen Spottreden ausgeplündert und weggeraubet, auch ein Bürger an dem untersten Knauf der Kanzel aufgeknüpfet, die Gräber eröffnet, auch abermals ganz grausam und viel schlimmer, als je zuvor mit den Leuten umgegangen worden, indem sie der abscheulichen und selbst in den Kirchen frevelhafter und widernatürlicher Weise verübten Schändung des weiblichen Geschlechts, selbst 11- und 12-jähriger Kinder, nicht zu gedenken – was sie nur mächtig (haben) werden können, ohne Unterschied angegriffen, nackt ausgezogen, allerlei faules Wasser von Kot und Mist aus den Schweinetrögen, oder was sie am unreinsten und nächsten (haben) bekommen können, ganze Eimer voll zusammen gesammelt und den Leuten zum Maul, (zu) Nase und Ohren eingeschüttet und solch einen ‚Schwedischen Trunk oder Branntwein’ geheißen, welches auch dem damaligen Archidiakonus… widerfahren. Andern haben sie mit Daumschrauben und eisernen Stöcken die Finger und Hände wund gerieben, andern Mannspersonen die Bärte abgebrannt und noch dazu an Kopf und Armen wund geschlagen, einige alte Frauen und Mannsleute in Backöfen gesteckt und so getötet, eine andere Frau aus dem Pfarrhause in den Rauch gehängt, hernach wieder losgemacht und durch einen Brunnenschwengel in das Wasser bis über den Kopf versenket; andere an Stricken, andere bei ihren Haaren aufgehängt und so lange, bis sie schwarz gewesen, sich quälen lassen, hernach wieder losgemacht und andere Arten von Peinigung mit Schwedischen Tränken und sonsten ihnen angeleget. Und wenn sie gar nichts bekennen oder etwas (haben) nachweisen können, Füße und Hände zusammen oder die Hände auf den Rücken gebunden und also liegen lassen, wieder gesucht, und soviel sie immer tragen und fortbringen können, auf sie geladen und sie damit auf Cumlosen und andere Dörfer hinausgeführt, worüber dann viele ihr Leben (haben) zusetzen müssen, daß auch der Rittmeister der Salvegarde und andere bei ihm Seiende gesagt: Sie wären mit bei letzter Eroberung von Magdeburg gewesen, (es) wäre aber des Orts so tyrannisch und gottlos mit den Leuten, die doch ihre Feinde gewesen, nicht umgegangen worden, wie dieses Orts geschehen’ „.
[46] BADURA; KOČĺ, Der große Kampf, Nr. 811.
[47] KRUSENSTJERN, Selbstzeugnisse, S. 111f.
[48] Greußen [Kyffhäuserkreis].
[49] Clingen [Kyffhäuserkreis].
[50] Westgreußen [Kyffhäuserkreis].
[51] HAPPE II 265 r – 266 v; mdsz.thulb.uni-jena.de.
[52] Großenehrich [Kyffhäuserkreis].
[53] Wenigenehrich [Kyffhäuserkreis].
[54] Rohnstedt [Kyffhäuserkreis].
[55] Ebeleben [Kyffhäuserkreis].
[56] Heringen [Kreis Nordhausen].
[57] Großmehlra [Unstrut-Hainich-Kreis].
[58] Holzthaleben [Kyffhäuserkreis].
[59] HAPPE II 268 v – 269 r; mdsz.thulb.uni-jena.de.
[60] Montmédy [Frankreich; Dép. Meuse].
[61] Thionville [Span. Niederlande, heute Dép. Moselle; Frankreich].
[62] Quesnoy [Le Quesnoy; Frankreich, Dép. Nord].
[63] Avesnes-Chaussoy [Frankreich, Dép. Somme].
[64] Guise [Frankreich; Dép. Aisne].
[65] Hesdin [Frankreich; Dép. Pas-de-Calais].
[66] Durlan [Frankreich; Dép. ?]: nicht identifiziert.
[67] BADURA; KOČĺ, Der große Kampf, Nr. 864.
[68] Givet [a. d. Maas; Frankreich, Dép. Ardennes].
[69] Charlemont [Ortsteil von Givet an der Maas, Belgien].
[70] Philippeville [Belgien; Provinz Namur].
[71] Marienbourg [Belgien; Provinz Namur].
[72] Metz, Bistum u. Stadt, [Frankreich; Dép. Moselle].
[73] Verdun [Frankreich, Dép. Meuse].
[74] Mouzon [Frankreich; Dép. Ardennes].
[75] BADURA; KOČĺ, Der große Kampf, Nr. 876; Juois [im ehemaligen Herzogtum Luxemburg, am Fluss Chiers].
[76] Schüttenhofen [Sušice, Bez. Klattau]; HHSBöhm, S. 558.
[77] Arkebusier: Leichter, mit einer Arkebuse bewaffneter Reiter, eigentlich berittener Infanterist (der zum Gefecht absaß). Die Arkebuse (später Karabiner genannt) war ein kurzes Gewehr, eine Waffe für bis zu über 100 g schwere Kugeln, die in freiem Anschlag verwendbar war; bei der Infanterie als Handrohr, Büchse oder Arkebuse, bei der Kavallerie als Karabiner oder Faustrohr (Pistole mit Radschloss). Sie erhielt ihren Namen vom hakenförmigen Hahn der Luntenklemme, der das Pulver in der Zündpfanne entzündete. Gerüstet war der Arkebusier mit einem Kürass aus schussfreiem Brust- und Rückenstück (dieses wurde mit 11 Rt. veranschlagt) oder auch nur dem Bruststück. Seitenwehr war ein kurzer Haudegen, in den Sattelhalftern führte er 1 – 2 Pistolen. Er wurde zumeist in kleineren Gefechten oder für Kommandounternehmen eingesetzt. In den Schlachten sollten sie die Flanken der eigenen angreifenden Kürassiere decken und in die von ihnen geschlagenen Lücken eindringen. Er erhielt als Verpflegung die Hälfte dessen, was dem Kürassier zustand, zudem auch weniger Sold. Vgl. ENGERISSER, Von Kronach nach Nördlingen, S. 464 ff. Des öfteren wurden Arkebusierregimenter, wenn die Mittel vorhanden waren, in Kürassierregimenter umgewandelt.
[78] BADURA; KOČĺ, Der große Kampf, Nr. 961.
[79] BADURA; KOČĺ, Der große Kampf, Nr. 970.
[80] Kohljanowitz [Uhlířské Janovice; Bez. Kuttenberg]; HHSBöhm, S. 278f.
[81] Kauřim [Kouřim, Bez. Kolin]; HHSBöhm, S. 257ff.
[82] Kuttenberg [Kutná Hora]; HHSBöhm, S. 307ff.
[83] Janowitz [Janovice, Bez. Freudenthal]; HHSBöhm, S. 226f.
[84] Königgrätz [Hradec Králové]; HHSBöhm, S. 269ff.
[85] Brandeis a. d. Elbe [Brandýs nad Labem, Bez. Prag-Ost]; HHSBöhm, S. 62f.
[86] BADURA; KOČĺ, Der große Kampf, Nr. 971.
[87] BADURA; KOČĺ, Der große Kampf Nr. 977; Kolin [Kolín]; HHSBöhm, S. 280ff.
[88] Jizera (deutsch Iser, polnisch Izera), rechter Nebenfluss der Elbe in Tschechien.
[89] Draschitz [Dražice, Bez. Jungbunzlau];HHSBöhm, S. 115f.
[90] Jung-Bunzlau [Mladá Boleslav]; HHSBöhm, S. 237ff.
[91] Böhmisch Leipa [Česká Lípa]; HHSBöhm, S. 57f.
[92] Melnik [Mělník]; HHSBöhm, S. 370f.
[93] Raudnitz [Roudnice nad Labem, Bez. Leitmeritz]; HHSBöhm, S. 511ff.
[94] Leitmeritz [Litoměřice]; HHSBöhm, S. 324ff.
[95] Böhmisch Aicha [Český Dub, Bez. Reichenberg]; HHSBöhm, S. 44.
[96] Turnau [Turnov, Bez. Semil]; HHSBöhm, S. 633f.
[97] Deutsch Gabel; [Německé Jablonné; seit 1650 Jablonné v Postještě]; HHSBöhm, S. 109f.
[98] Jung-Bunzlau [Mladá Boleslav]; HHSBöhm, S. 237ff.
[99] THEATRUM EUROPAEUM Bd. 4, S. 360.
[99a] JAHNEL, Der dreißigjährige Krieg in Aussig, S. 94.
[100] Allendorf; HHSD IV, S. 33f. [unter Bad Sooden-Allendorf (Kr. Witzenhausen)].
[101] Obristleutnant: Der Obristleutnant war der Stellvertreter des Obristen, der dessen Kompetenzen auch bei dessen häufiger, von den Kriegsherrn immer wieder kritisierten Abwesenheit – bedingt durch Minderjährigkeit, Krankheit, Badekuren, persönliche Geschäfte, Wallfahrten oder Aufenthalt in der nächsten Stadt, vor allem bei Ausbruch von Lagerseuchen – besaß. Meist trat der Obristleutnant als militärischer Subunternehmer auf, der dem Obristen Soldaten und die dazu gehörigen Offiziere zur Verfügung stellte. Verlangt waren in der Regel, dass er die nötige Autorität, aber auch Härte gegenüber den Regimentsoffizieren und Soldaten bewies und für die Verteilung des Soldes sorgte, falls dieser eintraf. Auch die Ergänzung des Regiments und die Anwerbung von Fachleuten oblagen ihm. Zu den weiteren Aufgaben gehörten Exerzieren, Bekleidungsbeschaffung, Garnisons- und Logieraufsicht, Überwachung der Marschordnung, Verproviantierung etc. Der Profos hatte die Aufgabe, hereingebrachte Lebensmittel dem Obristleutnant zu bringen, der die Preise für die Marketender festlegte. Um all diese Aufgaben bewältigen zu können, waren umfangreiche Kenntnisse und Erfahrungen notwendig. Nicht selten lag die eigentliche Führung des Regiments in der Verantwortung eines fähigen Obristleutnants, der im Monat je nach Truppengattung zwischen 120 und 150 fl. bezog. Voraussetzung war allerdings in der bayerischen Armee die richtige Religionszugehörigkeit. Maximilian hatte Tilly den Ersatz der unkatholischen Offiziere befohlen; Bayerisches Hauptstaatsarchiv München Dreißigjähriger Krieg Akten 236, fol. 39′ (Ausfertigung): Maximilian I. an Tilly, München, 1629 XI 04: … „wann man dergleich officiren nit in allen fällen, wie es die unuorsehen notdurfft erfordert, gebrauchen khan und darff: alß werdet ihr euch angelegen sein lassen, wie die uncatholischen officiri, sowol undere diesem alß anderen regimentern nach unnd nach sovil muglich abgeschoben unnd ihre stellen mit catholischen qualificirten subiectis ersezt werden konnde“. Von Piccolomini stammt angeblich der Ausspruch (1642): „Ein teutscher tauge für mehrers nicht alß die Oberstleutnantstell“. HÖBELT, „Wallsteinisch spielen“, S. 285.
[102] Kapitän (schwed. Kapten): Der Hauptmann war ein vom Obristen eingesetzter Oberbefehlshaber eines Fähnleins der Infanterie, das er meist unter Androhung einer Geldstrafe auf eigene Kosten geworben und ausgerüstet hatte. Der Hauptmann warb daher Fähnriche, Kornetts und Unteroffiziere an, die Söldner mitbrachten. Adlige Hauptleute oder Rittmeister brachten zudem Eigenleute von ihren Besitzungen mit. In der Kompanie-Stärke wurden sogenannte „Passevolants“ mitgerechnet, nichtexistente Söldner, deren Sold ihm zustand, wenn er Deserteure und verstorbene Soldaten ersetzen musste. Der monatliche Sold eines Hauptmanns betrug 160 fl. (Nach der Umbenennung des Fähnleins in Kompanie wurde er als Kapitän bezeichnet.) Der Hauptmann war verantwortlich für Werbung und Soldzahlung, für Disziplin, Ausrüstung und Verpflegung sowie für die Ernennung der untergebenen Führer. Er musste die standesgemäße Heirat seiner Untergebenen bewilligen. Oft war er in erster Linie für die materielle Versorgung der Truppe zuständig, und die eigentlich militärischen Aufgaben wurden von seinem Stellvertreter, dem Kapitänleutnant, übernommen. Der Hauptmann marschierte an der Spitze des Fähnleins, im Zug abwechselnd an der Spitze bzw. am Ende. Bei Eilmärschen hatte er zusammen mit einem Leutnant am Ende zu marschieren, um die Soldaten nachzutreiben und auch Desertionen zu verhindern. Er kontrollierte auch die Feldscher und die Feldapotheke. Er besaß Rechenschafts- und Meldepflicht gegenüber dem Obristen, dem Obristleutnant und dem Major. Dem Hauptmann der Infanterie entsprach der Rittmeister der Kavallerie. Junge Adlige traten oft als Hauptleute in die Armee ein.
[103] THEATRUM EUROPAEUM Bd. 4, S. 200f.
[104] Hann. Münden; HHSD II, S. 333f.
[105] Kassel; HHSD IV, S. 252ff.
[106] Vgl. REIMANN, Goslarer Frieden.
[107] Duderstadt [LK Göttingen]; HHSD II, S. 123f.
[108] Mühlhausen [Unstrut-Hainich-Kreis]; HHSD IX, S. 286ff.
[109] Gleichen [Kreis Eichsfeld].
[110] Gleichenstein [Kreis Eichsfeld]
[111] Erfurt; HHSD IX, S. 100ff.
[112] THEATRUM EUROPAEUM Bd. 4, S. 600.
[113] ENGELBERT, Hatzfeldt, Nr. 300.
[114] ENGELBERT, Hatzfeldt, Nr. 227; Duderstadt; HHSD II, S. 123f.
[115] Sondershausen [Kyffhäuserkreis].
[116] HAPPE II 447 r; mdsz.thulb.uni-jena.de.
[117] Glatz [Klodsko; Grafschaft u. Stadt]; HHSSchl, S. 116ff.
[118] ENGELBERT, Hatzfeldt, Nr. 133; Braunau [Broumov]; HHSBöhm, S. 63ff.
[119] Vgl. die ausgezeichnete Dissertation von SCHREIBER, Leopold Wilhelm; BRANDHUBER, Leopold Wilhelm; DEMEL, Leopold Wilhelm.
[120] Glogau [Głogów]; HHSSchl, S. 127ff.
[121] BADURA; KOČĺ, Der große Kampf, Nr. 1315.
[122] BADURA; KOČĺ, Der große Kampf, Nr. 1444.
[123] Landeshut [Kamienna Góra; Schlesien]; HHSSchl, S. 261ff.
[124] Schweidnitz [Świdnica]; HHSSchl, S. 491ff.
[125] Schönau [Kromolin, Kr. Glogau]; HHSSchl, S. 481.
[126] Löwenberg [Lwówek Śląski]; HHSSchl, S. 296ff.
[127] BADURA; KOČĺ, Der große Kampf, Nr. 1503.
[128] Vgl. REBITSCH, Matthias Gallas; KILIÁN, Johann Matthias Gallas.
[129] BADURA; KOČĺ, Der große Kampf, Nr. 1505.
[130] Konstanz; HHSD VI, S. 419ff.
[131] Ravensburg; HHSD VI, S. 644ff.
[132] Überlingen; HHSD VI, S. 807f.
[133] Memmingen; HHSD VII, S. 439ff.
[134] Vgl. IMMLER, Kurfürst Maximilian I.
[135] Grundlegend ist hier ALBRECHT, Maximilian I.
[136] Generalfeldzeugmeister: Der Generalfeldzeugmeister war Befehlshaber der dritten, wenn auch teilweise gering geschätzten Truppengattung, der Artillerie; bei Beförderungen wurden die vergleichbaren Ränge bei der Kavallerie, dann der Infanterie bevorzugt: Der Rang umfasste das Kommando über Artillerie. Ihrem Befehlshaber fielen die sogenannten „Glockengelder“ [Geld, womit eine eroberte Stadt, die sich vom groben Geschütze hat beschießen lassen, ihre Glocken und ihr Kupfergeschirr, welches alles herkömmlich der Artillerie des Eroberers heimfällt, wieder erkaufen oder einlösen muß. KRÜNITZ, Enzyklopädie Bd. 19, S. 192], zu, wenn man während der Belagerung etwa bei Sturmläufen hatte die Glocken läuten lassen, was nach dem „Recht“ des Siegers 12.000 fl. [zum Vergleich: 1634 wurde ein Bauernhof mit 8.-1.000 fl., ein kleines Schloss mit 4000 fl. veranschlagt; MATHÄSER, Friesenegger, S. 51] und mehr sein konnte. Vgl. auch HOCHEDLINGER, Des Kaisers Generäle. Ihm unterstanden die Schanzmeister und die Brückenmeister, zuständig für Wege-, Brücken-, Lager- und Schanzenbau sowie die Anlage von Laufgraben vor Festungen.
[137] Petarde: durch „Petardiere“ angebrachte Sprengladung, die am Tor oder an einer Brücke mit einem Brett angeschraubt oder aufgehängt und mit einer Lunte gezündet wird. Dabei kommen auf 50 Pfd. Metall 4 Pfd. Pulver. Damit wurden Festungsringe an Schwachstellen aufgesprengt, ohne die Wehranlage zu zerstören. Durch die Bresche drangen Sturmtruppen ein, während die aufgesprengten Eingänge zum eigenen Schutz schnell wieder geschlossen werden konnten, wenn der äußere Ring u. die Festung oder das Schloss erobert waren.
[138] Tross: Der Tross war der gesamte Begleitzug eines Heeres (ohne Anspruch auf Verpflegungsrationen) und bildete sich, neben den Offiziers- und Soldatenfamilien, aus Dienstpersonal, Feldpredigern, Feldchirurgen, Feldschern (vgl. s. v.), „Zigeunern“ als Kundschaftern und Heilkundigen, Köchen und Handwerkern, Händler/innen und Marketender/innen, Invaliden und Entwurzelten, Glaubensflüchtlingen, Soldatenwitwen und Kriegswaisen, Hunger leidenden Zivilisten und Bauern, Gefangenen, behördlicher Strafverfolgung Entflohenen und zum Dienst bei der Artillerie verurteilten Straftätern sowie Gauklern, Wahrsagern und in 4 Klassen eingeteilte Prostituierten („Mätressen“, „Concubinen“, „Metzen“ und „Huren“). Der schwer bewegliche Tross und die ambulante Lagergesellschaft waren z. T. doppelt bis viermal so groß wie das Heer, dem er folgte, und war somit zahlenmäßig größer als eine Großstadt wie etwa Köln. Während zu Anfang des Krieges der Tross etwa 30 % größer war als die kämpfende Truppe, war er am Kriegsende nach Aussage des bayerischen Feldmarschalls Gronsfeld unkontrollierbar angewachsen. Er erinnerte daran, dass man „in disen beiden armaden sicherlich über 180 000 seelen hat, welche, es sein gleich jungen, fuhrknecht, weiber und künder, doch alle sowoll alß soldaten leben müssen. Nun werden die beeden armaden ungefähr uf 40 000 mann proviantirt, und mehrer nicht, alß ein mensch in 24 stundt nöthig hat. Wie nun die übrige 140 000 menschen leben können, wan sie nicht hin und her ein stuckh brott suchen thun, solches ist über meinen verstandt“. Bayerisches Hauptstaatsarchiv München Kasten Äußeres Archiv 2961, fol. 29 (Ausfertigung): Gronsfeld an Maximilian I. von Bayern, Thierhaupten, 1648 III 31. In der Werbeinstruktion (1639 VII 04; Bayerisches Hauptstaatsarchiv München Kasten Äußeres Archiv 2624, fol. 4-5) war bestimmt worden, dass „taugliche knecht und nit solche, wie zum theil bei vorigen werbungen geschehen, geworben werden, die mit zu villen kindern beladen und sich allein wegen der quartier underhalten lassen, khonfftig aber wanns zum veldzug khombt, wider dauongehn, also werb: und lifergelt umb sonst angewendt wirdet“. Zum Teil wurden sogar Schiffsbrücken im Tross mitgeführt. Zudem unterlag der gesamte Tross der Militärjustiz, vgl. GROßNER; HALLER, Zu kurzem Bericht, S. 35 (1633): „Haben 4 von dem Troß ins Feuer geworfen, wie man denn nach geschehenem Brand 2 Köpf, etliche Finger und einen halben gebratenen Menschen noch übrig gefunden“.Zur „Lagergesellschaft“ vgl. KROENER, „ … und ist der jammer nit zu beschreiben“, S. 279-296; LANGER, Hortus, S. 96ff.; WAGNER, Ars Belli Gerendi. In Notsituationen wurden Trossangehörige, wenn auch erfolglos, als Kombatanten eingesetzt; BRNARDIC, Imperial Armies 1, S.19.
[139] APW II C 4/1, Nr. 2: Wrangel an J. Oxenstierna, Hauptquartier Saaz, 1647 IX 18/28.
[140] APW II C 4/1, Nr. 1: Wrangel an J. Oxenstierna, Hauptquartier Saaz, 1647 IX 16/26.
[141] Feldmarschall: Stellvertreter des obersten Befehlshabers mit richterlichen Befugnissen und Zuständigkeit für Ordnung und Disziplin auf dem Marsch und im Lager. Dazu gehörte auch die Organisation der Seelsorge im Heer. Die nächsten Rangstufen waren Generalleutnant bzw. Generalissimus bei der kaiserlichen Armee. Der Feldmarschall war zudem oberster Quartier- und Proviantmeister. In der bayerischen Armee erhielt er 1.500 fl. pro Monat, in der kaiserlichen 2.000 fl., die umfangreichen Nebeneinkünfte nicht mitgerechnet, war er doch an allen Einkünften wie Ranzionsgeldern, den Abgaben seiner Offiziere bis hin zu seinem Anteil an den Einkünften der Stabsmarketender beteiligt.
[142] Zeitz; HHSD XI, S. 519ff.
[143] Österreichisches Staatsarchiv Wien Reichskanzlei Kriegsakten 170, fol. 255: Holzappel an Enckevort, Hauptquartier Elterlein, 1647 X 18.
[144] Buxheim; HHSD VII, S. 122.
[145] Generalwachtmeister: Bei den hohen Offizierschargen gab es in der Rangfolge „Generalissimus“, „Generalleutnant“, „Feldmarschall“, „Generalfeldzeugmeister“, auch den „General(feld)wachtmeister“, den untersten Generalsrang im ligistischen Heer („Generalmajor“ bei den Schweden). In der Regel wurden Obristen wegen ihrer Verdienste, ihrer finanziellen Möglichkeiten und verwandtschaftlichen und sonstigen Beziehungen zu Generalwachtmeistern befördert, was natürlich auch zusätzliche Einnahmen verschaffte. Der Generalwachtmeister übte nicht nur militärische Funktionen aus, sondern war je nach Gewandtheit auch in diplomatischen Aufträgen tätig.
[146] Hart, heute Stadtteil von Memmingen.
[147] Memmingerberg [LK Unterallgäu].
[148] Mindelheim; HHSD VII, S. 450ff.
[149] Grünenfurt, Weiler von Memmingen.
[150] Amendingen, heute Stadtteil von Memmingen.
[151] Egelsee, heute Stadtteil von Memmingen.
[152] Leutkirch im Allgäu; HHSD VI, S. 466ff.
[153] FURTENBACH, Ober-Ländische und Straff-Chronic, S. 172.
[154] HÖFER, Ende, S. S. 115f.
[155] Vgl. MÜLLER, Das Leben; BURSCHEL, Himmelreich und Hölle; PETERS, Söldnerleben; PETERS, Söldnerleben (2. Aufl.).
[156] Kartaune, halbe: langläufiges Geschütz mit großer Reichweite, Rohrlänge 32-34-faches Kaliber (10,5 – 11,5 cm), schoß 8-10 Pfund Eisen. Das Rohrgewicht betrug 22-30 Zentner, das Gesamtgewicht 34-48 Zentner. Als Vorspann wurden 10-16 Pferde benötigt.
[157] Feldschlange: Meist als Feldschlange bezeichnet wurde auch die „Halbe Schlange“: langläufiges Geschütz mit großer Reichweite, Rohrlänge 32-34faches Kaliber (10, 5-11, 5 cm), schoss 8-10 Pfund Eisen. Das Rohrgewicht betrug 22-30 Zentner, das Gesamtgewicht 34-48 Zentner. Als Vorspann wurden 10-16 Pferde benötigt.
[158] Feuerkugel: Geschoss mit Spreng-, Brand- und Leuchtwirkung, das von Mörsern im Steilfeuer über die Stadtmauer geschossen werden konnte.
[159] Feuermörser: grobes Geschütz der Belagerungsartillerie, mit dem Bomben, Karkassen (aus glatten Rohren abgefeuerte Brandgeschosse, die aus einem schmiedeeisernen, mit Leinwand ummantelten und mit einem Brandsatz gefüllten Gerippe bestehen) und andere Feuer-Kugeln (Geschosse mit Spreng-, Brand- und Leuchtwirkung) im Steilfeuer über die Stadtmauer geschossen werden konnten.
[160] Durch die Zündlöcher hineingetriebene Nägel machten die Geschütze unbrauchbar.
[161] PETERS, Söldnerleben, S. 185f.; Erfurt; HHSD IX, S. 100ff.
[162] In einem geheimen Brief vom 28.10. bat der Rat Memmingens die Ulmer um Hilfe. Über 3.000 Kanonenschüsse und 200 Feuerballen, dazu 100 glühende Kartaunen waren in die Stadt geschossen worde. ZILLHARDT, Zeytregister, S. 217, Anm. 449.
[163] Regimentsstück: leichtes Feldgeschütz, durch Gustav II. Adolf eingeführt, indem er jedem Infanterie-Regiment ständig zwei leichte Geschütze zuordnete. Die Bedienung übernahmen erstmals besonders eingeteilte Soldaten. Die Regimentsstücke waren meist 3-Pfünder-Kanonen. Sie wurden durch eine Protze im meist zweispännigen Zug, gefahren vom Bock. d. h. der Fahrer saß auf der Protze, beweglich gemacht. [wikipedia]
[164] Österreichisches Staatsarchiv Wien Reichskanzlei Kriegsakten 171, fol. 44-45: Enckevort an Holzappel, HQ Buxheim, 1647 XI 05.
[165] Klafter: 1 Klafter entspricht etwa 2,5 bis 3 m3, als Längenmaß: 1 Klafter entspricht 6 Fuß, also etwa 1,80 m.
[166] Trompeter: Eigener gut bezahlter, aber auch risikoreicher Berufsstand innerhalb des Militärs und bei Hof mit wichtigen Aufgaben, z. B. Verhandlungen mit belagerten Städten, Überbringung wichtiger Schriftstücke etc., beim Militär mit Aufstiegsmöglichkeit in die unteren Offiziersränge.
[167] Akkord: Übergabe, Vergleich, Vertrag; Vergleichsvereinbarungen über die Übergabebedingungen bei Aufgabe einer Stadt oder Festung sowie bei Festsetzung der Kontributionen und Einquartierungen durch die Besatzungsmacht. Angesichts der Schwierigkeiten, eine Stadt oder Festung mit militärischer Gewalt einzunehmen, versuchte die militärische Führung zunächst, über die Androhung von Gewalt zum Erfolg zu gelangen. Ergab sich eine Stadt oder Festung daraufhin ‚freiwillig‘, so wurden ihr gemilderte Bedingungen (wie die Verschonung von Plünderungen) zugebilligt. Garnisonen zogen in der Regel gegen die Verpflichtung ab, die nächsten sechs Monate keine Kriegsdienste beim Gegner zu leisten. Zumeist wurden diese Akkorde vom Gegner unter den verschiedensten Vorwänden bzw. durch die Undiszipliniertheit ihrer Truppen nicht eingehalten.
[168] Plünderung: Trotz der Gebote in den Kriegsartikeln auch neben der Erstürmung von Festungen und Städten, die nach dem Sturm für eine gewisse Zeit zur Plünderung freigegeben wurden, als das „legitime“ Recht eines Soldaten betrachtet. Vgl. die Rechtfertigung der Plünderungen bei dem ehemaligen hessischen Feldprediger, Professor für Ethik in Gießen und Ulmer Superintendenten Conrad Dieterich, dass „man in einem rechtmässigen Krieg seinem Feind mit rauben vnd plündern Schaden vnd Abbruch / an allen seinen Haab vnd Güttern / liegenden vnd fahrenden / thun könne vnd solle / wie vnd welchere Mittel man jmmermehr nur vermöge. […] Was in Natürlichen / Göttlichen / vnd Weltlichen Rechten zugelassen ist / das kann nicht vnrecht / noch Sünde seyn. Nun ist aber das Rechtmessige Rauben / Beutten vnd Plündern in rechtmessigen Kriegen / in Natürlichen / Göttlichen vnnd Weltlichen Rechten zugelassen“. DIETERICH, D. Konrad Dieterich, S. 6, 19. Vgl. BRAUN, Marktredwitz, S. 37 (1634): „Welcher Teil ehe[r] kam, der plünderte. [Wir] wurden von beiden Teilen für Feind[e] und Rebellen gehalten. Ein Teil plünderte und schalt uns für Rebellen darumb, daß wir lutherisch, der andere Teil, plünderte darumb, daß wir kaiserisch waren. Da wollte nichts helfen – wir sind gut kaiserisch, noch viel weniger beim andern Teil; wir sind gut lutherisch – es war alles vergebens, sondern es ging also: ‚Gebt nur her, was ihr habt, ihr mögt zugehören und glauben wem und was ihr wollt’ “. Dazu kamen noch die vielen Beutezüge durch Marodeure, darunter auch von ihren eigenen Soldaten als solche bezeichnete Offiziere, die durch ihr grausames und ausbeuterisches Verhalten auffielen, die von ihrem Kriegsherrn geschützt wurden. Vgl. BOCKHORST, Westfälische Adlige, S. 16f.; KROENER, Kriegsgurgeln; STEGER, Jetzt ist die Flucht angangen, S. 32f. bzw. die Abbildungen bei LIEBE, Soldat, Abb. 77, 79, 85, 98; das Patent Ludwigs I. von Anhalt-Köthen: „Von Gottes gnaden“ (1635). Vgl. den Befehl Banérs vom 30.5.1639; Theatrum Europaeum Bd. 4, S. 101f. Vielfach wurden die Plünderungen auch aus Not verübt, da die Versorgung der Soldaten bereits vor 1630 unter das Existenzminimum gesunken war. KROENER, Soldat oder Soldateska, S. 113; DINGES, Soldatenkörper. Bei der Plünderung Magdeburgs hatten die Söldner 10 % des Nominalwertes auf Schmuck u. Silbergeschirr erhalten; KOHL, Die Belagerung, Eroberung und Zerstörung, S. 82. Profitiert hatten nur die Regimentskommandeure bzw. die Stabsmarketender. WÜRDIG; HEESE, Dessauer Chronik, S. 222: „Wie demoralisierend der Krieg auch auf die Landeskinder wirkte, ergibt sich aus einem fürstlichen Erlaß mit Datum Dessau, 6. März 1637, in dem es heißt: ‚Nachdem die Erfahrung ergeben hat, daß viele eigennützige Leute den Soldaten Pferde, Vieh, Kupfer und anderes Hausgerät für ein Spottgeld abkaufen, dadurch die Soldaten ohne Not ins Land ziehen und zur Verübung weiterer Plünderungen und Brandstiftungen auf den Dörfern, zum mindesten aber zur Schädigung der Felder Anlaß geben; sie auch oft zu ihrem eigenen Schaden die erkauften Sachen wieder hergeben müssen und dadurch das ganze Land dem Verderben ausgesetzt wird, befehlen wir (die Fürsten) hierdurch allen unseren Beamten und obrigkeitlichen Stellen, daß sie allen Einwohnern und Untertanen alles Ernstes auferlegen, Pferde, Vieh und sonstige Dinge von den Soldaten nicht zu kaufen“ ’. Der Hofer Chronist Rüthner weiß zu berichten, dass Borri fünf seiner Soldaten eigenhändig erstochen habe, die beim Plündern gefasst wurden; KLUGE, Hofer Chronik, S. 192: „Den 8. juni ist Zwickau mit accord übergegangen und aufgegeben worden, jedoch in auszug der schwedischen darinnen gelegene soldaten der accord nicht allerdings gehalten und fast meistentheils spoliret worden, unangesehen der kayßerliche general Borey 5 seiner eigenen leute über den raub erstochen“.
[169] Musketier: Fußsoldat, der die Muskete führte. Für den Nahkampf trug er ein Seitengewehr – Kurzsäbel oder Degen – und schlug mit dem Kolben seiner Muskete zu. In aller Regel kämpfte er jedoch als Schütze aus der Ferne. Deshalb trug er keine Panzerung, schon ein leichter Helm war selten. Eine einfache Muskete kostete etwa 3 ¼ Gulden, die qualitativ besseren Suhler Waffen das Doppelte, so dass seine Ausrüstung nicht so kostenintensiv war. Im Notfall wurden die Musketiere auch als Dragoner verwendet, die aber zum Kampf absaßen. Der Hildesheimer Arzt und Chronist Dr. Jordan berichtet den einzigen bisher bekannten Fall (1634), dass sich unter den Gefallenen eines Scharmützels auch ein weiblicher Musketier in Männerkleidern gefunden habe. SCHLOTTER; SCHNEIDER; UBBELOHDE, Acta, S. 194. Allerdings heißt es schon bei Stanislaus Hohenspach (1577), zit. bei BAUMANN, Landsknechte, S. 77: „Gemeiniglich hat man 300 Mann unter dem Fenlein, ist 60 Glied alleda stellt man welsche Marketender, Huren und Buben in Landsknechtskleyder ein, muß alles gut seyn, gilt jedes ein Mann, wann schon das Ding, so in den Latz gehörig, zerspalten ist, gibet es doch einen Landsknecht“. Bei Bedarf wurden selbst Kinder schon als Musketiere eingesetzt (1632); so der Benediktiner-Abt Gaisser; STEMMLER, Tagebuch Bd. 1, S. 181f.; WALLHAUSEN, Kriegskunst zu Fuß; BRNARDÍC, Imperial Armies I, S. 33ff.; Vgl. KEITH, Pike and Shot Tactics; EICKHOFF; SCHOPPER, 1636, S. 59ff.
[170] Leipheim [LK Günzburg]; HHSD VII, S. 401.
[171] Schweinfurt; HHSD VII, S. 686ff.
[172] Bad Königshofen im Grabfeld [Stadt Bad Königshofen i. Grabfeld]; HHSD VII, S. 368.
[173] Suhl; HHSD IX, S. 426ff.
[174] HÖFER, Ende, S. 118ff.
[175] HÖFER, Ende, S. 127f.
[176] Nördlingen; HHSD VII, S. 525ff.
[177] Nach PASTORIUS, Kurtze Beschreibung, zitiert bei SCHMIDT, Der Aischgrund, S. 45.
[178] Remontierung: Wiederaufstellung und -ausrüstung von Truppen.
[179] Vgl. LAHRKAMP, Bönninghausen.
[180] Lindau; HHSD VII, S. 414ff.
[181] Asperg; HHSD VI, S. 29ff.
[182] Rottweil; HHSD VI, S. 676ff.
[183] Offenburg; HHSD VI, S. 607ff.
[184] Wülzburg; HHSD VII, S. 835f.
[185] Bad Windsheim; HHSD VII, S. 63f.
[186] Weißenburg; HHSD VII, S. 799ff.
[187] Rothenburg [Kr. Saalekreis/Bernburg]; HHSD XI, S. 396f.
[188] Iglau [Jihlava]; HHSBöhm, S. 214ff.
[189] Ochsenfurt; HHSD VII, S. 557.
[190] LAHRKAMP, Bönninghausen, S. 356f.
Veröffentlicht unter Miniaturen
Verschlagwortet mit R
Kommentare deaktiviert für Ruebland [Rüblandt, Rübländer, Rübeland, Rübelant, Rubland, Rubeland, Rutlandt, Rudländer, Tubland], Johann Christoph Freiherr von der [de]
Pfuel [Pfull, Pfuhls, Phuell, Pfuell, Pfuhl] Adam von
Pfuel [Pfull, Pfuhls, Phuell, Pfuell, Pfuhl] Adam von; Generalleutnant [1604-5.2.1659 Helfta]
Pfuel stand als Obrist, Generalmajor, dann als Generalfeldzeugmeister bzw. General-leutnant in schwedischen Diensten.[1] Das Geschlecht besaß ausgedehnte Besitzungen an der Grenze von Barnim und Lebus, das nach ihm sogenannte „Pfuelenland“.[2]
Er folgte 1620 seiner Schwester, einer Hofdame Marie Eleonorens, bei deren Vermählung mit Gustav II. Adolf, nach Stockholm. Diese Schwester heiratete später den berühmten Banér und wurde die Ahnmutter des gleichnamigen Geschlechts. Ihr Bruder trat als Page bei Gustav II. Adolf in Dienst und begleitete ihn nach Deutschland. Er nahm 1631 an der Schlacht an der Alten Veste[3] bei Zirndorf teil,[4] wo er John Hepburns ehemaliges „Grünes Regiment“ unter Herzog Wilhelm IV. von Weimar kommandierte.[5] In der Schlacht bei Lützen[6] am 6.11.1632 führte er sein eigenes Regiment. Er brachte, nach der Lützener Schlacht, des Königs Leiche von Weißenfels[7] mit 400 Reitern des Regiments Småland[8] nach Wolgast,[9] von wo sie nach Stockholm eingeschifft wurde.[10] Seine nahen, schon angedeuteten verwandtschaftlichen Beziehungen zu Banér machten es, dass er auch in der Folge der Partei Banérs zugehörte. Seine Schwester heiratete Johan Banér, was seinen Aufstieg beförderte. Er wurde schwedischer Obrist, nahm am 5./6.9.1634 an der Schlacht bei Nördlingen[11] teil, wurde Generalmajor und dann Generalfeldzeugmeister. 1634 zog er als Kommandeur eines Regiments selbstständig nach Thüringen und deckte die Flanke des Heeres. Später führte er die Avantgarde des schwedischen Heeres an und brannte angeblich 800 böhmische Dörfer nieder.
Am 11.8.1635 ist er unter den ranghohen Offizieren aufgeführt, die nach dem Prager Frieden[12] mit Axel Oxenstierna[13] und Johan Banér in Magdeburg[14] eine gegenseitige Treueverpflichtung[15] unterzeichneten. Im September 1635 lag sein Kavallerieregiment mit 8 Kompanien vor Magdeburg.[16] Für den 8.1.1636 war eine Konferenz Coburger[17] Abgeordneter mit Pfuel in Mellrichstadt[18] vorgesehen.[19]
„Währenddessen hatte der Kurfürst von Sachsen[20] [1636; BW] aus seinem bei Egeln[21] errichteten Hauptquartier die Belagerung von Magdeburg vorbereitet. In Wittenberg[22] wurde eine Schiffsbrücke errichtet, deren Befestigung bei Schönebeck[23] Oberst Adam von Pfuel auch durch einen Beschuss nicht verhindern konnte“.[24] Am 20.7.1636 konnte Johann Georg I. wieder in Magdeburg einziehen.
Der Schmalkaldener[25] Chronist Johann Georg Pforr [1612 – 1687] berichtet: „Den 13. Decembr: [1636; BW] kamen 5 Schwedische regiment reuter unterm commando deß Obristen Pfullß ankommen und haben 2 nächt in ambtsdörffern still gelegen, von dannen in Francken gangen und daßelbst den Keyß: Obrist[en [Otto Friedrich v.; BW] Harrach ufgerieben, druf sich der Obriste Pfull mit seim regiment in Meinungen,[26] der obrist Pfrangell nach Schleußungen,[27] Dörfling [Derflinger; BW] in Mellerstadt,[28] Mordan [Mortaigne y Potelles; BW] nach Demar[29] und Kündorff[30] und der Obrist Tubalt [Tobias Duwall; BW] mit dem stab und 5 compag: in die statt Schmalkalden und hievon 3 compag: nach Waßungen[31] geleget“.[32]
Das Amtsarchiv Heldburg[33] enthält Akten zu Verhandlungen mit dem Regimentsquartiermeister Wilhelm Böckell des Obristen Pfuel: Befehl der Kammer zu Coburg / Christoph von Hagen an den Amtmann Christian Rußwurm zu Heldburg zu Verhandlungen mit dem Regimentsquartiermeister über die Forderungen des Obristen Pfuel von der Armee des Generals Banér, Minderung der Belastung für die armen Leute, Anfertigung von zwei Pistolen für den Regimentsquartiermeister, Hilfe für den Schosser zur Wiedererlangung des in Steinbach und Oberlind[34] geraubten Viehs, 7.1.1637; Forderung des Regimentsquartiermeisters Wilhelm Böckell an den Amtmann zur Stellung eines gesattelten Pferdes, 8.1. 1637.[35] Dazu gab es Verhandlungen mit den Obristen Pfuel und Carl Gustav Wrangel: Der Akt enthält eine Instruktion für die Räte und Amtleute Hans Quirin von Seebach und Christian Rußwurm wegen der Landstände der Pflege Coburg zu Verhandlungen mit den schwedischen Obristen Adam von Pfuel und Carl Gustav Wrangel, 9.1.1637.[36]
„Baner war inzwischen mit seiner Hauptmacht bis Erfurt[37] vorgedrungen, um diesen wichtigen Stützpunkt in schwedischen Besitz zu bringen, was ihm auch am 22. Dezember 1636 dann gelang. Zur Sicherung seiner linken Flanke hatte er einige Regimenter über den Thüringer Wald auf Schmalkalden entsandt, wo am 11. November das Hoditzsche Regiment erschien. Ihm folgte am 14. November der schwedische Obrist Karl Gustav Wrangel mit 11 Kompanien des Banerschen Leibregiments und der Oberstleutnant Georg Derflinger mit 6 Kompanien Kavallerie. In Schmalkalden hatte man 3.000 Taler erpreßt, in Meiningen 4.000 Reichsthaler und 20 ausgerüstete Pferde. Am 21. November zogen sich Wrangel und Derflinger wieder gen Thüringen zurück, doch von dort aus sandte Baner fünf Regimenter Kavallerie unter dem Kommando des Obersten Pfuel, darunter das Regiment des Obristleutnants Derfling [!], die er bei der Belagerung Erfurts nicht gebrauchen konnte, mit der Weisung zurück, an der Grenze gegen Franken Winterquartiere zu beziehen und seinen Rücken zu decken.
Außer der über den Thüringer Wald vorgeschobenen Abteilung blieb in Westthüringen mit der Sicherung gegen Hessen außerdem der Generalmajor Stalhanske mit mehreren Regimentern stehen. Den fünf Regimentern der Kavallerieabteilung Pfuel waren folgende Städte und Ämter angewiesen worden:
1. Dem Regiment des Obersten Pfuel Stadt und Amt Meiningen, Amt Maßfeld,[38] Stadt und Amt Suhl,[39] Stadt und Amt Mellrichstadt im Bistume Würzburg.
2. Dem Regiment des Obersten Karl Gustav Wrangel Stadt und Amt Schleusingen,[40] Stadt und Amt Eisfeld,[41] Stadt und Amt Hildburghausen.[42]
3. Dem Regiment des Obersten Dubald die Stadt Wasungen und die Ämter Wasungen und Sand,[43] Stadt und Amt Schmalkalden.
4. Dem unter dem Kommando Derflings stehenden Torstensonschen Regiment zu Pferde Stadt und Amt Ilmenau,[44] Stadt und Amt Bischofsheim,[45] Stadt und Amt Fladungen[46] im Bistume Würzburg und das Amt Kaltennordheim.[47]
5. Dem Dragonerregiment des Obersten Caspar Cornelius von Mortaigne Stadt und Amt Themar,[48] die Ämter Kühndorf, Frauenbreitungen und Fischberg,[49] die Zent Benshausen[50] und die Kellerei Behrungen.[51]
Die Regimenter legten ihre Quartiere nun nicht verstreut über die ihnen zugewiesen[en] Gebiete, sondern bezogen enge Quartiere, von denen aus sie den ihnen zugewiesen[en] Raum überwachten, aber auch um in ständiger Einsatzbereitschaft zu stehen. Aus der noch erhaltenen Quartierliste ist nun zu ersehen, daß das Regiment Pfuel in Stärke von neun Kompanien in Meiningen und seiner unmittelbaren Umgebung stand, das Leibregiment unter Wrangel geschlossen in Wasungen, Mortaigne in Themar und Derflinger im (vorgeschobenen) Stockheim[52] lagerten.
Da nun anscheinend Nachrichten über feindliche Truppenbewegungen einliefen, erhielten die Regimenter Derfling und Mortaigne den Befehl, nach der Fränkischen Saale aufzuklären. Da die Hauptsorge der militärischen Führung damals in der Beschaffung von Löhnung und Verpflegung für Mann und Tier bestand, der erbärmliche Zustand des Landes es aber nicht erlaubte, diesem nachzukommen, nahm man vorsorglich Geiseln, die man nach Erfurt überstellte.
Die Erkundung brachte die Bestätigung vom Heranrücken einer starken kaiserlichen Truppe aus dem Stifte Würzburg. Darauf zogen sich die schwedischen Einheiten ‚gegen den (Thüringer) Wald‘ zurück. Der kaiserliche General Godfrid Huin [Huyn v. Geleen;[53] BW] stationierte seine ‚letztliche Regimenter‘ nun um Neustadt[54] und Mellrichstadt, da er ins Leere gestoßen war. Nun war das strategische Ziel der Kaiserlichen, sich zwischen die Schweden in Thüringen und die Hessen unter Wilhelm V. zu schieben und deren Vereinigung zu verhindern. Hatzfeld rückte westlich der Rhön vor, der Generalfeldzeugmeister Huin de Geleen mit 6 Regimentern bzw. angeblich 14.000 Mann zur Flankendeckung auf Meiningen vor. Das zu verhindern, gedachten die Schweden unter Pfuel zu tun. So rückte er am 11. Januar 1637 wieder heran, verstärkt durch 2 Reiterregimenter und Generalmajor Stalhandske. Das Nahziel war, den feindlichen Vormarsch zum Stillstand zu bringen, das Zweitziel, dem Gegner so viel Verluste wie möglich beizubringen.
Am 12. Januar 1637 schickte er den Oberst Wrangel mit dem Banerschen Leibregiment von Wasungen in Richtung Meiningen vor, von wo der Feind in Stärke von 2 Regimentern im Anmarsch war, 1 Kroaten- und 1 Dragonerregiment. Der Vortrab der Schweden kam bei Walldorf[55] in Gefechtsberührung mit dem Gegner. Die beiden kaiserlichen Regimenter hielten diesen Vortrab für eine stärkere Erkundungsabteilung und glaubten die Gelegenheit günstig, als diese sich zurückzogen und stießen nach.
Der Haupttrupp der Schweden hatte aber inzwischen am Südausgang von Wasungen hinter Gebüsch gedeckte Stellung bezogen. Als die Kaiserlichen, deren Verbände sich während der Verfolgung aufgelockert hatten, herankamen, brachen die Schweden dem völlig überraschten Feind in die Flanke. Es kam zu einem kurzen Gefecht; was nicht niedergehauen und verwundet wurde, suchte sein Heil in der Flucht. Die beiden Obersten Manteuffel und [Rudolf Georg v.; BW] Wolframsdorf wurden gefangen genommen. Die Regimenter Wrangel und Derfling setzten den Kaiserlichen nach. Vor den Toren Meiningens kam es, da hier die Kaiserlichen Verstärkung erhielten, zu einem weiteren scharfen Gefecht, bei dem 3 Kompanien Kroaten völlig zusammengehauen worden seien.
Auch hier wandten sich die kaiserlichen Reiter zur Flucht und jagten in Richtung Mellrichstadt davon. Die dort stehende Hauptmasse der Kaiserlichen hatte sich indessen zu einem Teil in Richtung Königshofen[56] zurückgezogen, in der Hoffnung, hinter den Festungsanlagen in Sicherheit zu sein. Sie hatten aber nicht mit so einem Angriffsschwung der Schweden gerechnet; denn eine halbe Meile vor Königshofen wurden sie von Oberstleutnant Derfling eingeholt, dem sie sich widerstandslos ergaben, obwohl er nur mit 60 Pferden gegen sie ansetzte. 800 Fußvolk, 3 neue Geschütze und der gesamte Troß fielen in seine Hand.
Der andere Teil der Kaiserlichen, 8 Kompanien Dragoner stark, wurde im Streugrund zwischen Mellrichstadt und Neustadt gestellt, zusammengehauen und zersprengt. Wiederum wurden 200 Mann gefangengenommen. Es wird berichtet, daß die Schweden grundsätzlich keinem Kroaten und Undeutschen Pardon gaben, sondern nur Deutschen. Der das Fußvolk kommandierende Oberst Klein und der Generalfeldzeugmeister Huin de Geleen seien nur knapp der Gefangenschaft entkommen.
Es war ein ungewöhnlicher Erfolg der Schweden gewesen. Die Kaiserlichen zogen sich hinter die Fränkische Saale zurück und wagten keinen Vorstoß mehr. Die Schweden bezogen seelenruhig wieder ihre alten Quartiere, um Mann und Roß einige Tage der Ruhe zu gönnen. Am 15. Januar 1637 zogen sie sich endgültig über Schmalkalden zurück, da sich Baner, der sich inzwischen auf Sachsen geworfen hatte, diese so weit im Westen stehenden Truppen nicht länger entbehren konnte. Strategisch aber war die Dislozierung des Gegners, der Kaiserlichen, trotz aller Mißerfolge gelungen“.[57]
„So berichtet in Coburg[58] der schwedische Oberst Pfuhls, daß sich das arme Landvolk von Hunden, Katzen, Ratten, Mäusen und Aas zu ernähren suchte. Liebend gerne hätte es »Trebern, Leinkuchen, Kleien und Eichelnbrod«, gleich unvernünftigen Tieren, gegessen, wenn es nur solche Nahrung gefunden hätte (1637)“.[59]
„Am 22. Januar 1637 ließ Baner Oberst Pfuel gegen die bei Meini[n]gen in Thüringen stehenden Verbündeten ziehen. Er selbst rückte vor Leipzig[60] und erneuerte sein Vergleichsangebot. Da Trandorf noch immer nicht bereit war, wurde der Beschuss mit Feuerballen,[61] Steinen, Feuerkugeln und Granaten verstärkt. Erhebliche Schäden entstanden an den Festungswerken, der Pauliner- und Nikolaikirche, am großen und neuen Kollegium sowie an mehreren Bürgerhäusern. Nunmehr drohte Baner mit Generalstürmung und verlangte die unverzügliche Übergabe.
Inzwischen war Klitzing von Pommerns Grenze über Fürstenwalde[62] und Torgau[63] bis nach Großenhain[64] gerückt. Damit er nicht mit Verstärkung Torgau zurückerobern und den Weg nach Pommern verlegen konnte, wollte Baner so lange wie möglich bei Leipzig[65] bleiben. Torgau wollte er beobachten und die Kaiserlichen vom Überschreiten der Unstrut oder Saale abhalten. [Adam v.; BW] Pfuel wurde aus der Grafschaft Henneberg[66] zurückgerufen. Stalhandske, der mit seiner Reiterei bei Gotha[67] und Arnstadt[68] lag, erhielt die Order, sich mit Leslies aus Hessen und Westfalen heranziehenden Hilfstruppen zu vereinigen und [Melchior v.; BW] Hatzfeld und Götzen[69] nicht über die Unstrut zu lassen. Als die Kaiserlichen dennoch sowohl Unstrut als auch Saale überschritten, hob Baner am 7. Februar die Belagerung von Leipzig auf. Fünf Tage später feierte Leipzig ein öffentliches Dank-, Buß- und Betfest.
Derweil stand der Feldmarschall erneut vor Torgau. Von hier ging er nach Pegau[70] und schlug einige Regimenter der angekommenen Reichsarmee. Anschließen wollte er sie bei Eilenburg[71] zu einer Schlacht stellen. Die Verbündeten bezogen aber in Pegau, Borna[72] und Grimma[73] sowie zwischen Colditz[74] und Leisnig[75] Quartiere.
Nach Eilenburg hatte sich auch Kurt Bertram von Pfuel im Auftrag Markgraf Sigismunds von Brandenburg begeben. Er sollte Johann Georg I. Waffenstillstand anbieten. Der Markgraf wollte über einen Frieden verhandeln, für den ihn das Kurfürstenkollegium zu Regensburg, Kurmainz und Kurbrandenburg bevollmächtigt hatte. Baner betraute damit Sten Bielke, der sich damit nicht befassen wollte, da es für ihn nur Zeitgewinn darstellte.
Am 13. März 1637 setzten die Verbündeten bei Leisnig über die Mulde und marschierten nach Meißen.[76] Baner begab sich von Eilenburg in das Lager bei Torgau, wo er Stalhandske, Pfuel und Generalmajor Wilhelm Wendt von Kratzenstein über die Elbe nach Großenhain schickte. Auf ihrem Zug eroberten sie Luckau,[77] Lübben[78] und brannten die Brücke von Meißen nieder. Trotz des Anmarschs der Kaiserlichen blieb Baner bei Torgau und beorderte Wrangel mit seinen Truppen zu sich, um eine Schlacht zu erzwingen, ehe sich die Verbündeten noch mehr verstärken konnten. Oberst Erich Schlange und Wrangel beauftragte Baner am 4. April, nach Wittenberg zu ziehen, um die dortige Schanze zu überfallen. Nachdem sie die 60 Sachsen entweder niedergemacht oder in die Elbe getrieben hatten, gelang es ihnen, sich hier zwei Monate zu halten, bevor sie von Götzen eingeschlossen und zur Übergabe gezwungen wurden“.[79]
Am 6.11.1637 meldete der kurbrandenburgische Obrist Hildebrand Kracht dem Kurfürsten aus Küstrin,[80] dass Banérs gesamte Armee in der Neumark stehe und laut Bericht des kaiserlichen Obrist Jungen sich Landsbergs[81] zu bemächtigen beabsichtige. Nach der Meldung eines Quartiermeisters, dem die Flucht aus schwedischer Gefangenschaft gelang, wollten die Schweden mit Unterstützung von Generalmajor Pfuels Reiterei vor der Festung Küstrin den Abmarsch von Verstärkungen verhindern. Jungen verlange Hilfstruppen für Landsberg, aber er, Kracht, könne sie nicht entbehren, wenn er die hiesige Brücke halten solle, doch habe er an Jungen Kugeln und Lunten geschickt.[82]
Im Januar 1639 berichtete Kurt Koch, der Kommandant von Lemgo,[83] von Pfuels Marsch auf die Weser.[84]
„Im Januar 1639 rückte Banner gegen die in der Mark Brandenburg gelagerte kaiserliche Armee. Er hatte es, wie er am 6/16. Februar Oxenstierna mitteilte, in erster Linie auf die sieben Regimenter abgesehen, welche unter ‚[Hans Wolf von] Salis Commando auffm Eichsfeld commoriren sollen‘ und die er ‚nach gelegenheit der occasionen … aufzuheben‘ vorhabe. Gallas[85] sei ‚dergestalt zugerichtet, daß er vor dießmal vor keinen feindt, so schaden thun kann, zu achten‘. In einem Postscriptum desselben Schreibens berichtet Banner, Salis sei mit den sieben Regimentern, ‚mit welchen er bis dato in und bei Mühlhausen[86] (an der Unstrut) gelegen, nach Franckhausen[87] (in Schwarzburg-Rudolstadt[88]) gerückt und von dannen auch, wie jedermann sagte, über die Unstrut forgegangen‘, und werde ‚vielleicht zu Torgau[89] seinen übergang nehmen‘. Banner’s Anschlag auf Salis‘ Heer sollte nur zu gut gelingen. Gallas, dessen Truppen sich nur noch auf 8000 Mann belaufen haben sollen, wich mehr und mehr durch die Lausitz und Schlesien nach Böhmen zurück – ihm nach Salis. Letzterer war noch in Kursachsen, aber schon nahe an der böhmischen Grenze, als sein Verhängnis über ihn hereinbrach.
Es war am Abend des 2. März (1639) acht Uhr, als der zu Eger[90] anwesende kurbayrische Oberst Moser dem uns schon bekannten früheren Kommandanten des Regiments Salis in bayrischen Diensten Obersten Schütz ‚in großer Eil‘ die Nachricht zugehen ließ, ‚daß der Feindt 7 Meilen von hier (Eger) Herrn General Feldtzeugmeister Salys angetroffen‘ und demselben ein Treffen geliefert habe; ‚wie es abgegangen‘ wisse man noch nicht, allein Salis habe die Seinigen ‚mit aller sach alhero nach Eger geschickt; ‚ist bey ihnen große forcht, … es möchte in zwei Tagen auf das lengst Freund und Feindt hiero bey uns sein‘. […] Und nun folgen sich rasch hinter einander eine ganze Reihe nach und nach bestimmter auftretender und eingehender Nachrichten, welche, zum größern Teil in den Münchener Akten des 30jährigen Krieges aufbewahrt, einen ziemlich klaren Einblick in den Verlauf dieses verhängnisvollen Ereignisses gestatten.
Bürgermeister und Rat der Stadt Eger melden am 3. März dem kurbayrischen Rat und Pfleger zu Tirschenreuth an der Waldnaab[91] (bayr. Oberpfalz), Johann Ulrich von Burhus auf Ottengrün, der sich um nähere Details erkundigt hatte: gestern (den 2. März) Abends zwischen 6 und 7 Uhr sei des ‚Herrn Veldtzeugmeisters Hans Wolf Freyherrn von Salis sein Leibwagen und Canzley … mit einer Convoi und Roß‘ angelangt; dessen ‚Leute und Offiziere‘ berichteten, ‚daß Er‘ (Salis) mit 6 und zwar zimblich schwachen Regimentern hernach komme; daß der Feind gestern frühe 8 Meyl von hier zu Rumpersgrün (recte Ruppertsgrün[92]) bei Plauen[93] im Voigtland dieselben mit 12 Regimentern hat wollen überfallen; weil aber Herr General Wachtmeister (sic) al Erto[94] gewesen und sich nicht mit manir (hat) retiriren können, hete Er mit seinem Volgkh sich alda entgegen gesetzt und weren darauf an einander kommen. Und sonderlich sol Herr Obrist Wambold entweder Todt oder doch tödtlich verwund sein‘. Heute, am 3. März, seien weitere ‚avisen‘ eingelangt: Salis sei mit sechs Regimentern, ‚zwei zu Fueß und vier zu Roß‘ von 12 feindlichen Regimentern, ‚so General Slang und Pfuel Commandiren‘, überfallen worden; ‚die Reutterey sol alsobalden in Ein Confusion gerathen sein. Weßen dann (diese) theils mit der pagagy anheut über die Eger gangen (sind) und sich am Böhmer Waldt umb Königswarth[95] logiren; die übrigen haben mit Herrn General (Salis) gegen Hoff sich gewendet und werden heunt oder Morgen auch anhero kommen. Das Fueßvolkh, so bey 1000 Mann gewesen sein soll, hat nicht ausreißen können, dahero (es) sich in den Kirchhoff im Dorf reterirt und eine Zeit lang gewöhret (hat); und geben die marchitender vor, daß es sehr soll eingebüßt haben‘. Wie ein vom Feinde wieder entkommener Soldat angebe, habe Feldmarschall ‚Pannier‘ (Banner) 35 Regimenter zu Roß unter sich, auch sei Wrangel mit einem starken Regiment zu ihm gestoßen, sodaß der Feind also ‚36 Regimenter zu Pferdt und 14 precaden (Brigaden) zu Fueß, eine Jedliche uff 5: oder 600 Mann stark‘, beisammen habe. Die Schweden hätten alle ihre alten Quartiere in Meißen und Thüringen wieder bezogen, wohin aber ihr Marsch gehen möchte, könne man nicht wissen“.[96]
„Nachdem er, meldet der schwedische Feldmarschall am 3. März (n. St.) von Chemnitz[97] aus an General Torstenson, bei Halle[98] die Saale passiert, sei ihm Kunde zugekommen, General-Wachtmeister Traudisch stehe mit 7 Regimentern sächsischer Kavallerie bei Lützen;[99] da es aber schon abends spät (1. März) gewesen, habe er sich erst andern Morgens früh von Zeitz[100] aus, wo er die Nacht zugebracht, zur Verfolgung der Sachsen aufgemacht. Auf dem Wege sei ihm die ‚Parthey‘ begegnet, die um ‚des Salis marche zu recognosciren‘ nach Jena[101] ausgeschickt worden; diese habe ihm mitgeteilt, Salis sei ‚in völligem Gange nach dem böhmischen Gebirge‘ begriffen. Banner entschloß sich, zwischen Salis und Traudisch zu passieren und ersterm ‚nach aller Möglichkeit zu folgen‘. Weil aber seine Pferde ‚wegen des steten marchirens zimblich müde‘ waren, habe er es für geratener gehalten, den General Pfuel mit der weiteren Verfolgung zu beauftragen. Pfuel sollte versuchen, Salis zu stellen, was diesem auch ‚Gottlob‘ gelang. Er habe Salis ‚zwischen Reichenbach[102] und Alsnitz[103] bei einem Dorf (Ruppertsgrün) im Feld‘ gefunden, dessen Kavallerie ‚chargiert und geschlagen, viele standarten erobert nebst der sämtlichen bagage, so in großer Menge gewesen‘. Salis aber habe sich nebst den beiden Infanterie-Regimentern ins Dorf ‚salvirt‘ und ‚um Quartier gebetten‘, sei dann aber ‚nebst den beihabenden Obristen sambt fendl und Knecht gefangen worden‘ “.[104]
Der Erzgebirgschronist Christian Lehmann [11.11.1611 – 11.12.1688][105] schreibt unter 1639 zur Eroberung von Zwickau[106] und Chemnitz: „Weil den Schweden dieser streiff [die Gefangennahme des kaiserlichen Feldzeugmeisters von Salis zwischen Elsterberg[107] u. Reichenbach; BW], geglücket, eilete Baner auf Zwicka, drinnen kein geworben Volck, sondern nur der Landtjäger-Meister mit ezlichen Schuzen und denen dohin salvirten Landt-Adel und nur 2 Defensioner-Corporalen Letschke [Letschka; BW] und Schweiggart mit wenig defensionern[108] lag, und mit dratkugeln[109] herausschoßen, daß nach der aufgabe die 2 Corporale hienaußgeführet und decollirt werden solten, denen zu ihren glücke des Baners gemahl [Elisabeth Juliane v. Erbach; BW] in der Carethe ankommende begegnete und sie loßbate. 21. Februar forderte (Baner) Sie auf, sezte ihnen mit schießen und Schantzen dermaßen zue, daß Sie sich den 23. Februar auf gnade und Ungnade ergeben musten; in einen Freytag bey schönen Wetter und luftigen frühling kam er an. Man kundte alle schöße auf den Stücken vernemblich zum Scheibenberg[110] hohren. Den Sonntag zog er ein, und untter deß flogen seine reuter wie die zweyßfelder[111] in dieser refier herumb, daß Niemand sicher wahr. Wie Umbarmbhertzig und grausam Sie mit der Statt umbgegangen, hat Mann zue lesen in ihrer Chronik f. 592. Den General Pfulen musten Sie geben Ranzion 10 000 thl., 10 000 brandtschazung, 2060 thl. vor die glocken, 7181 thl. Recruitengelder vor das Churlendische Regiement untter dem Obristen Billingshausen. Der Landtjäger-Meister und die andern von Adel wurden alle in Arrest behalten, biß Sie sich mit 12 000 thl. ranzionirten. Den 24. Februar berenneten Sie ohne verzug die Statt Chemnitz, drinnen nur 1 Commendant mit 30 knechten lag, bezwang ihn mit troz 26. Februar und ließen ihn gar spötlich abziehen, weil er sich nicht gewehret hette. Darein legten Sie den Obrist-Leutenandt Prinzen [Printz; BW] mit 200 knechten“.[112]
Der schwarzburg-sondershausische Hofrat Happe[113] erwähnt Pfuel und seine Truppen in seiner „Thüringischen Chronik“: „Eodem die [3./13.3.1639; BW] sind etzliche Reuter vom Pfulischen Regiment herein geleget worden in Sondershausen.[114] Eodem die, den 3. März, sind etzliche Pfulische Reuter in Greußen[115] geleget worden. Den 4. März sind die Pfulischen Reuter von Sondershausen hinweg gezogen, sind zwar nach etzlichen Stunden wieder kommen, aber die Bürgerschaft hat sie nicht wieder einlassen wollen. Den 3. März ist der schwedische Rittmeister Pfuel mit einhundert Pferden in die Stadt Greußen gezogen“.[116]
Über die Kriegsereignisse in der freien Reichstadt Mühlhausen[117] heißt es in der „Thomas-Chronik“: „Den 9. März [19.3.1639; BW] ist durch Anstiftung des Oberamtmanns des Eichsfeldes[118] Heinrich Christoph von Grießheim mit 600 kaiserlichen Reutern und 200 Fußknechten hier in die Vorstädte eingefallen und einen Trupp von 70 schwedischen Pferden und 200 zu Fuß aufgehoben. Und ist dahero kommen: erstlich ist ein Leutnant mit 20 Reutern vom [Arvid; BW] Wittenbergischen Regiment angekommen, welcher des Rats zu Mühlhausen Obligation auf 1500 Rtlr. producirt und solutionem exigiret[119] hat. Inzwischen und weil sie aus gewissen Ursachen weder in die Stadt noch in die Vorstadt haben logiert werden sollen, nehmen sie ihr Oblager in der Steinbrückenmühle allernächst dem Ammertor. Die andere Nacht um 9 Uhr geschieht ein Einfall und nehmen ihrer sechs gefangen mit weg samt allen ihren Pferden auf den Gleichenstein[120] zu dem Oberamtmann des Eichsfeldes. Inmittelst kommt noch ein Major vom Mordanischen [Mortaigne; BW] Regiment und bringt Order vom Generalkommissar Pfuhl [Adam v. Pfuel; BW], den 23. Febr. [4.3.; BW] datiert, daß man acht Kompagnien in die Stadt nehmen soll oder wegen ihrer Verpflegung auf eine gewisse Summe Geldes wöchentlich tractiren soll. Des andern Tages ward berichtet, daß ein Regimentsquartiermeister im Anzuge sei, der von General Banier und vom Generalmajor Stahlhaußki gewisse Assignation nach Mühlhausen habe, 25 000 Rtlr. Rekrutengelder zu fordern und 6 Kompagnien einzulogieren. In währenden Tractatis hat bemeldter Regimentsquartiermeister [Hans Friedrich; BW] Lattermann die postulata so hoch gesteckt und sich mit Schnarchen[121] und vieler Bedräuung vernehmen lassen, daß die Bürgerschaft ins Gewehr getreten, die Tore verwahrt und wider des Raths Schluß keinen Mann von seinen Leuten wollen einlassen, wie beweglich ihnen auch ist zugeredet worden. Freitags nachts gegen Morgen 3 Uhr fielen die Eichsfeldischen neben bei sich habender kaiserlicher Kavallerie auf 1000 Mann stark zu Roß und zu Fuß, ein hier in die Vorstadt, erschießen einen Kapitänleutnant von den Finnen und einen Korporal neben 16 gemeinen Knechten, so alsdann auf der Wahlstatt und tot geblieben sind, dazu 12, so tödlich verwundet, und viel Gefangene mit sich weggeführt auf den Gleichenstein“.[122]
Bei Happe heißt es weiter: „Eodem die, den 19. [29.3.1639; BW], ist der schwedische Regiments Quartiermeister [Joachim Wendler; BW] mit 20 Reutern anhero nach Sondershausen kommen, hat mit Drauen geschnaubet wie Saulus und mit Gewalt eintausend Thaler begehret. Als er aber die Nordhäusische[123] Lamien[124] gehoret, ist er stracks wieder auf Greußen gangen. Eodem die, als der Regiments Quartiermeister nach Greußen kommen und den Bericht von dem Nordhäusischen Einfall dahin bracht, sind die Plugischen also balde aufgebrochen und des Abends umb 7 Uhr vor Furcht noch aus der Stadt gewichen, haben den armen Bürgern im Aufbruche viel Pferde mit genommen. Den 20. März [30.3.1639; BW] ist sturmisch Aprilwetter gewesen, hat geregnet und geschneyet und haben sich die Schweden starck um Nordhausen sehen lassen“.[125] „Eodem die [22.3./1.4.1639; BW] haben sich die Schwedischen auch von Frankenhausen hinweg gemachet wegen der Eichsfelder. Den 23. März [2.4.1639; BW] sind die Pfulischen noch zu Arnstadt[126] in der Vorstadt gelegen und haben sie die Bürger in die Stadt nicht lassen wollen und hat ihnen der Commendant 200 Musquetier zu Hülfe geschicket. Damit haben sie die Stadt genommen und den 24.[3.4.1639; BW] die Schlagbäume und Thore aufgehauwen und sich gewalthätig eingeleget“.[127]
Auch an dem Treffen mit Morzin vor Chemnitz hatte Pfuel Anteil: „Der Schwedische General Leonhart Torsten-Sohn wahr nun mit der hinderstellichen Armee und Artollerey auß den Stift Halberstadt[128] aufgebrochen, Nach dem Fürstenthumb Altenburg[129] gerückt und zue Zeitz den 2. April [a. St.; BW] mit Banern sich conjungiret, und weil er kundtschaft eingezogen, daß die keyßerlichen und Chur-Sächsischen zwischen Zwicke und Chemnitz stünden und sicher legen, brach er den 3. April von Zeitz auf und eilte auf die keyßerlichen zue, ehe Hatzfeld, der schon ezliche Regiementer zum Succurs vor Freyberg[130] geschickt hatte und nunmehr in March wahr, von Eichsfeld durch Düringen mit den Chur-Sächsischen zuesammenzuestoßen, sich conjungiren kundte, schickte von Altenburg den General Schlangen [Slange; BW] uff Zwicka und von dar mit wenig reutern mittin unter die Marzinischen und Chur-Sächsischen. Der recognoscirte alles, wie sie lagen, und ritte wieder zum Baner. Der General Marzin wuste nicht, daß Baner so nahe, und daß Torstensohn zu ihme gestoßen sey. Doch bekam er 3. April abendts umb 5 Uhr kundtschaft, ließ seine Regiementer zuesammenziehen und befahl, daß Sie Morgens alle solten vor Chemnitz stehen. Des abendts zuevor war das keyßerliche Haupt-Quartier zum Honstein[131] gewesen; dohin kam Baner, der sich 4. April viel früher aufgemacht, mit aufgang der Sonne, traf doselbst in der retrogarden 300 Pferde und jagte Sie ins Corpus, das vor Chemnitz stunde. Marzin hatte den Paß an einen Morast vor Chemnitz, den er durchmuste, mit Trajonern besezt, damit der feind nicht da durchbreche, aber es halfe nichts. Baner sezte an, brachte in der eil uber 4 Regiementer zue Pferde, Sein leib Regiement, des Torsten-Sohns, Hans Wachtmeisters und Hans Witten-berg(s), darzue viel Wagehälse, die theils in nachjagen ermüdeten und sich in Marrast durchwuhleten, uber den Marrast hatte (er) die andere Armee ihme nach commandirt, jagte die Trajoner weg, hiebe durch, machte das felt unsicher und nahmb dem Marzin die Höhe, welcher unter deßen, Ehe der feindt uber den Pas kommen, Zeit gehabt, sich zue stellen. Gegen die Statt sazte er an einen Marrast den lincken Flügel, der meist von Curaßiren bestundte, hinder Chemnitz aber uber den fluß den rechten flügel, die wahren viel stärcker an Volck, den der feindt, hatten stücke und Munition bey sich, welches dem feinde noch zur Zeit fehlte. Baner thete mit seinen regiement den ersten angrif an Lincken flügel und litte schaden, die andern 3 Regiementer entsazten ihn, und kamen andere Regiementer mehr darzue und jagten den Lincken flügel in disordre an 2 marrastigen graben, drüber Sie nicht kommen kunten, zum großen Vortheil der Schwedischen; den was nicht gegen Chemnitz zum rechten flügel entkam, das wurde alles entweder gefangen oder Niedergehauen. Weil nun der Schweden volle Armee auch ankommen wahr, wurde commandirt, wer reiten kundte, sezten derowegen die Schwedischen regiementer durch den fluß Chemnitz und chargirten den rechten flügel, der schon gewichen und sich hinder 3 Morrastigte Dämme gesetzet hatte, gingen doch fort und wurden meist niedergehauen. Das Fußvolck drengte Sich an ein Wäldlein nach der Stadt und trachtete ferner an Walt 400 schrit gegen den gebirge und wolte außreißen. Baner ließ ihnen vorbeugen durch General-Major Stalhansen [Stålhandske; BW], Herr Major Pfulen, Obrist Schlangen Regiement und 1 Esquadron von Konigsmarck untter Obrist-Leutenant Hammerstein, die hohleten Sie ein, machten ezliche 100 nieder, nahmen den Rest gefangen und richteten damit die keyßerliche, Chur-Sächsische und Salische armee auf einen tag hin, verfolgeten die flüchtigen Nach Leipzig,[132] Freyberg, Annen-[133] und Marienberg.[134] Der General Marzin kam kümmerlich darvon ohne hut und mit einen Pferd biß an die Seigerhütte an die Flöhe.[135] 800 blieben auf der Walstat, 2000 zue fuß wurden gefangen, 40 standtarten, 20 fahnen, alle stücke, munition und Pagage bliebe in stich. Das thaten die Schweden nur mit der Avangardia von lauter Reutern, und ist kein Canonschuß darzue kommen, welches der Churfürst dem General Marzin, den er mit den [Reinecke v.; BW] Calenbergischen Regiement nach Dresden confoiren ließe, heftig verwiese, von seinen Reutern 400 wiedersamlete und den rest von allen seinen Regiementern den Obristen Wachmeister Trautischz [Traudisch; BW] ubergabe, der reformirte Sie und nahm sie mit sich in Böhmen. Da hatte des Marzins Commando ein Ende.
Die keyßerlichen gingen nach Pirn,[136] Frauenstein,[137] in Böhmen nach Brüx[138] und Prag. Viel wahren nach diesen gebirgen geflohen und gingen die gantze Nacht durch Elterlein[139] auf Annenberg mit blutigen Köpfen, ferner hienunder biß nach Dresden,[140] darüber alles rege und furchtsam wurde in Gebirge, alle Flecken und Dörfer rißen auß nach den Wäldern und in die Städte. Den 5. April sahe mann noch immer einzlich die geschlagenen reuter auf allen straßen nach Böhmen reiten, die leute untterwegens angreiffen, den Sie sehr hungrich thaten und wurden eines theils an Päßen mit Pulver und bley gespeist, daß Sie des hungers vergaßen, ehe sie in Böhmen kommen“.[141]
Happe notiert in seinem Diensttagebuch: „Den 6. April [6.16.4.1639; BW] haben die Pfulischen von Tennstedt[142] zweene Bürgermeister, worunter der alte Bernhardt Wiegeleb, gefangen mit hinweg geführet. Den 6. April zu abends umb 9 Uhr sind die Pfulischen |mit 40| Reuter nach Greußen kommen und haben weidlich rumoret.
Den 7. April [17.4.; BW] |1639|, war der Sonntag Palmarum, haben die Pfulischen Wagen, welche ihme die Bürger zu Greußen haben neue machen lassen, mit Hafer beladen. Darauf sie die beyden Bürgermeister von Tennstedt und die beyde regirende Bürgermeister zu Greußen, als Johann Tentzelln und meinen Bruder Jacob Happen, gesetzet und haben die Greußischen Bürger ihnen noch 4 Pferde vorspannen müssen und haben die vier Bürgermeister gefangen nach Erfurt geführet. Eodem die sind noch fünftzig Trajoner zu der Pfulischen vor Greußen gestoßen und sind mit einander zu Mittage umb 4 Uhr vor hiesige Stadt Sondershausen kommen und 4000 rh haben wollen. Als nun solche zu geben unmüglichen gewesen, haben sie mit Gewalt das Schloss mit Gewalt angefallen, Leittern daran geworfen, überstiegen, die Thore geöffnet und als man entlichen 250 thlr geben, haben sie Christian Melchiorn von Schlotheim gefangen genommen und mit sich hinweg geführet“.[143]
Das „Theatrum Europaeum“[144] berichtet zu 1640: „Es hatte auch General Banner im Leutmaritzer-Cräyß[145] / um Melnick[146] und dortherum eben so wol als im Satzer-Cräyß[147] zuvor beschehen war / gesenget und gebrennet / deme über der Tafel / daß die Käis. gar übel darvon urtheilten / gesagt wurde / dessen Antwort war: er müste selbsten bekennen / daß es Unchristlich / liesse es aber denselbigen / der es ihn geheissen / verantworten.
Er hatte sich / deß nicht Standhaltens und nicht Schlagens halben / daß er dessen von der Cron Schweden keinen Befelch / sondern sich in seinem Vortheil zu halten Ordre habe / entschuldiget / dabenebens aber Patenta in den Satzer-Cräyß / und sonsten außgeschickt / auff Betrohung mit Feur und Schwerdt Contributiones einzufordern. Uber dieß liesse er den Vorrath an Proviant beyseits schaffen / theils unter seine Officirer kom̃en / theils muste im Stich bleiben / Brendeyß[148] und Leutmaritz wurden wie Buntzel[149] uñ Melneck[150] außgeplündert / im Martio verlassen“.[151] Weiter heißt es im „Theatrum Europaeum“: Banér „nahm den Weg beym vestẽ Schloß Tetschen[152] / oder Dietzin / über die noch gefrorne Pulßnitz fort / nach der Leyppa[153] auffwarts / und nachmals seine Guarnison auß diesem Schloß / wie auch die vornehmst / zumahl der Primas auß Leutmaritz / der deß Banners Wirth gewesen / und wer sonsten mit lauffen wollen / mit genommen : Dieses war seine Retirade / die seinem General-Commissario dem Pfuhlen so wol gefiele / daß er darüber resignirte / bald aber zum General-Major gemacht wurde“.[154]
Das „Theatrum Europaeum“ ergänzt: „Der Käiserliche General-Wachtmeister von Bredau [Breda; BW] führete die Käiserliche Avantgarde, den Schwedischen / wie vor oben auch gemeldet / nachzuziehen : wie dann geschehen. Die mehrere Käiserische Armada nahm ihre Winter-Quartier ein / so etwas zu erfrischen / und zu montiren : Der von Bredau aber feuerte hingegen nicht : Banner hatte von diesen Winter-Quartieren Kundschafften / darumb er auff den von Bredau nicht viel gesehen. Er liesse den Königsmarck und Pfulen im Land herumb gehen / Recruten und Gelt zu machen“.[155]
Hofrat Happe notiert: „Nach dieser Victori [bei Chemnitz; BW] ist der schwedische General Banier wieder vor die Stadt Freiberg in Meißen gerücket und dieselbe von neuem hart belagert. Den 18. [28.4.1639; BW] ist der Pfulische Regiments Quartiermeister und Rittmeister Andreas Berg mit in [die] dreyhundert Reutern in die arme Stadt Greußen kommen und darinne pernoctiret. Den 19. [29.4.1640; BW] sind diese Reuter anhero nach Sondershausen kommen, groß Lerm gemacht, das gräfliche Haus mit vielen Trajonern eingenommen und besetzet. Die Reuter aber haben sich in die Stadt quartiret. Den 20. April [30.4.1639; BW] sind aber viel Pfuelische Reuter in die Stadt Greußen kommen. Die haben den Bürgern acht Pferde mit Gewalt genommen aus den Ställen“.[156]
Happe schreibt in seinem Diensttagebuch: „Den 21. April [1.5.1639; BW] sind die Pfulischen von Sondershausen wieder alle in das arme verwüstete Städlein Greußen gezogen und |fast gantz| verwüstet. Den 22. April [2.5.1639; BW] sind die Ebersteinischen und Witzlebischen, nachdeme die Stadt Mühlhausen[157] sich mit ihnen verglichen, von dannen wieder abgezogen. Den 23. [3.5.1639; BW] ist der Pfulischen Regiments Quartiermeister mit vielen Pferden, die er zu Heringen[158] genommen, anhero nach Sondershausen kommen, aber nicht lange blieben, sondern damit nach Greußen gangen“.[159] „Den 25. April [5.5.1639; BW] habe ich fünf Pferde den Pfuelischen nach Greußen geben. Eodem die haben die Schwedischen eine gantze Heerde Schweine zu Kelbra[160] genommen und nach Greußen bracht. Den 26. April [6.5.1639; BW] sind Gottlob 2 schwedische Compagnien von Greußen hinweg gezogen, eine aber ist liegend blieben. Den 27. April [7.5.1639; BW] ist der Pfuelische Regiments Quartiermeister abermahls nach mir etzliche Vögel zu Greußen gewaltsamer Weise in mein Hauß [ein]gefallen und daraus 19 Scheffel Hafer genommen. Den 28. sind die Pfuelischen alle von Greußen hinweg gezogen“.[161] „Eodem die [6./16.5.1639; BW] haben etzliche leichtfertige Diebe mir zu Greußen aber 2 Pferde aus den Pfluge genommen. Den 7. Mai [17.5.1639; BW] habe ich bey Nicoll Wangemann 42 thlr den Pflugischen nach Greußen gesandt. Den 8. Mai [18.5.1639; BW] morgens frühe umb vier Uhr ist Freulein Clara zu Schwartzburg und Hohnstein, Meines Gnädigen Herrn Schwester, alhier zu Sondershausen selig gestorben. Den 9. Mai ist von den Pfuelischen ein Lieutenant, welcher Steinbeißers Tochter zu Frankenhausen[162] hat, anhero mit 40 Pferden nach Sondershausen kommen. Der hat den Schösser von Weißensee,[163] Johann Arnolden, aus hiesiger Stadt gefangen genommen und mit hinweg geführet. Auch ist ein Reuter darunter gewesen, aus Sondershausen bürtig, der hat Glorium Köhlern übertrotzet, dass er ihme ein Koller und etzlich Geld geben müssen.[164] Den 1. Juni [11.6.1639; BW] sind wieder etzliche Pfuelische Regimenter vor die Stadt Greußen kommen, dieselbe zu placken, sind aber nicht eingelassen worden“.[165]
Der Schmalkaldener Johann Georg Pforr [1612-1687] hält fest: „Den 24. Maii [1639; BW] erschienen am himmel große fewrige strahlen, welche ubern walt uber dieße statt heuffig zu schießen anzusehen waren. Solches hat ohn allen zweiffell nachbeschriebenen allzu gefehrlichen starcken durchzugk und darbey und hernach erfolgetes unheill bedeutet und vor augen gestellet hatt, alß nemblichen, den 6. [Jun:] hatt der Schwedische generalmajor Phuell ein capitän mit 30 tragoner zur salvaguardi in die statt Schmalkald[en geschickt. Uff den abend umb 19 uhr kam bemelter Generalm: Pfuel mit 5 regiment an und lagert sich vorm Weidebrunnerthor ins feldt. Des andern tags begab sich Pfuel persönlich in die statt und begehrt ohne einigen ufhalt uff seine völcker 20000 lb: brodt. Deßwegen wurde dießen tag unter den bürgern 3 mahl brod erhoben. Weil aber solches nicht zulangen wollen, hat man auch korn erhoben, daßelbe nurt geschrottet und brod daraus gebacken. Weil aber die begehrte summa deß proviands dadurch nicht volständig geliefert werden können, hat er, Pfuell, den raht deß ubrigen noch mangel<n|ten proviants halben weidlich geengstiget. Den 7. Junii hat man uff die hohe officirer 21 balet[166] unter die bürger geben müßen, darvon dem vatter der Obriste Braun zugetheilet worden. Den 8. Jun: ist Pfuell mit seinen völckern uffgebrochen und uff Meinungen[167] gangen. Über ein stund kam es Pfuels hoffstadt von 30 personen und 40 pferden in der statt ahn, zu welcher unterhalttung der vatter auch vertheilet worden /: dan man hat bey solchen fellen des vatters niemalß vergeßen, sondern ihme sein theil allezeit zugelegt :/. Balt hierauff ist die plag und tribulirung erst recht angangen, indem der Schwedische generalproviantmeister uffgetretten und uff die anmarchirente confoederirte Evangelische armee alßobalt und unverzügklich 500000 lb: brod haben wollen wollen und ob schon die unmügklichkeit vorgewendet worden, hat er sich doran nicht gekehret oder viel disputierens gemacht, sondern er hat alßobalden alle heußerböden und keller persönlich visitirt und waß er vor frucht gefunden, alles zu sich genommen /: wiewol er deßen wenig gefunden :/ Solche frucht hat er schroten und darauß brod backen laßen“.[168] Happe hält weiter fest: „Den 14. Juni [24.6.1639; BW] sind Albrecht Weymann zu Greußen zwey Pferde genommen worden. Diese Zeit sind wir sehr grausam geängstiget worden, denn 1.) haben wir den Pfulischen starcker contribuiren müssen, so wil der Commendant 2.) Goltz in Erfurt auch alle Monath aus der Grafschaft Schwartzburg 4000 thlr haben vom 1. April [11.4.1639; BW] an und 3.) wil der Churfürst von Sachsen die Römerzugs=Gelder haben“.[169] Für den Juli heißt es: „In der Grafschaft Schwartzburg sind an dieser Noth große Ursach mit die Pfulischen Reuter, die so grausam mit uns gehandelt“.[170] „Den 29. Juli [8.8.1639; BW] hat uns der Commendant aus Erfurt, Goltz, hart geplaget, indeme er uns die Pfuelischen Reuter und etzliche Musquetier einquartiret und darüber noch den 30. Juli [9.8.1639; BW] den Rittmeister Weidenbachen mit etzlichen Reutern“.[171]
Auch 1640 hatte man die erneute Einlagerung Pfuelscher Truppen zu ertragen: „Den 16. April [26.4.1640; BW] ist eine gantze Compagnie Reuter von dem Pfulischen Regiment in die Stadt Greußen quartiret. Eodem [die] ist das schwedische Dörflingische Regiment Reuter nach Tennstedt,[172] Clingen[173] und Ebeleben[174] quartiret worden. Eodem [die] Fritz Schwartzen alhier zu Sondershausen ein Pferd genommen worden. Den 17. April [27.4.1640; BW] ist der Generalmajor Pful mit dem gantzen Regiment Reutern in Greußen kommen“.[175] „Den 18. [28.4.1640; BW] ist die arme Stadt Greußen von denen Pfulischen gantz jämmerlich ausgeplündert, auch alles Getreyde hinweg genommen und nach Erfurt geführet und getragen worden, haben mir genommen 40 Marckscheffel Getreyde, 5 Pferde, 3 Schweine, 11 Lämmer, alle mein Geschirr, 3 Wagen, 1 Kuhe, 7 Fass Wein und 2 Fass Bier“.[176] „Dem 21. April [1.5.1640; BW] ist der Generalmajor Pfuel von Greußen abegezogen, hat gleichwohl darinnen etzliche Compagnien Reuter gelassen und ist er eben derjenige, der die arme Stadt Greußen zu Grunde gerichtet mit seinem Beuthen. Vorm Jahre hat mir sein Vetter 4 Pferde aus dem Stalle und itzo seine Leuthe wiederumb sechs Pferde, alle mein Getreyde und was ich gehabt, hinweg genommen“.[177] „Den 4. Juli [14.7.1640; BW] ein Pfulischer Regiments Quartiermeister nach Greußen kommen“.[178]
Der Hildesheimer[179] Chronist Dr. Jordan notierte am 4.8./14.8.1640 in seinem Tagebuch: „General Johan Banner, Obrister Pfuhl und Obr. Schleng [Slange; BW] komen nach Göttingen[180] zue Ihrer Fr. Gnd. Herzog Georg. Bringen mit sich eine große Suite Cavallirs, und weil er kaum eine geringe Zeit alda gewesen, kriegt er Zeitung von des Picolomini[181] Marche. Hat allein mit H(erzog) G(eorg) zu guten Mund geredet“. […] 8./18.8.: „Als sich der Kayserl. Grãl. Graf Piccolomini mit der ganzen Armee bei Gundsberg[182] im Heßischen praesentirte, brach der Schwedische Grãl. Majeur Johann Banner mit der Armee kegen ihn auf“. […] 11./21.8.: „Vergangene Nacht fällt General Banner bei Fritzlar[183] eine Berg an, worauf 9 Kayserliche Regimenter gestanden, schlägt sie mit großem Verlust herunter, da anfangs die Longevilleschen, herauf die Heßischen respondtirt, die Braunschweigen aber den Berg erhalten, worauf sich der Picolomini bey Borhem[184] festgelegt“.[185] Unter dem 29. und 30.9.1640 heißt es: „Der Schwedische Grãl.-Majeur Pfuhl nebest noch einem Obrist kombt anhero. Picolomini bricht mit der Kayserlichen Armee vor Höxter[186] auf, welches er quitirt, nach Westphalen bey Sennerheide.[187] 30. Ziehen (Pfuhl und Begleitung) von hinnen nach Braunschweig“.[188]
In Hildesheim war es im November 1640 zu einem gewaltigen Trinkgelage gekommen, wohin sich viele höhere Offiziere begeben hatten, um an einer von Banér einberufenen Konferenz teilzunehmen. Dr. Jordan berichtet unter dem 30.10./9.11.: „General Johann Banner kompt herein und wurde zweimahl 2 Schwedische Salve vom Hohen Rundel mit Stücken gegeben. Aus 2 Stücken umb 2 Uhr da kamen erstlich die Weymarschen. Er, Banner, kam umb 7 Uhr zur Nacht, – da auch 2 Stücke mehr gelöset wurden – , hatte bey sich Obristwachtmeister Pfuhl [Pfuel; BW], Wittenbergk, Schleng [Slange; BW] (und) Königsmarck, die Obristen Herr von Tzerotin [Bernard ze Žerotina; BW], ein Mährischer Freiher, Zabellitz [Zabeltitz; BW], den jungen Wrangel, Hake, Mortaigne, Hoikhing [Heuking; BW], Steinbock [Steenbock; BW], Bellingkhusen [Bellinghausen; BW], Gregersohn [Andeflycht; BW]. It. Ein Markgraf [Friedrich VI.; BW] von Durlach, des Banners Schwager. Von der Heßischen Armee war Obrist von Gundroth, von Braunschweig Bohn; von Zelle D. Langerbeck.
Von der Weimarschen Armee (die) Directoris Obrist Comte de Guebrian, Otto Wilhelm, Graf von Nassaw, Oheimb. It. Mons. Glocsi, Gral.-Intendant Extraordinari.
Ferner Herzog Philipp Ludwig von Holstein, Rittmeister, Landgraf Christian von Hessen, Caßelscher Linie Maximiliani Filius,[189] Graf Otto von Schomburg [Schaumburg; BW]. Diese letzten beiden nebst den Herrn Tzerotin starben über ein wenig Tagen innerhalb 24 Stunden“.[190]
In der Hannover’schen Chronik heißt es dazu: „Den 1., 2., 3. und 4. Nov. [1640] ist zu Hildesheim die schädliche Gasterey gehalten, da I. F. G. Herzog Georg den Bannier und andere Schwedische Officirer zu Gaste gehabt, und weidlich banquetiret. Der junge Graf von Schaumburg, der letzte dieser Familie, ist gestorben, weiln er den Dingen zu viel gethan auf dieser Gasterey, der junge Graf von der Lippe hat auch eine harte Krankheit ausgestanden, der Schwedische Commandant in Erfurt ist gestorben, wie auch Herzog Georg und Bannier selbst widerfahren, non sine suspicione veneni“.[191] Schon der Zeitgenosse Dr. Jordan, der auch Tilly[192] und Anholt behandelt hatte, hatte Giftmord vermutet: „ihnen war ein vergifteter Wein von einem französischen Mönch zubereitet worden, darbey die Catholiken ihre Freude nicht wohl verbergen kunten […] der Landgraf von Heßen Christian und der graf von Schaumburg, welche reichlich davon getrunken, sind gleich des Todtes geblieben. Herzog Georg und Baner, denen es am ersten gelten sollte, waren etwas mäßiger und also verzog sich das Unglück mit ihnen bis auf den künftigen Frühling“.[193]
Das „Theatrum Europaeum“ berichtet über die Ereignisse in Thüringen und Sachsen: „Der General Major Pfuhl traffe schier den besten Fortzug zur Avantgarde, den andern den Weg zu weisen / und gienge mit seinem commandirten Volck auff Eisleben[194] / Sangershausen[195] und über die Unstrut / von dannen nach Zwickau / die bloquirung / welche einer Belägerung gleich sahe / auffzutreiben / um dessen Ankunfft willen es schon darauff stunde / ob würden die Chur-Sächsischen vor ihm weichen“.[196]
Der Jenaer[197] Chronist Magister Adrian Beier [9.8.1600 – 28.4.1678] hält fest: „4. Novbr. Pful v. Königsmarck, schwedische oberste, nehmen Naumburg[198] ein v. thun grosen schaden in derselben Grenzen“.[199] „Den 5.[15.; BW] [November] ist Generalmajor Pfuel nach Nordhausen[200] kommen. Eodem [die] sind zwey Regiment Pfuelischen Reuter zu Bodungen[201] ankommen“.[202]
Lehmann erwähnt Pfuel anlässlich des Entsatzes von Zwickau Ende 1640: „Alß Baner die beträngnuß der Statt Zwicka vernommen, hat er den General-Major Pfulen mit 5 Commandirten regiementer zue Pferd und 2 Trajonern abgeschickt, dasselbe zue entsezen. Der hatte das Dubaltische [Tobias Duwall; BW] regiement aus Erfurt darzue genommen, flohe gleichsam in November aus den Lüneburgischen in Meißen,[203] den 7. kahm er von Eißleben,[204] Sangerhausen[205] uber die Unstrut auf Naumburg und alda uber die Saalle auf Zwickau und vermeinde die Saxischen Regiementer zue uberraschen; weil nun der Obrist Unger die rechnung balt gemacht, daß es auf entsaz der Stadt Zwicka angesehen, alß hat er den 10. November zuevor die Pagagi nach Chemnitz weg und theils nach Freyberg[206] fortgeschickt, Sich mit 14 Troppen mit den keyßerlichen ins felt gestellet, weil er aber sich nicht bastant befunden, den 12. November eilendts aufgebrochen, des Nachts in lager alles stehen und liegen laßen und mit seinen Völckern theils uff Chemnitz, welches mit 4 Strizkischen Compagnien besazt blieb, theils in Freyberg, theils in Oschatz[207] und Grimme,[208]endlich gar uber die Elbe in die Quartier gegangen. Die Keyßerlichen Gallas- und Colloredischen rißen auch auß durchs gebirg auf 3 Päßen in Böhmen so verzagt, daß Sie sich auch nicht einest umbgesehen. Den 14. November quartirten des nachts darvon 400 in Wiesenthal,[209] 600 uffn Weipert,[210] 3 regiementer uff der Presnitz,[211] die nahmen den deutschen Fuhrleuten, meist Cranzlern, die von Prag kamen, uff der Presnitzer straßen[212] 18. November 38 schöne Pferd weg pro 1500 thl. Den 17. November legten Sich 50 Pferde davon in Wiesenthal auf die Vorwache zue sehen, was der feindt vor hette, 6 tage lang, brachen den 23. November auf, legten Sich zum andern in Böhmen in die Quartiere, partheiten uber den Pas herauß, und wahr vor ihnen niemand sicher in handel und wandel, ließen den feindt in Meißen rauben, sengen und brennen und nahmen sich des nichts an. General-Major Pful ließ die Statt Zwicka nothdürftig provantiren und das lager verbrennen und mit volck besezen, lage biß den 30. November mit den Obristen Graun und Dörfling [Derflinger; BW] in Haupt-Quartier mit 3 regiementern, commandirte die andern nach den Creißen an der Mulda, preste vor die maroden 200 Pferde, die Contribution, so auffgelaufen, und uber die große brandtschatzung bey feuer und schwerd, von Eulenburg[213] 3000, von Merseburg[214] 5000, von Naumburg 10000 thl. Darnach legte er sich mit seinen Volckern nach Born,[215] Rochlitz,[216] Coldiz,[217] Pega[218] und Weißenfels.[219] Den 8. December streiften sie auf allen straßen nach Leipzig, nahmen Pferde und viehe weg, und weil der Obrist Unger auß Oschitz und Grimme auf sie wahr gefallen und was schaden gethan, brach 11. December der General Pful auß dem Haupt-Quartier Born auf, ging auf Oschitz, Dubalt [Tobias Duwall; BW] auf Grimme, Gustavus Horn auf Lützen,[220] verjagten aller ortten die Churfürstlichen völcker, daß Sie sich uber die Elbe retterieren musten. Darmit handelte er seinen Belieben nach in lande Meißen, brande und brandschazte umb Dresden, Freyberg und umb Chemnitz die Stedte, land und ämpter. Er schickte auch in die 1000 Pferde auf die Zschopa[221] und in dieses Oberertzgebirge, ließ den 22. November die Contribution in continenti bey Heller und Pfenningen einfordern. Darvon kamen eben den tag 500 Pferde in Marienberg, begehrten vor 1000 thl. Spitzen, von Annenberg 3000 thl. Die Marienberger gaben durch große bitte 400 thl. ins Haupt-Quartier Rochlitz, Die Statt Annenberg 600 thl. Den 23. November ruckten Sie auf Schwartzenberg[222] und preßeten uber die Contribution herauß von Ampt 900 thl., breitteten sich hernach auß in gantzen gebirg und Plackten auß allen Städtlein gelt, Victualien nach Zwicka und raubten darneben, was Sie funden; bey solchen Zuestandt wahr dieses gebirg abermahl wohl geplagt, in deme es muste fast 3erley Contribution geben, Marienberg wochentlich nach Freyberg 10 thl., 5 scheffel haber nach Zwicka und Erfurt, daß die armen leute abermalß außgesogen wurden, und ein wunder gewesen, wo doch so viel geldes und Mittel sindt herkommen. Das triebe der General-Major Pful mit seinen Volckern Durch den gantzen November und December, daß er den 1. Januar 1641 noch in und umb Mügeln[223] gelegen mit seinen 8 regiementern zue Roß, reinlich alles in lande aufgereumet und mit hinwegnehmen aller Pferde sich starck wieder beritten gemacht, daß Er hernach den Banér beym aufbruch und march in die Ober-Pfaltz gute dienste leisten und stattlich hat rauben helffen können. Den er wurde endlich auß Meißen Nach dem Vogtland beruffen und muste der Banierischen Armee folgen“.[224] „22. November wurde der Obriste Pful mit 1000 thl. an die Stadt [Marienberg] gewiesen, blieb auf groses bitten bey 500 thl., die sie ihn musten zu Rochliz liefern“.[225]
„In dieser Zeit belegte dessen General[226] Adam von Pfuel die Stadt Naumburg[227] mit dem Derfflingerschen und dem Trostenschen[228] Regiment bis zum Januar des Jahres 1641. Die erste Kontribution setzte der Generaladjutant, den der Rat durch ein Gratial[229] erweichte, ‚angesichts der notorischen Armut aus sonderbarem Mitleiden’ auf 1000 Taler herab. Er war dann sogar für den Augenblick mit 300 Talern zufrieden, nachdem die Stadt versprochen hatte, das Restgeld innerhalb kurzer Frist nach Erfurt zu schicken; sonst sollte – wie es in der Verpflichtung lautete – der Generaladjutant befugt sein, ‚die Obligation an den Galgen zu schlagen und damit die selbsteigne Ehre der Stadt zu schimpfieren’. Am Ende des Jahres 1640 war eine neue Kriegssteuer von 6000 Talern fällig. Die Diplomatie des Rates ging diesmal anmutig gewundene Wege; er vertraute sich der Fürsprache einer galanten Dame an. Die hochwohlgeborene Frau Helena, Witwe des Generalwachtmeisters aus dem Winckel, eine geborene von Kirschenbrug[230] (?) aus Eisleben,[231] ‚deren geliebte, selige Voreltern mit der Stadt Naumburg in Freundschaft und Korrespondenz gelebt’, reiste in das Lager Pfuels. Und da der Rat wußte, daß der General sie herzlich schätzte, bat er sie in einem Briefe ‚um Kommendation und Interzession, dass die schwere Einquartierung, wo nicht gar von der Stadt fortgenommen, doch in etwas gelindert würde, und daß die Bürger über die 6000 Taler hinaus mit nichts ferner beschwert würden’. ‚Der allerhöchste Gott im Himmel’, schloß der Stadtschreiber, ‚wird Ew. Hochadeligen Ehrentugend solches Plaisier mit zeitlichem und ewigen Segen reichlich remunerieren’. Die Fürbitte hatte überraschenden Erfolg. Die liebenswürdige Frau Helena aus dem Winckel verstand es, Pfuel zur Gnade zu bestimmen. Er ließ den Rat wissen, daß er der hochadeligen Dame zuliebe der alten Schuldforderung nicht mehr gedenken wolle’, und er verhieß zugleich, das Regiment Derfflingers aus der Stadt zu nehmen und auch das Torstensche Regiment ‚ehestens zu delogieren’. Die Milde Pfuels ist hier um so auffallender, als er, der übrigens brandenburgischen Geschlechts war, sonst wegen einer Unbarmherzigkeit gefürchtet wurde, und sich selbst rühmte, im Königreich Böhmen über achthundert Marktflecken und Dörfer so abgebrannt zu haben, daß keine Spur davon mehr zu sehen wäre. An seinen Namen knüpfte sich in Naumburg ein geheimnisvoller Vorgang, den der Scharfrichter erzählte. Am 30. Dezember 1640 holten diesen abends schwedische Reiter, setzten ihn aufs Pferd, verbanden ihm die Augen und ritten mit ihm drei Stunden übers Feld. Dann hielten sie vor einem unbekannten Hause und führten ihn in einen großen Saal. Viele Lichter brannten. An einem mit schwarzem Tuche bedeckten Tische saß ein alter, graubärtiger Mann. Der befahl dem zitternden Meister, ohne Umstände sein Handwerk zu üben und drei Verurteilte zu dekollieren. Drei vornehme junge Herren wurden nach einander hereingeführt. Ein Richtschwert lag bereit, und die Exekution wurde vollzogen. Die Reiter führten den Scharfrichter wieder zurück. Und hier gab er sein Erlebnis zu Protokoll. Man vermutete, daß es drei Pfuelsche Offiziere vom Regiment Derfflinger waren, an denen der General die Todesstrafe hatte vollziehen lassen“.[232]
Der Hofer[233] Chronist und Organist Jobst Christoph Rüthner [1598 – 1648] notierte für 1641: „Den 5. januarii wurde Peter Ernst von Reizenstein, Georg Adam von Ratiborschky von Sechzebus und herr Ulbrich Löw [an] den general Phul, so bisher das ganze churfürstliche Sachßen auf den grund ruiniret und sein marsch auch hieher gehen sollte, um abwendung desselben nach Plauen geschickt“.[234] Dass diese Absendung nichts nützte, zeigt Rüthners Eintrag: „Den 9. januarii [a. St., BW] folgte der ganze pfulische marsch auf 10 regiementer von der Plauischen Straßen hieher. Er, herr general Pfuhl, wurde in die stadt von denen von adel eingehohlet und bey herrn Johann Adam Gögeln einlogiret. Die völcker giengen alle bey grausamen ungestümen wetter auf Oberkozau, Fattiga, Schwarzenbach[235] und der orten zu. Nachmittags um 3 uhr brach der general Pfuhl selbst wieder auf und nahm sein hauptquartier zu Oberkozau. Obrist Duclas [Douglas; BW] aber pernoctirte bei herrn Gögeln“.[236]
Am 21.1.1641 schrieb Sebotendorf aus Dresden[237] an W. E. von Lobkowitz: Er berichtete Einzelheiten über den Vormarsch der schwedischen Kommandanten Pfuel und Stålhandske, über die Truppendislozierung in Magdeburg,[238] Chemnitz,[239] Leipzig,[240] Dresden und Zittau[241] sowie über die Möglichkeiten einer Abwehr Stålhandskes und einer Ausbreitung seiner Truppen; es fehle aber an Kommandanten und auch das schlechte Wetter sowie Geldmangel wirkten sich ungünstig aus.[242]
„Generalmajor von Phuhl, der wie schon erwähnt, die linke Flügelstaffel führte, kam am 22. Januar [1641; BW] nach Kemnath, ließ hier den Oberst Joachim Ludwig von Seckendorff mit 225 Pferden, zog am 24. über Pressath[243] weiter, ließ die Obersten Heucking und Kinsky in Nabburg[244] und stieß dann zu Báner. Von den Rgt. Heucking und Kinsky wurden Teile nach Vilseck[245] und Auerbach[246] abgezweigt“.[247]
Der Chronist und Bürgermeister Georg Leopold [1603 – 1676][248] aus dem von Eger abhängigen Marktredwitz[249] erinnert sich an den Januar 1641: „Als wir (auch) den 10. Januar gewisse Erfahrung eingebracht, daß der schwedische Generalmajor Pfuel mit 10 Regimentern Reiterei, sam(b)t einer großen Bagage allbereits von Hof herausmarschiert und das Hauptquartier in Mark[t]leuthen[250] genommen hat, haben wir ihm noch selbe Nacht entgegengesandt, wo ihn dann unsere Abgeordneten in der Früh bei Höchstädt[251] auf dem Rendezvous angetroffen haben.
Obwohl er resolviert gewesen, selbige Nacht sein Hauptquartier hier zu nehmen, hat er doch sein Vorhaben geändert, als er von unseren Abgeordneten und unserem Zuschreiben verstanden, daß wir bereits in dem Schutz der Krone und des Reiches Schweden aufgenommen und salvaguardiret worden sind. Weil er sonderlich auch noch beizeiten vormittags mit allen Regimentern hier angelanget, wurde ihm vor dem Tor untertänig aufgewartet und sehnlich zugesprochen. Daraufhin ist er mit seiner Gemahlin, allen Obersten und Offiziere(r)n – und ungefähr 400 Mann – herein, hat mittags Mahlzeit eingenommen und sich (in) 4 Stund[en] hier aufgehalten.
Unterdessen sind die Regimenter hinten[her]um(b) auf den Reiserberg geführt und gestellt worden. Die Tore aber hat er selbst(en) mit starker Wacht besetzet, damit nit zuviel Volk hereingelassen würde. Für die Regimenter haben wir etliche Faß Bier und etliche 100 Brote hinaus(ver)schaffen müssen, wie denn auch Wunsiedel[252] dergleichen herab(ver)schaffet hat. Sie haben sich aber damit nicht begnügen lassen wollen, sondern sind (auch) häufig zwischen dem Bad- und dem Obertor über die Mauern hereingestiegen und haben einen Anfang zum Plündern machen wollen. Sie sind aber bald von Generalmajor Pfuel selbst aus etlichen Häusern abgetrieben worden. Die übrigen abzutreiben und wieder über die Mauern hinauszujagen hat er seine Dragoner mit der Order kommandiert, daß sie ihm alsbald durch den Kopf schießen sollten, sobald sich einer hereinzusteigen unterstehen wollte. Worauf denn bald der Lärmen in den Markt herin wieder gestillet worden war. In den Häusern freilich vor den Toren ist es abermals über und über gegangen. Es hat sich dort niemand dürfen betreten[253] lassen.
Um 3 Uhr nachmittags ist er mit allen Regimentern, nachdem er vorher durch alle seine Trompeter hat tapfer aufblasen lassen, fortgerucket und hat sein Hauptquartier zu Waldershof[254] genommen. Die Regimenter aber blieben auf den Dörfern [in] selber Gegend.
Er hat uns aber zur Salva Guardia seinen Generalgewaltiger[255] samt des Herrn Generalfeldzeugmeisters Leonhard Dorschtenssohn [Torstensson; BW] Leibkompa[g]nie – halb Kroaten,[256] halb Pollacken[257] – hiergelassen. Die mußten selbe Nacht hier im Quartier (ver)bleiben und uns salvaguardieren; denn sie hatten den ernstlichen Befehl, daß sie keinen ein[z]igen Reiter einlassen und was herin wäre, alsbald hinaustreiben sollten. Was aber Marketender wären, die um(b) ihr Geld was kaufen und Bier aufladen wollten, die sollten sie aus- und einfahren lassen. Diesem Kommando ist fleißig nachgelebet worden; außer was die Häuser vor den Toren betrifft. Dort sind selbe Nacht über 200 Pferd[e] liegen(d) geblieben. Die machten sich sehr unnütze.
Um Mitternacht hat uns General Pfuel aus seinem Hauptquartier Waldershof(en) herabgeschrieben und zu vernehmen gegeben, daß von Waldershof aus gegen Kemnath[258] ein so großer Schnee läge, daß es ihm nit möglich wäre, fortzukommen. Derhalben tät er uns bitten, wir sollten zur Beförderung seines Marsches an die 150 Mann mit Schaufeln hinauf(ver)schaffen, damit sie den Schnee aus den Gassen schorten, wo das nit geschehe, so wollte er mit allen Regimentern umkehren, sich bei uns einlegen und besser[es] Wetter erwarten. Da sich die Leute alle versteckten und sich hierzu niemand brauchen lassen wollte, haben wir dennoch in dieser Nacht mit großer Not von Bürgern und Bauern an die 100 Mann zusammen[ge]bracht, die wir fast alle aus den Winkeln hervorziehen und mit Gewalt nehmen mußten. Wir schickten sie mit dem Generalgewaltiger[259] und mit den Pollacken noch vor Tag(s) fort. Dem Generalgewaltiger haben wir aber vorher noch (an die) 20 Dukaten verehren müssen. Diese Völker sind sam(b)t dem Troß auf das wenigste an die 12000 Köpf[e] stark gewesen und hatten an die 1000 Wagen bei sich. Als sie vor Kemnath [ge]kommen, hat man sie alsbald eingelassen. Auch hat der General unsere Leut[e] mit den Schauffeln zu Kemnath in die Ratsstube(n) einquartieren und ihnen Brot und Bier verschaffen lassen. Des andern Tags ist er daselbst stillgelegen. Unsern Leuten aber hat er Paß und Konvoi erteilet und sie wieder nach Haus gelassen. Unter dem Tor aber haben sie vorher ihr Gewehr ablegen müssen. Dahero sind sie bei uns (doch also) desarmiert und ohne Schaufel wieder angelangt.
Des andern Tags ist er zu Kemnath – welches vorher ziemlich spoliert worden war – wieder auf[ge]brochen und gegen Weiden [ge]gangen“.[260]
„Den Tag ehe General Pfuel zu Kemnath aufgebrochen, ist der schwedische Obristleutnant Ludwig von Seckendorff mit seinem ruinierten Regiment Reitern doselbst eingezogen. Obwohl er vorher Order vom Generalfeldmarschall [Banér, BW] hatte, daß er zu Kemnath sein Quartier und seinen Rekrutenplatz haben sollte, haben aber die Kemnather nit einlassen wollen, sondern Feuer hinausgegeben. Hingegen hat er etliche Dörfer angezündet und hat sein Quartier solange nit beziehen können, bis der General Pfuel herbeigekommen war“.[261]
Am 4.2.1641 schrieb Walter Leslie empört aus Regensburg[262] an Piccolomini: Die Stadt Cham[263] habe sich dem Gegner ergeben, ohne einen einzigen Musketen-, geschweige denn Kanonenschuss abzugeben; Pfuel habe Bruays Regiment zum Rückzug nach Böhmen gezwungen.[264]
Das „Theatrum Europaeum“ berichtet weiter: „Der General-Major Wrangel hatte sich deß importirenden Orts Furth[265] / dritthalb Meil von Chamb / an der Chamb gegen Böheim gelegen / bemächtiget / und General-Major Pfuhl und Wittenberg giengen mit 8. Regimentern gar in Böhmen / nach Glattau[266] / und nahmen die besten Ort / als Tauß[267] /Teinitz[268] und dergleichen dort herum für sich ein : nebenst deme auch auff die Käiserl. jenseits Pilsen[269] ligende Regimenter achtung zu geben : Hierdurch wurden die Pässe auß Böhmen nach Regenspurg versperret / davon man sich einer Theuerung besorgen wollte : doch hatte man Bäyern und Oesterreich noch zum besten“.[270]
Lehmann schreibt: „Den 22. Martii marchirte General-Feltzeugmeister Pfuhl und General-Major Wittenberg mit ezlichen Regiementern und allen stucken biß uff 3 halbe Carthaunen und 4 Mörseln, die 27. Martii nachgehohlet wurden, fort uff Halle und gingen den 10. April darmit uber die Sahle. Den 23. (Martii) folgete der General mit den ubrigen Regiementern und kamen in Altenburg“.[271] Am 22.5.1641 informierten Pfuel, Carl Gustav Wrangel und Arvid Wittenberg Amalia von Hessen-Kassel: Am 20.5. des Morgens um 4 Uhr sei nach siebenwöchiger schwerer Körperschwäche Banér gestorben. In dieser schweren Stunde versprechen alle Offiziere und Soldaten der schwedischen Armee, ihn und seine Siege nicht zu vergessen und diese fortzusetzen. Sie hätten sich bis zur Ernennung eines neuen Oberbefehlshabers des vorläufigen Armeekommandos angenommen. Die Armee werde im Herzogtum Braunschweig-Lüneburg logieren müssen. Abschließend baten sie um Verständnis und Unterstützung bei den Kriegsoperationen und wiesen auf die Notwendigkeit einer Proviantbeschaffung für die Armee hin.[272]
Über die Nachfolgefrage und zu den Forderungen der Offiziere Banérs schreibt das „Theatrum Europaeum“: „Es ist ein alt gewöhnliches / daß wann ein General-Haupt / zu solchen Zeiten mit Tode abgehet / es unvermuthliche Mutationes gibet / zu deren Verhütung zwar General Banner die obgenennte drey hohe Officirer / den Pfulen / Wrangeln / und Wittenberg / zu Directorn der Armee ernennet hatte : Dannoch aber konnte dem Ehrgeitz Eyffersucht und Jalousie[273] nicht gar vorkommen werden / und ob woln Pful und Wrangel sich anfangs wol mit einander verglichen und comportirten / auch dem Pfulen / als gen. Commissario etwas Vorzug gebührte / so vermeynten doch endlich die andere beyde / ihnen wollte als gebohrnen Schweden vielmehr zustehen / ihn zu commandiren : Welches den Pfulen verursachte auff seine Resignation zeitlich zu dencken“.[274]
„Ein kaiserliches Heer war unter dem Erzherzog Leopold[275] aus dem Magdeburgischen zum Entsatz der blockierten Festung herangerückt. Generalleutnant von Klitzing vereinigte die braunschweig-lüneburgischen Truppen gegen den inneren Wunsch der Herzöge mit dem schwedischen Heere unter den Generalen Phul und [Helm; BW] Wrangel sowie den Weimaraner Truppen unter dem französischen Marschall Guébriant im Juni vor dem Kiebitzer Damm am Großen Bruchgraben, um die Blockade von Wolfenbüttel zu decken. Da aber die Kaiserlichen nördlich dieses Hindernisses über Germersleben-Schöningen[276] vorrückten, zogen die Alliierten gleichfalls auf Wolfenbüttel, so daß beide Heere parallel miteinander gleichsam in die Wette marschierten und fast gleichzeitig vor der Festung anlangten. Am 17. Juni marschierte die kaiserliche Armee durch Wolfenbüttel, auf das linke Okerufer, wo die schwedisch-deutsche Armee schon stand, und nahm unter den Kanonen der Festung eine Stellung, derjenigen der Alliierten gegenüber. Hier kam es am 19. Juni zu einer blutigen und lange unentschiedenen Schlacht, in der es sich hauptsächlich um Steterburg[277] und den Besitz des dortigen Waldes handelte. Bei den Verbündeten stand das schwedische Heer auf dem rechten, das deutsche Heer auf dem linken Flügel. Die Stärke des verbündeten Heeres betrug 22 000 Mann, die des kaiserlichen 20 000 Mann. Von den Truppen des verstorbenen Herzogs nahmen sein berühmtes Leib-Kavallerie-Regiment, das ebenso berühmte Kürassier-Regiment Anton Meier und die Kürassier-Regimenter v. Warberg, Koch und von Dannenberg, von der Infanterie das rote Regiment v. Schlütter und das blaue Regiment mit je 6 Kompagnien, sowie endlich vom Leib-Infanterie-Regiment v. Bessel und vom gelben Regiment v. Waldow je 2 Kompagnien in der Gesamtstärke von 5400 Mann an der Schlacht teil. Namentlich zeichnete sich Generalleutnant v. Klitzing mit den drei alten Kavallerie-Regimentern Georgs aus. Die gesamte Kavallerie der Verbündeten unter dem General v. Königsmark führte durch einen umfassenden Angriff auf den kaiserlichen rechten Flügel, der diesen zum Weichen brachte, die Entscheidung zugunsten des protestantischen Heeres herbei. Das Leib-Kavallerie-Regiment unter dem Oberstleutnant v. Schönberg drang dabei in zwei bayerische Infanterie-Regimenter ein, nahm 2 Obersten gefangen und eroberte 6 Fahnen und 4 Kanonen. Die Kaiserlichen wurden bis unter die Wälle der Festung getrieben, zogen am 24. durch Wolfenbüttel und setzten den Rückzug bis Schöningen[278] fort“.[279]
Der Hildesheimer[280] Chronist, Arzt und Ratsherr Dr. Jordan notiert in seinem Tagebuch unter dem 5./15.9.1641: „Die Allirten Armeen marschirten vergangene Nacht von dannen nach Gifhorn.[281] Die Ursach mach von Gott bekannt seyn, weil sie noch feststunden und keines Mangels an Proviant hatten. In dem Abmarche seyn beide Herzog August Regimenter, eins zu Roß und eins zu Fueß, unter beiden Obristen Koch von ihnen nach Dannenberg[282] gegangen. Wie die Schwedische solches gesehen und gesagt: ‚Wo stremet sick, dut‘. Herzog Augusti seine Leute haben gesagt: ‚Es streme sick soo‘. Bis an Lüneburgk[283] alles Vieh geraubet. Nachgehnds wie die Armee von Oeßel[284] nach Zell[285] sich gewandt sich gewandt, kombt der Obristliutnand Rochow und Obrist Hake von Wißmar[286] zu der Schwedischen Armee berichten, daß Torstensohn sie zu Wißmar gesprochen und warumb sie den Posten bey Wulfenbüttel[287] verlassen. Landgraf Johan (von Hessen) [Hessen-Braubach; BW] und Klietzing haben ihm unter blawen Himmel höchlich verwiesen, daß sie die Schweden die schöne occasion so verlassen und in keine Differenz setzen wollten, sondern dafern sie, die Schweden, noch ferner bey ihren Propositionen verharren, werden sie, die übrigen Allirten, Ursach genug haben von ihnen zu gehen. Darauf einhelliglich beschloßen uf den Feind zu gehen. Man gab große Schuld uf Grãl.-Majeur Adam von Pfuhl und anderen, so etwan coorumpiert oder hohe Ehren im Säckel vom Kayser führeten“.[288] 20./30.10. 1641: „Diesen Mittag zwischen 11 und 12 Uhr zogen vorüber Grãl.-Majeur Hans Adam von Pfuhl und Comte de Guobriant mit 20 Esquadron Chevallaria nach dem Salz“.[289] 21./31.10.1641: „Die Schwedischen Trouppen, so gestern fürbey passirt, komen unverrichtet heut wieder zurück. Hatten Saltz Detfurt und daherumb ausgeplündert und in Lamspringe[290] die besten Häuser abgebrandt, – ni fallor 6. Eodem rückte die Kaiserl. Armee, so zwischen Einbeck und Northeimb logirt, für Göttingen“.[291]
Helene von Kerssenbrock, in erster Ehe mit dem schwedischen, dann braunschweig-lüneburgischen Generalmajor Johann Georg aus dem Winkel verheiratet, der am 28.2.1639 in Hildesheim verstarb, heiratete in zweiter Ehe 1641 Pfuel.
Dieser war Anhänger der sogenannten „Dritten Partei“, einer Friedenspartei, die sich gegen Schweden und Frankreich als Invasoren richtete. Er stand damals hoch genug in Ansehen, um hoffen zu dürfen, das Oberkommando werde ihm übertragen werden. Er scheiterte aber, weil er Ausländer war, und Torstensson (ihm freilich hoch überlegen) erhielt den Oberbefehl. Als ihm auch Liliehöök vorgezogen wurde, nahm er den Abschied. Pfuel soll gegen ein entsprechendes Handgeld Erzherzog Leopold Wilhelm 16.000 Mann angeboten haben.[292] Dies war 1642. Schweden soll ihm eine hohe Pension gezahlt haben, um ihn vom Übertritt in kaiserliche Dienste abzuhalten.[293]
Im April 1646 ersuchte Heinrich Christoph von Griesheim, der Oberamtmann des Eichsfelds, den Würzburger Bischof Johann Philipp von Schönborn um einen Schutzbrief für den früheren schwedischen Generalmajor Pfuel.[294]
In einer zeitgenössischen „allerkürzesten Beschreibung“ des Nürnberger[295] Friedensmahls von 1649 heißt es: „Nachdem des Herrn Generalissimi Hochfürstl. Durchl. den Münsterischen Friedensschluß durch beiderseits beliebten und unterschriebenen Interimsrecess werkstellig gemacht, viel Regimenter wohl genügig abgedankt, viel Plätze geräumet, auch viel raumen machen und also den dreißigjährigen Krieg nachgehends erfreulich geendet, haben Sie sich entschlossen, den gesamten hochansehnlichen Abgesandten zu dieser Handlung ein Bankett oder Friedensmahl anzurichten und nächst schuldiger Danksagung für solche Göttliche Gnaden-Schenkung, als welcher diese Schlußhandlung hauptsächlich beizumessen, hochbesagten Herrn Gesandten allermöglichste Ehre und Liebe zu erweisen, sie wohlmeinend zu versichern, daß man auf schwedischer Seite begierigst das Teutsche reich in friedlichen Wohlstand bedingter und fast endlich verglichener maßen zu setzen und in lang hergebrachter Freiheit zu hinterlassen.
Solches Vorhabens ist der große Saal auf dem Rathaus in Nürnberg für den geräumigst und bequemsten Ort ausersehen und auf Seiner Hochfürstl. Durchl. gnäd. Begehren von einem edlen Rat zu besagter Mahlzeit mit aller Zugehör in Untertänigkeit willigst überlassen worden, deswegen Sie auch alsobald drei große Kuchen aufrichten und zubereiten lassen. Dieser Saal ist sehr hoch gewölbt, mit güldenen Rosen, Laub und Mahlwerk bezieret und zu diesem Friedensfest mit vielen großen Wandleuchtern, absonderlich aber mit 3 großen Kronen zwischen 6 Festinen[296] oder Fruchtgehängen, welchen 30 Arten Blumen oder lebendige Früchte mit Flinder-Gold[297] eingebunden, versehen worden. Auf den vier Ecken hat man vier Chöre mit der Musik wie auch dazwischen 2 Schenk-Stellen mit ihrem Zugehör angeordnet und Kuchen und Keller mit aller Notdurft gebührlich versehen. Die Herren Gäste sind gewesen I. die H. Kaiserlichen Abgesandte und Chur-Fürstl. Durchlaucht zu Heidelberg, eingeladen durch Herrn Graf [Jan Oktavián;[298] BW] Kinsky Obrist und H. Obrist Moser. II. Die Herren Chur-Fürstl. Abgesandten, welche wegen Seiner Hoch-Fürstl. Durchl. eingeladen Herr Resident Snoltzky [Snoilski; BW] und Herr Obrist Pful [Pfuel;[299] BW]. III. Die Fürstl. Personen, welche in Nürnberg sich anwesend befunden, gebeten durch Herrn Obrist Görtzky und H. Obrist Döring [Dühring; BW]. IV. Die Fürstl. Herrn Abgesandten eingeladen durch Herrn Obr. Leuten. [Benedikt; BW] Oxenstiern[a] und Major Tauben [Taube; BW]. V. Die Herren Grafen, welche sich der Zeit um Nürnberg aufgehalten, gleichfalls gebeten von vorbesagtem Herrn. Und dann VI. die Herren Städtischen Gesandten, unter welchen auch wegen eines edlen Rats der Stadt Nürnberg erschienen die beiden ältesten Herrn als Herr Führer und H. Grundherr. […]
Folgenden Tags besagten Monats, nämlich Dienstags den 25. Septembr., 5. Octobr., sind solche 6 Klassen nach 12 Uhr erschienen und haben sich in 6 absonderlichen Zimmern versammelt. Nachdem nun ihre Ordnung, in welcher sie sitzen sollten, verglichen worden, hat. H. Hofmarschall Schlippenbach erstlich die Städtischen, hernach die Grafen und also nach und nachgehends die Fürstl. Gesandten, Fürst- und Churfürstlichen wie auch endlich Ihre Excellenz Gen. Leut. Herzog von Amalfi und Chur-Fürstl. Durchl. auf den Saal zu der Mahlzeit eingeführt und in solcher Ordnung, wie sie zu sitzen gekommen, wohlbedächtig herumgestellt, daß nach getanem Gebet ein jeder alsobald seinen Platz genommen.
Inzwischen hat man das Rosenwasser aus 5 silbernen Kannen und Becken herum gegeben, haben die Musici das Te Deum laudamus oder »Herr Gott dich loben wir« gesungen, nachmals andere Psalmen und Loblieder, sonderlich aber den Gesang der Engel bei der Geburt des Friedens-Fürsten: »Ehre sei Gott in der Höhe und Fried auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen« künstlich und lieblich gesetzt erklingen lassen.
Auf der Tafel sind gestanden zwei Schaugerichte und zwischen denselben ein Spring-Brunnen mit Rosenwasser, das durch die Luft in die Höhe getrieben worden, angefüllt. Jede Tafel war lang 40 Schuhe und an der obersten eine ablange Rundung für des Herrn Herzogs von Amalfi Durchl. item für beide Chur-Fürstl. und Hoch Fürstl. Durchl. Generalissimum. Der erste Gang ist bestanden in köstlichen Speisen, Olipadriden und allerhand gekochten Speisen. Der andere Gang ist gewesen von gebratnen Vögeln, Wildpret cc. Der dritte von allerhand Fischen und der vierte von Pasteten. Jeden Gang sind aufgetragen worden 150 Speisen, welche alle auf das herrlichste und köstlichste zugerichtet waren. Der fünfte Gang ist bestanden in Gartenfrüchten, so teils in den silbernen Schüsseln, teils an den lebendigen Bäumen, mit welchen die ganze Tafel übersetzt war, gehangen. Zwischen diesem Laubwerk waren zu sehen etliche Rauch-Berge, die einen sehr guten Geruch von sich gegeben, daß also nicht nur der Mund mit niedlichster Speise und Getränk, das Ohr mit lieblichen Getöne, das Auge mit nachsinnigen Schaugerichten, sondern auch der Geruch mit angenehmem Duft belustigt und von allen Anwesenden dergleichen Herrlichkeit nie gesehen worden.
Solchem hat man das obere Blatt der Tafel stückweise abgenommen, da dann der Tisch mit Tellern und Servietten wie auch mit allerhand in Zucker eingemachten Blumen überstreut, wiederum bereitet gewesen. Darauf ist gefolgt der sechste Gang, bestehend in Zuckerwerk, Konfekt und 2 sehr großen Marzipanen, auf zwei sehr großen Marzipan-Schalen, deren jegliche bei 20 Mark Silbers Wert. Diese wie auch alle andere Trachten, in welchen 12 Köche ihre Meisterstücke sehen lassen, sind mit schönem Blumenwerk geziert und prächtigst anzuschauen gewesen.
Da man nun nachgehends Kaiserlicher Majestät, Königlicher Majestät in Schweden und weiters auf Gedeihen des geschlossenen Friedens getrunken, ist mit 16 großen und kleinen Stücken auf der Burg gespielt worden und haben sich die Trompeter und Heerpauker mit der andern Musik die ganze Zeit über Wechsel Weise hören lassen. Christlich und hochlöblich ist, daß man bei solchem Friedensmahl auch der Armen nicht vergessen, sondern unter dieselben zween Ochsen nebst vielem Brot ausgeteilt. Zu dem ist aus eines vor dem Fenster aufgesetzten Löwen-Rachen, welcher einen Palmzweig in der Patten,[300] in der andern aber ein zerbrochenes Schwert hatte, roter und weißer Wein über 6 Stunden häufig geflossen, darum von dem gemeinen Mann ein großes Gedränge und Ihrer Hochfürstl. Durchlaucht angeborne Milde von jedermänniglich hoch gerühmt, dahero auch als einem Wohltäter des ganzen Teutschlands alles Königliche Wohlergehen von Gott dem Allmächtigen einstimmig angewünscht worden. Nachdem sich nun dieses Friedenfest etliche Stunden in der Nacht verzogen, haben die anwesenden Helden noch einmal Soldaten agiren wollen und sowohl Unter- als Obergewehr in den Saal bringen lassen, Befehlshaber darunter des Herzogs von Amalfi F. G. und H. Gener. Hoch Fürstl. Durchl., Hauptleute, des H. Feldmarschall Wrangels Ex-Corporal, Chur Fürstl. Durchl. Rottmeister erwählt, alle Obristen und Obristen Leutnants aber zu Musketieren gemacht, sind um die Tafel herum marschiert, Salve geschossen und also in guter Ordnung auf die Burg gezogen, daselbst die Stücke vielmals losgebrannt, nach ihrem Rückmarsch aber von H. Kaiserl. Obrist Ranfften, weil nun Friede sei, scherzweise abgedankt und also ihrer Dienste erlassen worden. Darauffolgenden Tags hat des Herrn Generalissimi Hoch Fürst. Durchlaucht nochmals ein sehr kostbares Feuerwerk verbrennen lassen“.[301]
Wo er bis 1652 war, ist unbekannt. In späteren Jahren kaufte er sich die Güter Helfta[302] und Polleben[303] im Mansfeldischen und gründete eine neue Linie. Auf seinem Bilde in Jahnsfelde[304] trägt er die goldene Kette, die ihm Gustav II. Adolf geschenkt hatte. Er starb als schwedischer Generallieutenant 1659 zu Helfta und wurde in Polleben beigesetzt. Er hat auch in der Jahnsfelder Kirche Schild und Spruch.[305]
[1] Vgl. die Charakteristik des allgemein unbeliebten und als geldgierig bekannten Pfuel bei HEUBEL; mdsz.thulb.uni-jena.de.
[2] http://jahnsfelder-chronik-pfuel.lima-city.de/2003.html, unter „Jahnsfelde“ Nr. 5.
[3] Alte Veste [Gem. Zirndorf, LK Fürth]; HHSD VII, S. 14. ./4.9.1632: vergeblicher Sturm Gustavs II. Adolf auf Wallensteins befestigtes Lager bei Zirndorf und Schlacht an der Alten Veste, 18.9. Abzug Gustavs II. Adolf. Vgl. MAHR, Wallenstein vor Nürnberg; MAHR, Schlacht.
[4] 3./4.9.1632: vergeblicher Sturm Gustavs II. Adolf auf Wallensteins befestigtes Lager bei Zirndorf und Schlacht an der Alten Veste, 18.9. Abzug Gustavs II. Adolf.
Vgl. MAHR, Wallenstein vor Nürnberg; MAHR, Schlacht.
[5] Vgl. die Erwähnungen bei ENGERISSER, Von Kronach (die zurzeit beste kriegsgeschichtliche Darstellung); ENGERISSER; HRNČIŘĺK, Nördlingen 1634 (die detaillierteste Darstellung der Schlacht).
[6] Lützen [Kr. Merseburg/Weißenfels]; HHSD XI, S. 286f. Schlacht bei Lützen am 16.11.1632 zwischen den Schweden unter Gustav II. Adolf (18.000 Mann) und den Kaiserlichen (16.000 Mann) unter Wallenstein. Die für die Schweden siegreiche Schlacht endete mit dem Tod Gustav Adolfs und dem Rückzug Wallensteins, der etwa 6.000 Mann verloren hatte, nach Böhmen. Nach Lützen schlug Wallenstein keine Schlacht mehr. Vgl. dazu HAPPES ausführliche Schilderung und Reflexion der Ereignisse [HAPPE I 295 v – 302 r; mdsz.thulb.uni-jena]. Vgl. SIEDLER, Untersuchung; STADLER, Pappenheim, S. 729ff.; WEIGLEY, Lützen; BRZEZINSKI, Lützen 1632; MÖRKE, Lützen als Wende; WALZ, Der Tod, S. 113ff.
[7] Weißenfels [Kr. Weißenfels]; HHSD XI, S. 487ff.
[8] LORENZ, Grimma, S. 641 Anm. ***
[9] Wolgast [Kr. Greifswald]; HHSD XII, S. 317ff.
[10] Vgl. KITZIG, Leichenzug.
[11] Schlacht bei Nördlingen am 5./6.9.1634 zwischen den kaiserlich-ligistischen Truppen unter Ferdinand (III.) von Ungarn und spanischen Kontingenten unter dem Kardinal-Infanten Fernando auf der einen Seite und dem schwedischen Heer unter Feldmarschall Gustav Horn, der in eine 7 Jahre dauernde Gefangenschaft geriet, und Bernhard von Weimar auf der anderen. Die Schwedisch-Weimarischen verloren nicht allein die Schlacht, etwa 8.000-10.000 Tote und 3.000-4.000 Verwundete – auf kaiserlicher Seite waren es 1.200 Tote und 1.200 Verwundete – , sondern mit ihr auch den Einfluss in ganz Süddeutschland, während der französische Einfluss zunahm. Vgl. die ausführliche Darstellung bei ENGERISSER; HRNČIŘĺK, Nördlingen 1634 (die detaillierteste Darstellung der Schlacht); STRUCK, Schlacht, WENG, Schlacht. Vgl. den lat. Bericht »Pugna et victoria ad Nordlingam«, der den protestantischen Ständen zuging; Staatsarchiv Bamberg B 48/145, fol. 74 (Abschrift). Zur französischen Sicht vgl. den Avis Richelieus, 1634 IX 11; HARTMANN, Papiers de Richelieu, Nr. 288.
[12] Der in Folge der schwedischen Niederlage in der Schlacht bei Nördlingen (5./6.9.1634) vereinbarte Prager Frieden zwischen Johann Georg von Sachsen und Kaiser Ferdinand II. wurde am 30.5.1635 unterzeichnet. Bei diesem Friedensschluss, dem fast alle protestantischen Reichsstände beitraten, verzichtete der Kaiser auf seinen Anspruch, den Augsburger Religionsfrieden von 1555 allein zu interpretieren und damit das Restitutionsedikt von 1629 durchzuführen (vgl. s. v. „Religionsedikt“); Ergebnis war eine begrenzte Festschreibung des konfessionellen Status quo. Weitere Ergebnisse waren: die Festschreibung der Translation der pfälzischen Kurwürde auf Bayern, der Ansprüche Sachsens auf die Lausitz und die Bildung eines Reichsheers (wobei Johann Georg von Sachsen und Maximilian I. von Bayern eigene Korps führen ließen, die als Teil der Reichsarmee galten), die bestehenden Bündnisse waren aufzulösen, fremde Mächte sollten den Reichsboden verlassen, etwaige Ansprüche auf den Ersatz der Kriegskosten seit 1630 wurden aufgehoben, eine allgemeine Amnestie sollte in Kraft treten. Zudem kann der Prager Frieden als einer der letzten kaiserlichen Versuche betrachtet werden, ein monarchisches System im Reich durchzusetzen. Maßgebliches Mittel dazu war die so genannte Prager Heeresreform, mit der der Kaiser den Versuch unternahm, nahezu alle reichsständischen Truppen unter seinen Oberbefehl zu stellen und zugleich den Ständen die Finanzierung dieses Reichsheeres aufzuerlegen. Diese Vorstellungen ließen sich ebenso wenig verwirklichen wie das Ziel, durch die Vertreibung der ausländischen Mächte Frankreich und Schweden zu einem Frieden im Heiligen Römischen Reich zu gelangen. Zur Forschungslage vgl. KAISER, Prager Frieden. Der Zeitzeuge HAPPE schätzte den Prager Frieden zu Recht als trügerisch ein; Happe I 396 v – 397r, mdsz.thulb.uni-jena.de; vgl. auch LEHMANN, Kriegschronik, S. 87.
[13] Vgl. FINDEISEN, Axel Oxenstierna.
[14] Magdeburg; HHSD XI, S. 288ff.
[15] Quelle 20: Übereinkunft zwischen Axel Oxenstierna, Johan Banér und den Obristen im schwedischen Heer nach dem Prager Frieden, Magdeburg, 11.8.1635.
[16] KODRITZKI, Seitenwechsel, S. 35.
[17] Coburg; HHSD VII, S. 127f.
[18] Mellrichstadt [LK Rhön-Grabfeld]; HHSD VII, S. 438f.
[19] Thüringisches Staatsarchiv Meiningen, Amtsarchiv Heldburg Nr. 2823.
[20] Vgl. SENNEWALD, Das Kursächsische Heer (ab November 2012).
[21] Egeln [Kr. Wanzleben/Staßfurt]; HHSD XI, S. 98f.
[22] Wittenberg [Kr. Wittenberg]; HHSD XI, S. 504ff.
[23] Schönebeck [Kr. Calbe/Schönebeck]; HHSD XI, S. 420ff.
[24] KUNATH, Kursachsen, S. 212.
[25] Schmalkalden [Kr. Schmalkalden]; HHSD IX, S. 387ff.
[26] Meiningen [Kr. Meiningen]; HHSD IX, S. 269ff.
[27] Schleusingen [Kr. Suhl]; HHSD IX, S. 382ff.
[28] Mellrichstadt [LK Rhön-Grabfeld]; HHSD VII, S. 438f.
[29] Themar [Kr. Hildburghausen]; HHSD IX, S. 436f.
[30] Kühndorf [Kr. Suhl]; HHSD IX, S. 243f.
[31] Wasungen [Kr. Meiningen]; HHSD IX, S. 468f.
[32] WAGNER, Pforr, S. 141.
[33] Heldburg [Kr. Hildburghausen]; HHSD IX, S. 192f.
[34] Oberlind [Kr. Sonneberg]; HHSD IX, S. 318f.
[35] Thüringisches Staatsarchiv Meiningen, Amtsarchiv Heldburg Nr. 2890.
[36] Thüringisches Staatsarchiv Meiningen, Amtsarchiv Heldburg Nr. 2895.
[37] Erfurt; HHSD IX, S. 100ff.
[38] Ober- und Untermaßfeld [Kr. Meiningen]; HHSD IX, S. 319ff.
[39] Suhl [Kr. Suhl]; HHSD IX, S. 426ff.
[40] Schleusingen [Kr. Suhl]; HHSD IX, S. 382ff.
[41] Eisfeld [Kr. Hildburghausen]; HHSD IX, S. 98f.
[42] Hildburghausen [Kr. Hildburghausen]; HHSD IX, S. 198ff.
[43] Sand, unter Sinnershausen, Kloster [Kr. Meiningen]; HHSD IX, S. 400.
[44] Ilmenau [Kr. Ilmenau]; HHSD IX, S. 211ff.
[45] Bischofsheim a. d. Rhön [LK Rhön-Grabfeld]; HHSD VII, S. 97.
[46] Fladungen [LK Rhön-Grabfeld]; HHSD VII, S. 199.
[47] Kaltennordheim [Kr. Bad Salzungen]; HHSD IX, S. 229f.
[48] Themar [Kr. Hildburghausen]; HHSD IX, S. 436f.
[49] Fischberg, unter Zella [Kr. Bad Salzungen]; HHSD IX, S. 495.
[50] Benshausen [Kr. Suhl]; HHSD IX, S. 45.
[51] Behrungen [LK Schmalkalden-Meinigen].
[52] Stockheim, Kr. Mellrichstadt, unter Henneberg [Kr. Meiningen], S. 194.
[53] Vgl. SCHRIJNEMAKERS; CORSTJENS, Graaf Godfried Huyn van Geleen (in der deutschen Fachliteratur kaum beachtete Biographie).
[54] [Bad] Neustadt/Saale [LK Rhön-Grabfeld], HHSD VII, S. 59f.
[55] Walldorf [Kr. Meiningen]; HHHSD IX, S. 457f.
[56] Bad Königshofen im Grabfeld [Stadt Bad Königshofen i. Grabfeld]; HHSD VII, S. 368.
[57] PLEISS; HAMM, Dreißigjähriger Krieg, S. 123ff.
[58] Coburg; HHSD VII, S. 127f.
[59] ROTH, Oberfranken, S. 183.
[60] Leipzig; HHSD VIII, S. 178ff.
[61] Karkassen = Brandgeschosse, die aus einem schmiedeeisernen, mit Leinwand ummantelten und mit einem Brandsatz gefüllten Gerippe bestehen.
[62] Fürstenwalde; HHSD X, S. 193f.
[63] Torgau [Kr. Torgau]; HHSD XI, S. 467ff.
[64] Großenhain; HHSD VIII, S. 135f.
[65] Leipzig; HHSD VIII, S. 178ff.
[66] Die Grafschaft Henneberg-Schleusingen wurde nach dem Tod des letzten Grafen auf Grund der Erbverbrüderung von 1554 (de facto seit 1583) von den beiden wettinischen Linien, den sächsischen Albertinern und den thüringischen Ernestinern, bis 1660 gemeinsam verwaltet. Die Grafschaft Henneberg gehörte 1631 zu den von den Truppendurchzügen und Einquartierungen am schlimmsten betroffenen Territorien. An das Aufbringen der Kontribution nach Erfurt war kaum zu denken, das Rentamt in Schleusingen verfügte über keine Mittel. Die Landstände wurden bewogen, innerhalb der nächsten zwei Monate 2.500 Rt. aufbringen zu wollen. Ein weiterer schwerer Schlag wurde nach dem Bericht des kursächsischen Oberaufsehers Marschalk der Grafschaft im Oktober 1634 durch den Einbruch der Truppen Piccolominis versetzt. Vgl. HEIM, Leiden; HUSCHKE, Herzog Wilhelm, S. 255; KÖBLER, Lexikon, S. 247f.
[67] Gotha; HHSD IX, S. 151ff.
[68] Arnstadt [Ilm-Kreis]; HHSD IX, S. 18ff.
[69] Vgl. ANGERER, Aus dem Leben des Feldmarschalls Johann Graf von Götz.
[70] Pegau [Kr. Borna]; HHSD VIII, S. 272ff.
[71] Eilenburg [LK Nordsachsen]; HHSD XI, S. 100ff.
[72] Borna; HHSD VIII, S. 34ff.
[73] Grimma; HHSD VIII, S. 128ff.
[74] Colditz [Kr. Grimma]; HHSD VIII, S. 49ff.
[75] Leisnig [Kr. Döbeln]; HHSD VIII, S. 197ff.
[76] Meißen; HHSD VIII, S. 223ff.
[77] Luckau [LK Dahme-Spreewald]; HHSD X, S. 268ff.
[78] Lübben (Spreewald) [LK Dahme-Spreewald]; HHSD X, S. 273f.
[79] KUNATH, Kursachsen, S. 220ff.
[80] Küstrin [Kostrzyn nad Odrą, Kr. Königsberg]; HHSD X, S. 441ff.
[81] Landsberg [Gorzów Wielkopolski, Brandenburg, h. Polen]; HHSD X, S. 446ff.
[82] BADURA; KOČÍ, Der große Kampf, Nr. 520.
[83] Lemgo; HHSD III, S. 452ff
[84] ENGELBERT, Hatzfeldt, Nr. 182.
[85] Vgl. REBITSCH, Matthias Gallas; KILIÁN, Johann Matthias Gallas.
[86] Mühlhausen; HHSD IX, S. 286ff.
[87] [Bad] Frankenhausen; HHSD IX, S. 29ff.
[88] Schwarzburg; HHSD IX, S. 395ff.; Rudolstadt; HHSD IX, S. 360ff.
[89] Torgau [Kr. Torgau]; HHSD XI, S. 467ff.
[90] Eger [Cheb]; HHSBöhm, S. 119ff.
[91] Tirschenreuth; HHSD VII, S. 747f.
[92] Ruppertsgrün, heute Ortsteil von Pöhl [LK Vogtlandkr.].
[93] Plauen; HHSD VIII, S. 279ff.
[94] al erto: (ital. all’erta, span. alerta) zu den Waffen; wachsam.
[95] Bad Königswart [Lázně Kynžvart, Bez. Eger]; HHSBöhm, S. 20f.
[96] SALIS-SOGLIO, Hans Wolf von Salis, S. 88f.
[97] Chemnitz; HHSD VIII, S. 43ff.
[98] Halle a. d. Saale; HHSD XI, S. 177ff.
[99] Lützen; HHSD XI, S. 286f.
[100] Zeitz; HHSD XI, A. 519ff.
[101] Jena; HHSD IX, S. 215ff.
[102] Reichenbach; HHSD VIII, S. 298f.
[103] Oelsnitz; HHSD VIII, S. 263f. ?
[104] SALIS-SOGLIO, Hans Wolf von Salis, S. 92f.
[105] SCHMIDT-BRÜCKEN; RICHTER, Der Erzgebirgschronist Christian Lehmann.
[106] Zwickau; HHSD VIII, S. 380ff.
[107] Elsterberg; HHSD VIII, S. 87f.
[108] Angehöriger der Landesverteidigung, Landwehr.
[109] Drahtkugel: zwei durch Eisendraht aneinander befestigte Musketenkugeln, die erhebliche Verletzungen hervorriefen.
[110] Scheibenberg; HHSD VIII, S. 316ff.
[111] zweyßfelder: Schmetterling.
[112] LEHMANN, Kriegschronik, S. 94f. Lehmann datiert nach dem alten Stil.
[113] KRUSENSTJERN, Selbstzeugnisse, S. 111f.
[114] Sondershausen [Kyffhäuserkreis].
[115] Greußen [Kyffhäuserkreis].
[116] HAPPE II 243 r; mdsz.thulb.uni-jena.de.
[117] Mühlhausen [Kr. Mühlhausen]; HHSD IX, S. 286ff.
[118] Goldene Mark [Kr. Duderstadt]; HHSD II, S. 172f.
[119] Einlösung verlangt.
[120] Gleichenstein, Burg [Kr. Heiligenstadt]; HHSD IX, S. 147.
[121] GRIMM; GRIMM, DWB Bd. 15, Sp. 1180: „in freierer verwendung von einer erregten redeweise, schnaufen beim reden, als ausdruck des zorns, trotzes, hochmuts, der drohung, prahlerei“.
[122] JORDAN, Mühlhausen, S. 259.
[123] Nordhausen [Kreis Nordhausen].
[124] Lamien: Elend bzw. „klägliches Ende“ (so z. B. auch von Grimmelshausen verwendet) oder i. S. von „laniena“ (Gemetzel).
[125] HAPPE II 248 v – 249 r; mdsz.thulb.uni-jena.de.
[126] Arnstadt [Ilm-Kreis].
[127] HAPPE II 250 r; mdsz.thulb.uni-jena.de.
[128] Halberstadt; HHSD XI, S. 169ff.
[129] Altenburg; HHSD XI, S. 9.
[130] Freiberg; HHSD VIII, S. 99ff.
[131] Hohnstein; HHSD VIII, S. 151f.
[132] Leipzig; HHSD VIII, S. 178ff.
[133] Annaberg; HHSD VIII, S. 5ff.
[134] Marienberg; HHSD VIII, S. 215f.
[135] Flöha; HHHS VIII, S. 97.
[136] Pirna; HHSD VIII, S. 276ff.
[137] Frauenstein; HHSD VIII, S. 98f.
[138] Brüx [Most]; HHSBöhm, S. 79ff.
[139] Elterlein; HHSD VIII, S. 89.
[140] Dresden; HHSD VIII, S. 66ff.
[141] LEHMANN, Kriegschronik, S. 102f.
[142] Tennstedt [Unstrut-Hainich-Kreis].
[143] HAPPE II 253 v – 255 v; mdsz.thulb.uni-jena.de.
[144] Vgl. BINGEL, Das Theatrum Europaeum.
[145] Leitmeritz [Litoměřice]; HHSBöhm, S. 324ff.
[146] Melnik [Mělník]; HHSBöhm, S. 370f.
[147] Saaz [Žatec, Bez. Laun]; HHSBöhm, S. 535ff.
[148] Brandeis a. d. Elbe [Brandýs nad Labem, Bez. Prag-Ost]; HHSBöhm, S. 62f.
[149] Jung-Bunzlau [Mladá Boleslav]; HHSBöhm, S. 237ff.
[150] Melnik [Mělník]; HHSBöhm, S. 370f.
[151] THEATRUM EUROPAEUM Bd. 4, S. 359.
[152] Tetschen [Děčín]; HHSBöhm, S. 610ff.
[153] Böhmisch Leipa [Česká Lípa]; HHSBöhm, S. 57f.
[154] THEATRUM EUROPAEUM Bd. 4, S. 359.
[155] THEATRUM EUROPAEUM Bd. 4, S. 363.
[156] HAPPE II 257 r – 257 v; mdsz.thulb.uni-jena.de.
[157] Mühlhausen [Unstrut-Hainich-Kreis].
[158] Heringen [Kreis Nordhausen].
[159] HAPPE II 258 v – 259 r; mdsz.thulb.uni-jena.de.
[160] Kelbra [Kreis Mansfeld-Südharz].
[161] HAPPE II 260 r – 260 v; mdsz.thulb.uni-jena.de.
[162] Frankenhausen [Kyffhäuserkreis].
[163] Weißensee [Kreis Sömmerda].
[164] HAPPE II 263 r – 264 v; mdsz.thulb.uni-jena.de.
[165] HAPPE II 268 r; mdsz.thulb.uni-jena.de.
[166] Billet: meist in Übereinkunft mit Stadtbeauftragten ausgestellter Einquartierungszettel, der genau festhielt, was der „Wirt“ je nach Vermögen an Unterkunft, Verpflegung (oder ersatzweise Geldleistungen) und gegebenenfalls Viehfutter zur Verfügung stellen musste, was stets Anlass zu Beschwerden gab. Ausgenommen waren in der Regel Kleriker, Apotheker, Ärzte, Gastwirte.
[167] Meiningen [Kr. Meiningen]; HHSD IX, S. 269ff.
[168] WAGNER, Pforr, S. 153f.
[169] HAPPE II 278 r; mdsz.thulb.uni-jena.de.
[170] HAPPE II 270 r; mdsz.thulb.uni-jena.de.
[171] HAPPE II 280 v – 281 r; mdsz.thulb.uni-jena.de.
[172] Tennstedt [Unstrut-Hainich-Kreis].
[173] Clingen [Kyffhäuserkreis].
[174] Ebeleben [Kyffhäuserkreis].
[175] HAPPE II 307 r – 307 v; mdsz.thulb.uni-jena.de.
[176] HAPPE II 308 v – 309 r; mdsz.thulb.uni-jena.de.
[177] HAPPE II 310 r – 310 v; mdsz.thulb.uni-jena.de.
[178] HAPPE II 345 r; mdsz.thulb.uni-jena.de.
[179] Hildesheim; HHSD II, S. 228ff. Zu den Kriegsereignissen in Hildesheim vgl. auch PLATHE, Konfessionskampf.
[180] Göttingen; HHSD II, S. 178ff.
[181] Vgl. BARKER, Piccolomini. Eine befriedigende Biographie existiert trotz des reichhaltigen Archivmaterials bis heute nicht. Hingewiesen sei auf die Arbeiten von ELSTER (=> Literaturverzeichnis).
[182] Gudensberg [Kr. Fritzlar-Homberg]; HHSD IV, S. 192f.
[183] Fritzlar; HHSD IV, S. 149ff.
[184] Borken [Kr. Fritzlar-Homberg]; HHSD II, S. 56.
[185] SCHLOTTER, Acta, S. 322.
[186] Höxter [LK Höxter]; HHSD III, S. 346ff.
[187] Senne, heute Stadtteil von Bielefeld [LK Bielefeld].
[188] SCHLOTTER, Acta, S. 325; Braunschweig; HHSD II, S. 63ff.
[189] Mauritii Filius.
[190] SCHLOTTER, Acta, S. 327.
[191] JÜRGENS, Chronik, S. 537f.
[192] Vgl. KAISER, Politik; JUNKELMANN, Der Du gelehrt hast; JUNKELMANN, Tilly.
[193] SCHLOTTER, Acta, S. 328.
[194] Eisleben [Kr. Eisleben]; HHSD XI, S. 103ff.
[195] Sangerhausen [Kr. Sangerhausen]; HHSD XI, S. 409f.
[196] THEATRUM EUROPAEUM Bd. 4, S. 373.
[197] Jena; HHSD IX, S. 215ff.
[198] Naumburg; HHSD XI, S. 341ff.
[199] TRÄGER, Magister Adrian Beiers Jehnische Chronika, S. 57.
[200] Nordhausen [Kreis Nordhausen].
[201] Großbodungen [Kreis Eichsfeld].
[202] HAPPE II 370 r; mdsz.thulb.uni-jena.de.
[203] Meißen; HHSD VIII, S. 223ff.
[204] Eisleben; HHSD XI, S. 103ff.
[205] Sangerhausen; HHSD XI, S. 409f.
[206] Freiberg; HHSD VIII, S. 99ff.
[207] Oschatz; HHSD VIII, S. 265ff.
[208] Grimma; HHSD VIII, S. 128ff.
[209] Oberwiesenthal; HHSD VIII, S. 261.
[210] Weipert [Vejperty]; HHSBöhm, S. 650.
[211] Pressnitz [Přisečnice; Kr. Chomutov (Komotau)]: Bergstadt im Erzgebirge, bis 1974 an der Stelle, wo sich heute die große Fläche der Pressnitztalsperre (vodní nádrž Přisečnice) erstreckt. Häuser, Kirchen und Schloss von Přisečnice sowie die benachbarten Dörfer Rusová (Reischdorf) und Dolina (Dörnsdorf) wurden abgerissen und an deren Stelle der Fluss Přísečnice (Pressnitz) gestaut.
[212] Pressnitzer Pass: Der Pressnitzer Pass stellt eine der ältesten Pfadanlagen dar, die aus dem Zentrum Mitteldeutschlands über den dichten Grenzwald nach Böhmen führte. Sein ursprünglicher Verlauf ging von Halle (Saale) kommend über Altenburg, Zwickau, Hartenstein, Grünhain und Zwönitz nach Schlettau. Hier wurde die obere Zschopau gequert. Anschließend führte der Weg über Kühberg am Blechhammer vorbei nach Weipert (Vejprty) und erreichte dann östlich schwenkend über Pleil (Černý Potok) mit Pressnitz (Přísečnice) die älteste Bergstadt des Erzgebirges. Von hier aus verlief der sogenannte Böhmische Steig vermutlich über Kaaden (Kadaň) und bis nach Saaz (Žatec). Die Passhöhe selbst befand sich auf böhmischer Seite nahe Pleil (Černý Potok) auf ca. 800 m ü. NN. Damit war der Pressnitzer Pass deutlich niedriger als die sich nach Westen hin anschließenden Pässe über Wiesenthal, Rittersgrün, Platten, Hirschenstand und Frühbuß. Dies war einer der Gründe für seine häufige Benutzung während des Dreißigjährigen Krieges. [wikipedia]
[213] Eulenberg [Sovinec]; HHSBöhm, S. 138f.
[214] Merseburg; HHSD XI, S. 322ff.
[215] Borna; HHSD XI, S. 34ff.
[216] Rochlitz; HHSD VIII, S. 303ff.
[217] Colditz [Kr. Grimma]; HHSD VIII, S. 49ff.
[218] Pegau; HHSD VIII, S. 272ff.
[219] Weißenfels; HHSD XI, S. 487ff.
[220] Lützen [Kr. Merseburg/Weißenfels]; HHSD XI, S. 286f.
[221] Zschopau; HHSD VIII, S. 378f.
[222] Schwarzenberg; HHSD VIII, S. 328.
[223] Mügeln; Kr. Oschatz; HHSD VIII, S. 236ff.
[224] LEHMANN, Kriegschronik, S. 127f.
[225] LEHMANN, Kriegschronik, S. 114.
[226] Manchmal meint die Bezeichnung „General“, Obrist“ etc. in den Selbstzeugnissen, Chroniken etc. nicht den faktischen militärischen Rang, sondern wird als Synonym für „Befehlshaber“ verwandt.
[227] Naumburg [Kr. Naumburg]; HHSD XI, S. 341ff.
[228] Torstensson !
[229] Dankgeschenk.
[230] Helene von Kerssenbrock (26.4.1614-26.10.1661) heiratete in zweiter Ehe 1641 Pfuel.
[231] Eisleben [Kr. Eisleben]; HHSD XI, S. 103ff.
[232] BORKOWSKY, Schweden, S.87ff.
[233] Hof; HHSD VII, S. 302f.
[234] KLUGE, Hofer Chronik, S. 178.
[235] Oberkotzau, Oberkotzau-Fattigau und Schwarzenbach an der Saale [LK Hof].
[236] KLUGE, Hofer Chronik, S. 179.
[237] Dresden; HHSD VIII, S. 66ff.
[238] Magdeburg; HHSD XI, S. 288ff.
[239] Chemnitz; HHSD VIII, S. 43ff.
[240] Leipzig; HHSD VIII, S. 178ff.
[241] Zittau; HHSD VIII, S. 371ff.
[242] BADURA; KOČÍ, Der große Kampf, Nr. 1130.
[243] Pressath [LK Neustadt a. d. Waldnaab].
[244] Nabburg; HHSD VII, S. 491f.
[245] Vilseck; HHSD VII, S. 771f.
[246] Auerbach; HHSD VII, S. 41f.
[247] HELML, Dreißigjähriger Krieg, S. 190.
[248] KRUSENSTJERN, Selbstzeugnisse, S. 151f.
[249] Marktredwitz; HHSD VII, S. 429f.
[250] Marktleuthen [LK Wunsiedel im Fichtelgebirge].
[251] Höchstadt im Fichtelgebirge [LK Wunsiedel im Fichtelgebirge].
[252] Wunsiedel; HHSD VII, S. 836f.
[253] betreten: antreffen.
[254] Waldershof [LK Tirschenreuth].
[255] Gemeint ist hier nicht ein „Generalbevollmächtigter“, wie Braun meint, sondern der Generalprofoss.
[256] Kroaten: (kroatische Regimenter in kaiserlichen und kurbayerischen Diensten), des „Teufels neuer Adel“, wie sie Gustav II. Adolf genannt hatte (GULDESCU, Croatian-Slavonian Kingdom, S. 130). Mit der (älteren) Bezeichnung „Crabaten“ (Crawaten = Halstücher) wurden die kroatischen Soldaten, die auf ihren Fahnen einen Wolf mit aufgesperrtem Rachen führten führten [vgl. REDLICH, De Praeda Militari, S. 21], mit Grausamkeiten in Verbindung gebracht, die von „Freireutern“ verübt wurden. „Freireuter“ waren zum einen Soldaten beweglicher Reiterverbände, die die Aufgabe hatten, über Stärke und Stellung des Gegners sowie über günstige Marschkorridore und Quartierräume aufzuklären. Diese Soldaten wurden außerdem zur Verfolgung fliehender, versprengter oder in Auflösung begriffener feindlicher Truppen eingesetzt. Diese Aufgabe verhinderte eine Überwachung und Disziplinierung dieser „Streifparteyen“ und wurde von diesen vielfach dazu genutzt, auf eigene Rechnung Krieg zu führen. Zum anderen handelte es sich bei „Freireutern“ um bewaffnete und berittene Bauern, die über Raubzüge Verwirrung hinter den feindlichen Linien schufen. Sie taten dies entweder mit Erlaubnis ihrer Kommandierenden, als integraler Bestandteil der kaiserlichen Kriegsführung, oder aber unerlaubter Weise – nicht ohne dabei z. T. drakonische Strafen zu riskieren. Diese „Freireuter“ stahlen und plünderten auf Bestellung der eigenen Kameraden sowie der Marketender, die ihrerseits einen Teil ihrer Einnahmen an die Obristen und Feldmarschälle abzuführen hatten. An Schlachten nahmen sie in der Regel nicht teil oder zogen sogar auch in der Schlacht ab. Zudem war „Kroaten“ ein zeitgenössischer Sammelbegriff für alle aus dem Osten oder Südosten stammenden Soldaten. Ihre Bewaffnung bestand aus Arkebuse, Säbel (angeblich „vergiftet“; PUSCH, Episcopali, S. 137; MITTAG, Chronik, S. 359, wahrscheinlich jedoch Sepsis durch den Hieb) und Dolch sowie meist 2 Reiterpistolen. Jeder fünfte dieser „kahlen Schelme Ungarns“ war zudem mit einer Lanze bewaffnet. SCHUCKELT, Kroatische Reiter; GULDESCU, Croatian-Slavonian Kingdom. Meist griffen sie Städte nur mit Überzahl an. Die Hamburger „Post Zeitung“ berichtete im März 1633: „Die Stadt Hoff haben an vergangenen Donnerstag in 1400. Crabaten in Grundt außgeplündert / vnnd in 18000 Thaller werth schaden gethan / haben noch sollen 1500. fl. geben / dass sie der Kirchen verschonet / deßwegen etliche da gelassen / die andern seind mit dem Raub darvon gemacht“. MINTZEL, Stadt Hof, S. 101. Zur Grausamkeit dieser Kroatenregimenter vgl. den Überfall der Kroaten Isolanis am 21.8.1634 auf Höchstädt (bei Dillingen) THEATRUM EUROPAEUM Bd. 3, S. 331f.; bzw. den Überfall auf Reinheim (Landgrafschaft Hessen-Darmstadt) durch die Kroaten des bayerischen Generalfeldzeugmeisters Jost Maximilian von Gronsfelds im Mai 1635: HERRMANN, Aus tiefer Not, S. 148ff.; den Überfall auf Reichensachsen 1635: GROMES, Sontra, S. 39: „1634 Christag ist von uns (Reichensächsern) hier gehalten, aber weil die Croaten in der Christnacht die Stadt Sontra überfallen und in Brand gestecket, sind wir wieder ausgewichen. Etliche haben sich gewagt hierzubleiben, bis auf Sonnabend vor Jubilate, da die Croaten mit tausend Pferden stark vor Eschwege gerückt, morgens von 7-11 Uhr mittags mit den unsrigen gefochten, bis die Croaten gewichen, in welchem Zurückweichen die Croaten alles in Brand gestecket. Um 10 Uhr hats in Reichensachsen angefangen zu brennen, den ganzen Tag bis an den Sonntags Morgen in vollem Brande gestanden und 130 Wohnhäuser samt Scheuern und Ställen eingeäschert. Von denen, die sich zu bleiben gewaget, sind etliche todtgestoßen, etlichen die Köpfe auf den Gaßen abgehauen, etliche mit Äxten totgeschlagen, etliche verbrannt, etliche in Kellern erstickt, etliche gefangen weggeführet, die elender gewesen als die auf der Stelle todt blieben, denn sie sind jämmerlich tractirt, bis man sie mit Geld ablösen konnte“. LEHMANN, Kriegschronik, S. 61, anlässlich des 2. Einfall Holks in Sachsen (1632): „In Elterlein haben die Crabaten unmanbare Töchter geschendet und auf den Pferden mit sich geführet, in und umb das gedreid, brod, auf die Bibel und bücher ihren mist auß dem hindern gesezt, In der Schletta [Schlettau] 21 bürger beschediget, weiber und Jungfern geschendet“. LANDAU, Beschreibung, S. 302f. (Eschwege 1637). Auf dem Höhepunkt des Krieges sollen über 20.000 Kroaten in kaiserlichen Diensten gestanden haben. In einem Kirchturmknopf in Ostheim v. d. Rhön von 1657 fand sich ein als bedeutsam erachteter Bericht für die Nachgeborenen über den Einfall kroatischer Truppen 1634; ZEITEL, Die kirchlichen Urkunden, S. 219-282, hier S. 233-239 [Frdl. Hinweis von Hans Medick, s. a. dessen Aufsatz: Der Dreißigjährige Krieg]. Vgl. BAUER, Glanz und Tragik; neuerdings KOSSERT, „daß der rothe Safft hernach gieng…“ http://home.arcor.de/sprengel-schoenhagen/2index/30jaehrigekrieg.htm: „Am grauenhaftesten hatte in dieser Zeit von allen Städten der Prignitz Perleberg zu leiden. Die Kaiserlichen waren von den Schweden aus Pommern und Mecklenburg gedrängt worden und befanden sich auf ungeordnetem Rückzug nach Sachsen und Böhmen. Es ist nicht möglich, alle Leiden der Stadt hier zu beschreiben.
Am ehesten kann man sich das Leid vorstellen, wenn man den Bericht des Chronisten Beckmann über den 15. November 1638 liest: ‚… Mit der Kirche aber hat es auch nicht lange gewähret, sondern ist an allen Ecken erstiegen, geöffnet und ganz und gar, nicht allein was der Bürger und Privatpersonen Güter gewesen, besonders aber auch aller Kirchenschmuck an Kelchen und was dazu gehöret, unter gotteslästerlichen Spottreden ausgeplündert und weggeraubet, auch ein Bürger an dem untersten Knauf der Kanzel aufgeknüpfet, die Gräber eröffnet, auch abermals ganz grausam und viel schlimmer, als je zuvor mit den Leuten umgegangen worden, indem sie der abscheulichen und selbst in den Kirchen frevelhafter und widernatürlicher Weise verübten Schändung des weiblichen Geschlechts, selbst 11- und 12-jähriger Kinder, nicht zu gedenken – was sie nur mächtig (haben) werden können, ohne Unterschied angegriffen, nackt ausgezogen, allerlei faules Wasser von Kot und Mist aus den Schweinetrögen, oder was sie am unreinsten und nächsten (haben) bekommen können, ganze Eimer voll zusammen gesammelt und den Leuten zum Maul, (zu) Nase und Ohren eingeschüttet und solch einen ‚Schwedischen Trunk oder Branntwein’ geheißen, welches auch dem damaligen Archidiakonus… widerfahren. Andern haben sie mit Daumschrauben und eisernen Stöcken die Finger und Hände wund gerieben, andern Mannspersonen die Bärte abgebrannt und noch dazu an Kopf und Armen wund geschlagen, einige alte Frauen und Mannsleute in Backöfen gesteckt und so getötet, eine andere Frau aus dem Pfarrhause in den Rauch gehängt, hernach wieder losgemacht und durch einen Brunnenschwengel in das Wasser bis über den Kopf versenket; andere an Stricken, andere bei ihren Haaren aufgehängt und so lange, bis sie schwarz gewesen, sich quälen lassen, hernach wieder losgemacht und andere Arten von Peinigung mit Schwedischen Tränken und sonsten ihnen angeleget. Und wenn sie gar nichts bekennen oder etwas (haben) nachweisen können, Füße und Hände zusammen oder die Hände auf den Rücken gebunden und also liegen lassen, wieder gesucht, und soviel sie immer tragen und fortbringen können, auf sie geladen und sie damit auf Cumlosen und andere Dörfer hinausgeführt, worüber dann viele ihr Leben (haben) zusetzen müssen, daß auch der Rittmeister der Salvegarde und andere bei ihm Seiende gesagt: Sie wären mit bei letzter Eroberung von Magdeburg gewesen, (es) wäre aber des Orts so tyrannisch und gottlos mit den Leuten, die doch ihre Feinde gewesen, nicht umgegangen worden, wie dieses Orts geschehen’“.
[257] Polacken: Die übliche, zunächst nicht pejorative Bezeichnung für die im kaiserlichen Heer wenig geschätzten polnischen Truppen, die hauptsächlich von Spanien besoldet und in habsburgischen Diensten standen. Die Kampfkraft dieser Truppen galt als gering. Einerseits galt ihre Führung als schwierig, andererseits waren sie wegen ihrer Tapferkeit und Geschicklichkeit im Umgang mit Muskete, Pistole, Säbel, Lanze und Wurfspeer gesuchte Söldner. Von Philipp Graf von Mansfeld-Vorderort stammt die negative Beurteilung: „Sie fressen wohl weder Samstag noch Freitag Butter oder Eier; sich aber sonsten für den katholischen Glauben, das Romische Reich oder auch ihr eigenes Vaterland einige Ungelegenheiten zu machen, seind sie ganz keine Leut. Wahrheit oder Ehr hat bei ihnen nicht länger Bestand, als wan es ihnen zum Profit dient; wan der aufhört, schwören sie für fünf Groschen einen Eid, ass Gott nie zur Welt geboren!“ HALLWICH, Wallensteins Ende, S. I51f. Vgl. auch LEHMANN, Kriegschronik (Oktober 1636), S. 89: Die polnischen Reiter „soffen sehr viel bier auß, machten es mit Plündern, schenden erger denn alle feinde, ritten uff die welde, durchschändeten die Weibsbilder, ass Sie nicht gehen kundten, nötigten die Steinalten Weiber, dass Sie starben, zernichteten alles in heußern, weil ihrethalben alles uff die Welder und in die Städte gewichen wahr, haben viel vergrabene sachen aufgesucht, vermaurete keller gefunden, zien und kupfer mitgenommen, kirchen erbrochen, kelche, leichen- und Altartücher mitgenommen. Den 31. October s. n. fiel das Fest aller heiligen ein, drumb blieben Sie liegen, feyerten es mit fasten und speisen nur von öhl, ass und fischen, wo sies haben kundten, wahren aber nichts desto frömmer und brachen an Sontag frühe auf und marchirten auf Presnitz und Wiesenthal. Das ärgste und grausambste an ihnen wahr, dass Sie schöne kinder, gleich wehren Sie Turcken oder Tartarn, mitgenommen“. WAGNER, Pforr, S. 129.
[258] Kemnath; HHSD VII, S. 351f.
[259] Generalgewaltiger: Der Generalprofoss, auch „Generalgewaltiger“ genannt, war der Dienstvorgesetzter der Profosse. Vgl. Schwedisches Kriegs-Recht; BERG, Administering justice, S. 9, 17.Der Profoss war ein militärischer, vielfach gefürchteter Offiziant, der die Einhaltung der Kriegsbestimmungen und Befehle, der Lager- und Marschordnung überwachte. Der Profoss zeigte die Zuwiderhandelnden beim Befehlshaber an, nahm sie fest, stellte sie vor Gericht und vollstreckte das vom Kriegsrichter, dem Auditeur, gesprochene Urteil. Dabei unterstützten ihn Knechte und Gehilfen. Es gab einen Profoss für jedes einzelne Regiment und einen Generalprofoss für die gesamte Armee. Der Generalprofossleutnant unterstand dem Generalprofoss.
[260] BRAUN, Marktredwitz, S. 135f.
[261] BRAUN, Marktredwitz, S. 137.
[262] Regensburg; HHSD VII, S. 605ff.
[263] Cham; HHSD VII, S. 124ff.
[264] BADURA; KOČÍ, Der große Kampf, Nr. 1136.
[265] Furth i. Wald [LK Cham]; HHSD VII, S. 221f.
[266] Klattau [Klatovy]; HHSBöhm, S. 262ff.
[267] Taus [Domažlice]; HHSBöhm, S. 598ff.
[268] Bischofteinitz (Horšovský Týn, Bez. Taus]; HHSBöhm, S. 35f.
[269] Pilsen [Plzeň]; HHSBöhm, S. 444ff.
[270] THEATRUM EUROPAEUM Bd. 4, S. 606.
[271] LEHMANN, Kriegschronik, S. 133.
[272] BADURA; KOČÍ, Der große Kampf, Nr. 1193.
[273] Jalousie: Missgunst, Eifersucht.
[274] THEATRUM EUROPAEUM Bd. 4, S. 618.
[275] Vgl. die ausgezeichnete Dissertation von SCHREIBER, Leopold Wilhelm; BRANDHUBER, Leopold Wilhelm; DEMEL, Leopold Wilhelm.
[276] Germersleben, vgl. Groß-Germersleben [Kr. Wanzleben]; HHSD XI, S. 155f.; Schöningen [Kr. Helmstedt]; HHSD II, S. 419f.
[277] Steterburg [Stadt Salzgitter]; HHSD II, S. 442f.
[278] Schöningen [Kr. Helmstedt]; HHSD II, S. 419f.
[279] WERSEBE, Geschichte, S. 32ff.
[280] Hildesheim; HHSD II, S. 228ff. Zu den Kriegsereignissen in Hildesheim vgl. auch PLATHE, Konfessionskampf.
[281] Gifhorn; HHSD II, S. 167ff.
[282] Dannenberg [Kr. Lüchow-Dannenberg]; HHSD II, S. 106f.
[283] Lüneburg; HHSD II, S. 311ff.
[284] Orrel bei Munster [Örtze] [LK Soltau-Fallingbostel]. ?
[285] Celle; HHSD II, S. 94ff.
[286] Wismar [Kr. Wismar]; HHSD XII, S. 133ff.
[287] Wolfenbüttel; HHSD II, S. 503ff.
[288] SCHLOTTER, Acta, S. 352.
[289] [Bad] Salzdetfurth [Kr. Hildesheim-Marienburg], HHSD II, S. 31f.
[290] Lamspringe [Kr. Alfeld]; HHSD II, S. 279f.
[291] SCHLOTTER, Acta, S. 358f.
[292] HÖBELT, „Wallsteinisch spielen“, S. 285.
[293] LORENTZEN, Die schwedische Armee, S. 100f.
[294] ENGELBERT, Hatzfeldt, Nr. 93.
[295] Nürnberg; HHSD VII, S. 530ff.
[296] Laubgewinde bei Festen.
[297] Flindergold, Flittergold meist aus Messing, z. T. aus vergoldetem Silber
[298] Wilhelm Kinsky bei JESSEN; Dreißigjähriger Krieg, ist falsch.
[299] http://ta.sandrart.net/edition/artwork/view/4720: „Das Kniestück zeigt den Generalmajor in schwedischen Diensten Adam von Pfuel (1604–1659) und entstand vermutlich anlässlich des Nürnberger Friedensexecutionskongresses“.
[300] Patte: Pfote.
[301] JESSEN, Dreißigjähriger Krieg, S. 402ff.
[302] Helfta, heute Ortsteil v. Eisleben [Kr. Mansfelder Seekreis/Eisleben]; HHSD XI, S. 206f.
[303] Polleben [LK Mansfeld-Südharz].
[304] Jahnsfelde, heute Ortsteil von Müncheberg [LK Märkisch-Oderland].
[305] http://www.literaturport.de.
Veröffentlicht unter Miniaturen
Verschlagwortet mit P
Kommentare deaktiviert für Pfuel [Pfull, Pfuhls, Phuell, Pfuell, Pfuhl] Adam von
Grunau, Daniel von
Grunau, Daniel von; Rittmeister [ – ] Daniel von Grunau [ – ] stand 1633 als Rittmeister[1] in schwedischen Diensten.[2]
Der Hofer Organist und Chronist Jobst Christoph Rüthner [1598-1648] aus Hof [3] berichtet: „Montags darauf den 17. junii des morgens mit dem allerfrühesten kam obrist[4] Taubadel[5] von Schlaiz[6] und das taubische[7] volck von Plauen[8] wie auch obristen Eßlebens[9] regiment[10] wieder hier an, fütterten in gaßen, nahmen das getraidig von closterböden[11] hinweg. Als es des morgens bis 4, halb 5 uhr kam, ließ ein starcker troup croaten[12] über das Gericht von Tauperlitz[13] sich sehen, derowegen eine parthey unter rittmeister Daniel von Grunau hinaus commandiret wurde. So die croaten innen worden, [sind sie] deswegen ausgerißen. Umb 6 uhr aber ruckt das ganze volck hinaus auf eine wiesen gegen die Münchberger[14] Straße zu, hielten randevous, darbey auch das erste mal unter freyen himmel betstunde, ruckten darauf fort gegen Münchberg, haben etliche wenige gefangen[15] bekommen. Nachmittags aber kam alles volck wieder, wurde einquartiret auf ein 5 häuser eine compagnie.[16] Folgends dienstags den 18. Junii brach alles wieder von hinnen zurück auf, mit welchen auch ein solch ausreisen[17] von hiesiger burgerschaft entstanden, dass mittwochs darauf den 19. junii, da sonst jährlich der herren geistlichen synodus allhier gehalten worden, wegen höchst besorglicher gefährlichkeit ein ein[z]iger geistlicher in der stadt verblieben, und ist eben an diesen Mittwoch auch die stadt Bayreuth, nachdem sie montags vorhero von general Holcky[18] attaquirt und von obristen Manteuffel[19] durch das pfälzische volck eingenommen, desgleichen auch Culmbach[20] und der vestung Plaßenburg,[21] davon ihnen aber mit stücken zimlich begegnet, angesonnen, eingenommen, ausspolirt[22] und theils geistliche, so angetroffen, als herr Bürschmann, todschießen bis zu erlegung 1500 thaler mitgenommen und gefänglich[23] weggeführet worden. Donnerstag am 12. jun[ii][24] ruckte das taubische regiment von Plauen wieder herauf, quartirete sich ein,[25] deme freytags das taubaldische regiment folgete und zugleich nebst obrist Eißlebens 3 compagnien, imgleichen von sattlerischen,[26] brandsteinischen,[27] groppischen, auf 48 trouppen zusammengerechnet, in die stadt logirt, da allezeit auf ein cornett[28] über 5 häußer zum quartier nicht gegeben werden können. Weil dann der mehrere theil der verderbten bürger ihre häußer verlassen und die sobalden nachmahls mit durchgrabung und verwüstung dermasen gehauset, dass diejenigen soldaten, so in wüsten quartieren gelegen, nochmals in die andern quartier, da noch hauswirthe vorhanden gewesen, gedrungen, ist den überbliebenen hauswirthen so grose bedrängnis wiederfahren, daß nicht zu beschreiben. Weil auch mittlerzeit die soldatesca mit abhauung des getraidigs auf dem felde grosen schaden und muthwillen[29] verübet in erwegung, sie auf den wießmahten graß genug haben können, als[o] ließ herr obrister Taubadel den 22. junii öffentlich bey leib- und lebensstrafe ausblaßen, auch unter den thoren anschlagen, sich des getraidigabhauens und verderbens zu hüten“.[30]
Um weitere Hinweise unter Bernd.Warlich@gmx.de wird gebeten !
[1] Rittmeister [schwed. ryttmåstere, dän. kaptajn]: Oberbefehlshaber eines Kornetts (später Esquadron) der Kavallerie. Sein Rang entspricht dem eines Hauptmannes der Infanterie (vgl. Hauptmann). Wie dieser war er verantwortlich für Werbung und Soldzahlung, für Disziplin, Ausrüstung und Verpflegung sowie für die Ernennung der untergebenen Führer. Oft war er in erster Linie für die materielle Versorgung der Truppe zuständig, und die eigentlich militärischen Aufgaben wurden von seinem Stellvertreter, dem Leutnant, übernommen. Bei den kaiserlichen Truppen standen unter ihm Leutnant, Kornett, Wachtmeister, 2 oder 3 Korporale, 1 Fourier oder Quartiermeister, 1 Musterschreiber, 1 Feldscher, 2 Trompeter, 1 Schmied, 1 Plattner. Bei den schwedischen Truppen fehlten dagegen Sattler und Plattner, bei den Nationalschweden gab es statt Sattler und Plattner 1 Feldkaplan und 1 Profos, was zeigt, dass man sich um das Seelenheil als auch die Marsch- und Lagerdisziplin zu kümmern gedachte. Der Rittmeister beanspruchte in einer Kompanie Kürassiere 150 fl. Monatssold, d. h. 1.800 fl. jährlich, während ein bayerischer Kriegsrat 1637 jährlich 792 fl. erhielt, 1620 war er in der brandenburgischen Armee als Rittmeister über 50 Pferde nur mit 25 fl. monatlich datiert gewesen. Als kommandierender Rittmeister einer Streifschar einer Besatzung erhielt er auf 1.000 Rt. Beute und Ranzionierungen quasi als Gefahrenzuschlag 59 Rt. 18 Alb. 4 Heller; HOFMANN, Peter Melander. Bei seiner Bestallung wurde er in der Regel durch den Obristen mit Werbe- und Laufgeld zur Errichtung neuer Kompanien ausgestattet. Junge Adlige traten oft als Rittmeister in die Armee ein.
[2] schwedische Armee: Trotz des Anteils an ausländischen Söldnern (ca. 85 %; nach GEYSO, Beiträge II, S. 150, Anm., soll Banérs Armee 1625 bereits aus über 90 % Nichtschweden bestanden haben) als „schwedisch-finnische Armee“ bezeichnet. Die Unterscheidung zwischen der „Royal-Armee“, die v. Gustav II. Adolf selbst geführt wurde, u. den v. den Feldmarschällen seiner Konföderierten geführten „bastanten“ Armeen erscheint angesichts der Operationen der letzteren überflüssig. Nach LUNDKVIST, Kriegsfinanzierung, S. 384, betrug der Mannschaftsbestand (nach altem Stil) im Juni 1630 38.100, Sept. 1631 22.900, Dez. 1631 83.200, Febr./März 1632 108.500, Nov. 1632 149.200 Mann; das war die größte paneuropäische Armee vor Napoleon. 9/10 der Armee Banérs stellten deutsche Söldner; GONZENBACH, Der General Hans Ludwig von Erlach von Castelen II, S. 130. Schwedischstämmige stellten in dieser Armee einen nur geringen Anteil der Obristen. So waren z. B. unter den 67 Generälen und Obristen der im Juni 1637 bei Torgau liegenden Regimenter nur 12 Schweden; die anderen waren Deutsche, Finnen, Livländern, Böhmen, Schotten, Iren, Niederländern und Wallonen; GENTZSCH, Der Dreißigjährige Krieg, S. 208. Vgl. die Unterredung eines Pastors mit einem einquartierten „schwedischen“ Kapitän, Mügeln (1642); FIEDLER, Müglische Ehren- und Gedachtnis-Seule, S. 208f.: „In dem nun bald dieses bald jenes geredet wird / spricht der Capitain zu mir: Herr Pastor, wie gefället euch der Schwedische Krieg ? Ich antwortet: Der Krieg möge Schwedisch / Türkisch oder Tartarisch seyn / so köndte er mir nicht sonderlich gefallen / ich für meine Person betete und hette zu beten / Gott gieb Fried in deinem Lande. Sind aber die Schweden nicht rechte Soldaten / sagte der Capitain / treten sie den Keyser und das ganze Römische Reich nicht recht auff die Füsse ? Habt ihr sie nicht anietzo im Lande ? Für Leipzig liegen sie / das werden sie bald einbekommen / wer wird hernach Herr im Lande seyn als die Schweden ? Ich fragte darauff den Capitain / ob er ein Schwede / oder aus welchem Lande er were ? Ich bin ein Märcker / sagte der Capitain. Ich fragte den andern Reuter / der war bey Dreßden her / der dritte bey Erffurt zu Hause / etc. und war keiner unter ihnen / der Schweden die Zeit ihres Lebens mit einem Auge gesehen hette. So haben die Schweden gut kriegen / sagte ich / wenn ihr Deutschen hierzu die Köpffe und die Fäuste her leihet / und lasset sie den Namen und die Herrschafft haben. Sie sahen einander an und schwiegen stille“. Vgl. auch das Streitgespräch zwischen einem kaiserlich und einem schwedisch Gesinnten „Colloquium Politicum“ (1632). Zur Fehleinschätzung der schwedischen Armee (1642): FEIL, Die Schweden in Oesterreich, S. 355, zitiert [siehe VD17 12:191579K] den Jesuiten Anton Zeiler (1642): „Copey Antwort-Schreibens / So von Herrn Pater Antoni Zeylern Jesuiten zur Newstadt in under Oesterreich / an einen Land-Herrn auß Mähren / welcher deß Schwedischen Einfalls wegen / nach Wien entwichen / den 28 Junii An. 1642. ergangen : Darauß zu sehen: I. Wessen man sich bey diesem harten und langwürigen Krieg in Teutschland / vornemlich zutrösten habe / Insonderheit aber / und für das II. Was die rechte und gründliche Ursach seye / warumb man bißher zu keinem Frieden mehr gelangen können“. a. a. O.: „Es heisst: die Schweden bestünden bloss aus 5 bis 6000 zerrissenen Bettelbuben; denen sich 12 bis 15000 deutsche Rebellen beigesellt. Da sie aus Schweden selbst jährlich höchstens 2 bis 3000 Mann ‚mit Marter und Zwang’ erhalten, so gleiche diese Hilfe einem geharnischten Manne, der auf einem Krebs reitet. Im Ganzen sei es ein zusammengerafftes, loses Gesindel, ein ‚disreputirliches kahles Volk’, welches bei gutem Erfolge Gott lobe, beim schlimmen aber um sein Erbarmen flehe“. Im Mai 1645 beklagte Torstensson, dass er kaum noch 500 eigentliche Schweden bei sich habe, die er trotz Aufforderung nicht zurückschicken könne; DUDÍK, Schweden in Böhmen und Mähren, S. 160.
[3] Hof; HHSD VII, S. 302f.
[4] Obrist [schwed. överste, dän. oberst]: I. Regimentskommandeur oder Regimentschef mit legislativer und exekutiver Gewalt, „Bandenführer unter besonderem Rechtstitel“ (ROECK, Als wollt die Welt, S. 265), der für Bewaffnung und Bezahlung seiner Soldaten und deren Disziplin sorgte, mit oberster Rechtsprechung und Befehlsgewalt über Leben und Tod. Dieses Vertragsverhältnis mit dem obersten Kriegsherrn wurde nach dem Krieg durch die Verstaatlichung der Armee in ein Dienstverhältnis umgewandelt. Voraussetzungen für die Beförderung waren (zumindest in der kurbayerischen Armee) richtige Religionszugehörigkeit (oder die Konversion), Kompetenz (Anciennität und Leistung), finanzielle Mittel (die Aufstellung eines Fußregiments verschlang 1631 in der Anlaufphase ca. 135.000 fl.) und Herkunft bzw. verwandtschaftliche Beziehungen (Protektion). Zum Teil wurden Kriegskommissare wie Johann Christoph Freiherr v. Ruepp zu Bachhausen zu Obristen befördert, ohne vorher im Heer gedient zu haben; Bayerisches Hauptstaatsarchiv München Kurbayern Äußeres Archiv 2398, fol. 577 (Ausfertigung): Ruepp an Maximilian I., Gunzenhausen, 1631 XI 25. Der Obrist ernannte die Offiziere. Als Chef eines Regiments übte er nicht nur das Straf- und Begnadigungsrecht über seine Regimentsangehörigen aus, sondern er war auch Inhaber einer besonderen Leibkompanie, die ein Kapitänleutnant als sein Stellvertreter führte. Ein Obrist erhielt in der Regel einen Monatssold von 500-800 fl. je nach Truppengattung, 500 fl. zu Fuß, 600 fl. zu Roß [nach der „Ordnung Wie es mit der verpflegung der Soldaten“ (1630)] in der kurbrandenburgischen Armee 1.000 fl. „Leibesbesoldung“ nebst 400 fl. Tafelgeld und 400 fl. für Aufwärter. In besetzten Städten (1626) wurden z. T. 920 Rt. erpresst (HEIMATMUSEUM SCHWEDT, Die Uckermark, S. 15). Nach Wallensteins Verpflegungsordnung (1629) standen ihm als Obrist und Hauptmann der Infanterie 800 Rt. monatlich zu; KRAUSE, Urkunden 1. Bd., S. 460. Daneben bezog er Einkünfte aus der Vergabe von Offiziersstellen. Weitere Einnahmen kamen aus der Ausstellung von Heiratsbewilligungen, aus der Beute – hier standen ihm 27 Rt. 39 Albus pro 1.000 Rt. Beute zu; HOFMANN, Peter Melander, S. 156 – und aus Ranzionsgeldern, Verpflegungsgeldern, Kontributionen, Ausstellung von Salvagardia-Briefen – die er auch in gedruckter Form gegen entsprechende Gebühr ausstellen ließ, im Schnitt für 5 Rt., – und auch aus den Summen, die dem jeweiligen Regiment für Instandhaltung und Beschaffung von Waffen, Bekleidung und Werbegeldern ausgezahlt wurden. Da der Sold teilweise über die Kommandeure ausbezahlt werden sollten, behielten diese einen Teil für sich selbst oder führten „Blinde“ oder Stellen auf, die aber nicht besetzt waren. Auch ersetzten sie zum Teil den gelieferten Sold durch eine schlechtere Münze. Zudem wurde der Sold unter dem Vorwand, Ausrüstung beschaffen zu müssen – Obristen belieferten ihr Regiment mit Kleidung, Waffen und Munition – , gekürzt oder die Kontribution unterschlagen. BELLINCKHAUSEN; TEGEDER; KREIENBRINK, der osnabrugischenn handlung, S. 277 (1634) zur schwedischen Garnison: „Am gemelten dingstage sein 2 Soldaten bey mir hergangen bey r[atsherr] Joh[ann] Fischers hause. Der ein sagt zum andern: In 3 Wochen habe ich nur 12 ß [Schilling = 6 Heller = 12 Pfennig; das entsprach insgesamt dem Tageslohn eines Maurers; BW]. Ich wol, das der donner und der blytz inn der statt schlüge, das es bränte und kein hauß stehen bliebe. Muß das nicht Gott erbarmen. Wir burger mußen alle wochen unse contribution zahlen, die obristen nehmmens geldt zu sich, und die gemeinen soldaten mußen hunger leyden“.
Zur brandenburgischen Armee heißt es; OELSNITZ, Geschichte, S. 64: „Fälle, daß die Obersten mit ihren Werbegeldern durchgingen, gehörten nicht zu den größten Seltenheiten; auch stimmte bei den Musterungen die Anzahl der anwesenden Mannschaften außerordentlich selten mit den in der Kapitulation bedingten. So sollte das Kehrberg’sche [Carl Joachim v. Karberg; BW] Regiment 1638 auf 600 Mann gebracht werden, es kam aber nie auf 200. Es wurde dem Obersten der Proceß gemacht, derselbe verhaftet und kassirt. Aehnlich machte es der Oberst Rüdiger v. Waldow [Rüdiger [Rötcher] v. Waldow; BW] und es ließen sich noch viele ähnliche Beispiele aufführen“. Vgl. BELLINCKHAUSEN; TEGEDER; KREIENBRINK, der osnabrugischen handlung, S. 277: „Wir burger mußen alle wochen unse contribution zahlen, die obristen nehmmens geldt zu sich, und die gemeinen soldaten mußen hunger leyden“. Der Austausch altgedienter Soldaten durch neugeworbene diente dazu, ausstehende Soldansprüche in die eigene Tasche zu stecken. Zu diesen „Einkünften“ kamen noch die üblichen „Verehrungen“, die mit dem Rang stiegen und nichts anderes als eine Form von Erpressung darstellten, und die Zuwendungen für abgeführte oder nicht eingelegte Regimenter („Handsalben“) und nicht in Anspruch genommene Musterplätze; abzüglich allerdings der monatlichen „schwarzen“ Abgabe, die jeder Regimentskommandeur unter der Hand an den Generalleutnant oder Feldmarschall abzuführen hatte; Praktiken, die die obersten Kriegsherrn durchschauten. Zudem erbte er den Nachlass eines ohne Erben und Testament verstorbenen Offiziers. Häufig stellte der Obrist das Regiment in Klientelbeziehung zu seinem Oberkommandierenden auf, der seinerseits für diese Aufstellung vom Kriegsherrn das Patent erhalten hatte. Der Obrist war der militärische ‚Unternehmer‘, die eigentlich militärischen Dienste wurden vom Major geführt. Das einträgliche Amt – auch wenn er manchmal „Gläubiger“-Obrist seines Kriegsherrn wurde – führte dazu, dass begüterte Obristen mehrere Regimenter zu errichten versuchten (so verfügte Werth zeitweise sogar über 3 Regimenter), was Maximilian I. von Bayern nur selten zuließ oder die Investition eigener Geldmittel von seiner Genehmigung abhängig machte. Im April 1634 erging die kaiserliche Verfügung, dass kein Obrist mehr als ein Regiment innehaben dürfe; ALLMAYER-BECK; LESSING, Kaiserliche Kriegsvölker, S. 72. Die Möglichkeiten des Obristenamts führten des Öfteren zu Misshelligkeiten und offenkundigen Spannungen zwischen den Obristen, ihren karrierewilligen Obristleutnanten (die z. T. für minderjährige Regimentsinhaber das Kommando führten; KELLER, Drangsale, S. 388) und den intertenierten Obristen, die auf Zeit in Wartegeld gehalten wurden und auf ein neues Kommando warteten. Zumindest im schwedischen Armeekorps war die Nobilitierung mit dem Aufstieg zum Obristen sicher. Zur finanziell bedrängten Situation mancher Obristen vgl. dagegen OMPTEDA, Die von Kronberg, S. 555. Da der Obrist auch militärischer Unternehmer war, war ein Wechsel in die besser bezahlten Dienste des Kaisers oder des Gegners relativ häufig. Der Regimentsinhaber besaß meist noch eine eigene Kompanie, so dass er Obrist und Hauptmann war. Auf der Hauptmannsstelle ließ er sich durch einen anderen Offizier vertreten. Ein Teil des Hauptmannssoldes floss in seine eigenen Taschen. Dazu beanspruchte er auch die Verpflegung. OELSNITZ, Geschichte, S. 64f.: Der kurbrandenburgische Geheime Rat Adam Graf zu „Schwarzenberg spricht sich in einem eigenhändigen Briefe (22. August 1638) an den Geheimen Rath etc. v. Blumenthal [Joachim Friedrich Freiherr v. Blumenthal; BW] sehr nachtheilig über mehrere Obersten aus und sagt: ‚weil die officierer insgemein zu geitzig sein und zuviel prosperiren wollen, so haben noch auf die heutige stunde sehr viele Soldaten kein qvartier Aber vnter dem schein als ob Sie salvaguardien sein oder aber alte reste einfodern sollen im landt herumb vagiren vnd schaffen ihren Obristen nur etwas in den beutel vnd in die küch, Es gehöret zu solchen dantz mehr als ein paar weißer schue, das man dem General Klitzingk [Hans Kaspar [Caspar] v. Klitzing; BW] die dispositiones vom Gelde und vonn proviant laßen sollte, würde, wan Churt borxtorff [Konrad [Kurt] Alexander Magnus v. Burgsdorff; BW] Pfennigmeister vnd darvber custos wehre der katzen die kehle befohlen sein, wir haben vnd wissen das allbereit 23 Stäbe in Sr. Churf. Drchl. Dienst vnd doch ist kein einsiger ohne der alte Obrister Kracht [Hildebrand [Hillebrandt] v. Kracht; BW] der nit auß vollem halse klaget als ob Man Ihme ungerecht wehre, ob Sie In schaden gerieten, Man sol sie vornemen Insonderheit die, welche 2000 zu lievern versprochen vnd sich nit 300 befinden vndt sol also exempel statuiren – aber wer sol Recht sprechen, die höchste Im kriegsrath sein selber intressirt vnd mit einer suppen begossen“. Ertragreich waren auch Spekulationen mit Grundbesitz oder der Handel mit (gestohlenem) Wein (vgl. BENTELE, Protokolle, S. 195), Holz, Fleisch oder Getreide. Zum Teil führte er auch seine Familie mit sich, so dass bei Einquartierungen wie etwa in Schweinfurt schon einmal drei Häuser „durch- und zusammen gebrochen“ wurden, um Raum zu schaffen; MÜHLICH; HAHN, Chronik 3. Bd., S. 504. Die z. T. für den gesamten Dreißigjährigen Krieg angenommene Anzahl von rund 1.500 Kriegsunternehmern, von denen ca. 100 bis 300 gleichzeitig agiert hätten, ist nicht haltbar, fast alle Regimentsinhaber waren zugleich auch Kriegs- bzw. Heeresunternehmer. II. Manchmal meint die Bezeichnung „Obrist“ in den Zeugnissen nicht den faktischen militärischen Rang, sondern wird als Synonym für „Befehlshaber“ verwandt. Vgl. KAPSER, Heeresorganisation, S. 101ff.; BOCKHORST, Westfälische Adelige, S. 15ff., REDLICH, German military enterpriser; DAMBOER, Krise; WINKELBAUER, Österreichische Geschichte 1. Bd., S. 413ff.
[5] Georg Christoph v. Taupadel [Tupadel, Tupadell, Taubadel, Toupadel, Tubal, Taubald, Thobadel, Dupadel, Dubald, Dubadell, Dubalt, „Raupartl“, Teupold] [um 1600 Fichtenberg-12.3.1647 Basel], schwedisch-französischer Generalleutnant.
[6] Schleiz [Saale-Orla-Kreis]; HHSD IX, S. 380ff.
[7] Veit Dietrich v. Taube [Tauben] [1594-1645], kursächsischer Obrist.
[8] Plauen [Vogtland]; HHSD VIII, S. 279ff.
[9] Christoph Friedrich v. Eßleben [Esleben] [ – ], schwedisch-weimarischer Obrist.
[10] Regiment: Größte Einheit im Heer, aber mit höchst unterschiedlicher Stärke: Für die Aufstellung eines Regiments waren allein für Werbegelder, Laufgelder, den ersten Sold und die Ausrüstung 1631 bereits ca. 135.000 fl. notwendig. Zum Teil wurden die Kosten dadurch aufgebracht, dass der Obrist Verträge mit Hauptleuten abschloss, die ihrerseits unter Androhung einer Geldstrafe eine bestimmte Anzahl von Söldnern aufbringen mussten. Die Hauptleute warben daher Fähnriche, Kornetts und Unteroffiziere an, die Söldner mitbrachten. Adlige Hauptleute oder Rittmeister brachten zudem Eigenleute von ihren Besitzungen mit. Wegen der z. T. immensen Aufstellungskosten kam es vor, dass Obristen die Teilnahme an den Kämpfen mitten in der Schlacht verweigerten, um ihr Regiment nicht aufs Spiel zu setzen. Der jährliche Unterhalt eines Fußregiments von 3.000 Mann Soll-Stärke wurde mit 400- 450.000 fl. eines Reiterregiments von 1.200 Mann mit 260.-300.000 fl. angesetzt. Zu den Soldaufwendungen für die bayerischen Regimenter vgl. GOETZ, Kriegskosten Bayerns, S. 120ff.; KAPSER, Kriegsorganisation, S. 277ff. Ein Regiment zu Fuß umfasste de facto bei den Kaiserlichen zwischen 650 und 1.100, ein Regiment zu Pferd zwischen 320 und 440, bei den Schweden ein Regiment zu Fuß zwischen 480 und 1.000 (offiziell 1.200 Mann), zu Pferd zwischen 400 und 580 Mann, bei den Bayerischen 1 Regiment zu Fuß zwischen 1.250 und 2.350, 1 Regiment zu Roß zwischen 460 und 875 Mann. Das Regiment wurde vom Obristen aufgestellt, von dem Vorgänger übernommen und oft vom seinem Obristleutnant geführt. Über die Ist-Stärke eines Regiments lassen sich selten genaue Angaben finden. Das kurbrandenburgische Regiment Carl Joachim v. Karberg [Kerberg] sollte 1638 sollte auf 600 Mann gebracht werden, es kam aber nie auf 200. Karberg wurde der Prozess gemacht, er wurde verhaftet und kassiert; OELSNITZ, Geschichte, S. 64. Als 1644 der kaiserliche Generalwachtmeister Johann Wilhelm v. Hunolstein die Stärke der in Böhmen stehenden Regimenter feststellen sollte, zählte er 3.950 Mann, die Obristen hatten 6.685 Mann angegeben. REBITSCH, Gallas, S. 211; BOCKHORST, Westfälische Adlige.
[11] Das ehemalige Klara-Klöster war Getreidelager.
[12] Kroaten: kroatische Regimenter in kaiserlichen und kurbayerischen Diensten, des „Teufels neuer Adel“, wie sie Gustav II. Adolf genannt hatte (GULDESCU, Croatian-Slavonian Kingdom, S. 130). Mit der (älteren) Bezeichnung „Crabaten“ (Crawaten = Halstücher) wurden die kroatischen Soldaten, die auf ihren Fahnen einen Wolf mit aufgesperrtem Rachen führten [vgl. REDLICH, De Praeda Militari, S. 21], mit Grausamkeiten in Verbindung gebracht, die von „Freireutern“ verübt wurden. „Freireuter“ waren zum einen Soldaten beweglicher Reiterverbände, die die Aufgabe hatten, über Stärke und Stellung des Gegners sowie über günstige Marschkorridore und Quartierräume aufzuklären. Diese Soldaten wurden außerdem zur Verfolgung fliehender, versprengter oder in Auflösung begriffener feindlicher Truppen eingesetzt. Diese Aufgabe verhinderte eine Überwachung und Disziplinierung dieser „Streifparteien“ und wurde von diesen vielfach dazu genutzt, auf eigene Rechnung Krieg zu führen. Vgl. GOTTFRIED, ARMA SVEVICA, S. 85 (1630): „Die Crabaten litten dieser Zeit von den Schwedischen viel schaden / weil es bey ihnen viel stattliche Beuten gab. Dann sie hatten theils Gürtel voller Gold und Silber vmb den Leib / auch gantze Blatten von Gold vnd Silber geschlagen vor der Brust“. Zudem war „Kroaten“ ein zeitgenössischer Sammelbegriff für alle aus dem Osten oder Südosten stammenden Soldaten. Ihre Bewaffnung bestand aus Arkebuse, Säbel (angeblich „vergiftet“; PUSCH, Episcopali, S. 137; MITTAG, Chronik, S. 359, wahrscheinlich jedoch Sepsis durch den Hieb) und Dolch sowie meist 2 Reiterpistolen. Jeder fünfte dieser „kahlen Schelme Ungarns“ war zudem mit einer Lanze bewaffnet. SCHUCKELT, Kroatische Reiter; GULDESCU, Croatian-Slavonian Kingdom. Meist griffen sie Städte nur mit Überzahl an. Die Hamburger „Post Zeitung“ berichtete im März 1633: „Die Stadt Hoff haben an vergangenen Donnerstag in 1400. Crabaten in Grundt außgeplündert / vnnd in 18000 Thaller werth schaden gethan / haben noch sollen 1500. fl. geben / dass sie der Kirchen verschonet / deßwegen etliche da gelassen / die andern seind mit dem Raub darvon gemacht“. MINTZEL, Stadt Hof, S. 101. Zur Grausamkeit dieser Kroatenregimenter vgl. den Überfall der Kroaten Isolanis am 21.8.1634 auf Höchstädt (bei Dillingen) THEATRUM EUROPAEUM Bd. 3, S. 331f.; bzw. den Überfall auf Reinheim (Landgrafschaft Hessen-Darmstadt) durch die Kroaten des bayerischen Generalfeldzeugmeisters Jost Maximilian von Gronsfelds im Mai 1635: HERRMANN, Aus tiefer Not, S. 148ff.; den Überfall auf Reichensachsen 1635: GROMES, Sontra, S. 39: „1634 Christag ist von uns (Reichensächsern) hier gehalten, aber weil die Croaten in der Christnacht die Stadt Sontra überfallen und in Brand gestecket, sind wir wieder ausgewichen. Etliche haben sich gewagt hierzubleiben, bis auf Sonnabend vor Jubilate, da die Croaten mit tausend Pferden stark vor Eschwege gerückt, morgens von 7-11 Uhr mittags mit den unsrigen gefochten, bis die Croaten gewichen, in welchem Zurückweichen die Croaten alles in Brand gestecket. Um 10 Uhr hats in Reichensachsen angefangen zu brennen, den ganzen Tag bis an den Sonntags Morgen in vollem Brande gestanden und 130 Wohnhäuser samt Scheuern und Ställen eingeäschert. Von denen, die sich zu bleiben gewaget, sind etliche todtgestoßen, etlichen die Köpfe auf den Gaßen abgehauen, etliche mit Äxten totgeschlagen, etliche verbrannt, etliche in Kellern erstickt, etliche gefangen weggeführet, die elender gewesen als die auf der Stelle todt blieben, denn sie sind jämmerlich tractirt, bis man sie mit Geld ablösen konnte“. LEHMANN, Kriegschronik, S. 61, anlässlich des 2. Einfall Holks in Sachsen (1632): „In Elterlein haben die Crabaten unmanbare Töchter geschendet und auf den Pferden mit sich geführet, in und umb das gedreid, brod, auf die Bibel und bücher ihren mist auß dem hindern gesezt, In der Schletta [Schlettau] 21 bürger beschediget, weiber und Jungfern geschendet“. LANDAU, Beschreibung, S. 302f. (Eschwege 1637). Auf dem Höhepunkt des Krieges sollen über 20.000 Kroaten in kaiserlichen Diensten gestanden haben. In einem Kirchturmknopf in Ostheim v. d. Rhön von 1657 fand sich ein als bedeutsam erachteter Bericht für die Nachgeborenen über den Einfall kroatischer Truppen 1634; ZEITEL, Die kirchlichen Urkunden, S. 219-282, hier S. 233-239 [Frdl. Hinweis von Hans Medick, s. a. dessen Aufsatz: Der Dreißigjährige Krieg]. Vgl. BAUER, Glanz und Tragik; neuerdings KOSSERT, „daß der rothe Safft hernach gieng…“, S. 75: „In einer Supplik der niederhessischen Stände an Landgraf Wilhelm V. von Hessen-Kassel aus dem Jahr 1637 heißt es beispielsweise, die „unchristlichen Croaten“ hätten ‚den Leute[n] die Zungen, Nasen und Ohren abgeschnitten, die augen außgestochen, Nägel in die Köpff und Füsse geschlagen, heis Blech, Zinn und allerhand Unflat, durch die Ohren, Nasen und den Mund, in den Leib gegossen [und] etzliche durch allerhand Instrumenta schmertzlich gemartert’ “. http://home.arcor.de/sprengel-schoenhagen/2index/30jaehrigekrieg.htm: „Am grauenhaftesten hatte in dieser Zeit von allen Städten der Prignitz Perleberg zu leiden. Die Kaiserlichen waren von den Schweden aus Pommern und Mecklenburg gedrängt worden und befanden sich auf ungeordnetem Rückzug nach Sachsen und Böhmen. Es ist nicht möglich, alle Leiden der Stadt hier zu beschreiben.
Am ehesten kann man sich das Leid vorstellen, wenn man den Bericht des Chronisten Beckmann über den 15. November 1638 liest: ‚… Mit der Kirche aber hat es auch nicht lange gewähret, sondern ist an allen Ecken erstiegen, geöffnet und ganz und gar, nicht allein was der Bürger und Privatpersonen Güter gewesen, besonders aber auch aller Kirchenschmuck an Kelchen und was dazu gehöret, unter gotteslästerlichen Spottreden ausgeplündert und weggeraubet, auch ein Bürger an dem untersten Knauf der Kanzel aufgeknüpfet, die Gräber eröffnet, auch abermals ganz grausam und viel schlimmer, als je zuvor mit den Leuten umgegangen worden, indem sie der abscheulichen und selbst in den Kirchen frevelhafter und widernatürlicher Weise verübten Schändung des weiblichen Geschlechts, selbst 11- und 12-jähriger Kinder, nicht zu gedenken – was sie nur mächtig (haben) werden können, ohne Unterschied angegriffen, nackt ausgezogen, allerlei faules Wasser von Kot und Mist aus den Schweinetrögen, oder was sie am unreinsten und nächsten (haben) bekommen können, ganze Eimer voll zusammen gesammelt und den Leuten zum Maul, (zu) Nase und Ohren eingeschüttet und solch einen ‚Schwedischen Trunk oder Branntwein’ geheißen, welches auch dem damaligen Archidiakonus… widerfahren. Andern haben sie mit Daumschrauben und eisernen Stöcken die Finger und Hände wund gerieben, andern Mannspersonen die Bärte abgebrannt und noch dazu an Kopf und Armen wund geschlagen, einige alte Frauen und Mannsleute in Backöfen gesteckt und so getötet, eine andere Frau aus dem Pfarrhause in den Rauch gehängt, hernach wieder losgemacht und durch einen Brunnenschwengel in das Wasser bis über den Kopf versenket; andere an Stricken, andere bei ihren Haaren aufgehängt und so lange, bis sie schwarz gewesen, sich quälen lassen, hernach wieder losgemacht und andere Arten von Peinigung mit Schwedischen Tränken und sonsten ihnen angeleget. Und wenn sie gar nichts bekennen oder etwas (haben) nachweisen können, Füße und Hände zusammen oder die Hände auf den Rücken gebunden und also liegen lassen, wieder gesucht, und soviel sie immer tragen und fortbringen können, auf sie geladen und sie damit auf Cumlosen und andere Dörfer hinausgeführt, worüber dann viele ihr Leben (haben) zusetzen müssen, daß auch der Rittmeister der Salvegarde und andere bei ihm Seiende gesagt: Sie wären mit bei letzter Eroberung von Magdeburg gewesen, (es) wäre aber des Orts so tyrannisch und gottlos mit den Leuten, die doch ihre Feinde gewesen, nicht umgegangen worden, wie dieses Orts geschehen’ „. METEREN, Newer Niederländischen Historien Vierdter Theil, S. 41: „Diese [Kroaten; BW] nach dem sie die Thor deß Stättleins [Penkun (LK Vorpmmern-Greifswald); BW] zerbrochen / haben sie mit grossem Grimm auff dem Schloß / in der Kirche / in der Pfarr / in den Häusern / Ja auch unerhörter Weise in den Todtengräbern gesuchet: Das Korn theils außgetroschen vnnd hinweg geführet / theils auch zertretten / die Inwohner hefftig geschlagen vnnd biß auff den Todt gemartert / daß sie solten sagen / ob sie Gelt vergraben hetten / vnder denselben haben sie auch deß Pastorn nicht verschonet / der ihnen doch vor diesem alle Ehr vnnd Freundschafft erwiesen: Vnnd welches das allerärgste / haben sie Weibspersonen genothzüchtiget vnd geschändet / vnnd so sich etliche im Wasser vnder dem Rohr / oder sonst verborgen / haben die Crabaten / als deß Teuffels rechte Spürhund / solche auffgesucht / vnd wie das Vieh zur Vnzucht vor sich hergetrieben / auch ein theils Mannspersonen / so ihre Weiber vnnd Kinder wider solchen Teufflischen Muthwillen vnnd Gewalt vertheidigen wollen / jämmerlich erschossen vnd nidergehawen. Vnd dergleichen Vnzucht haben sie auch an Mägdelein von acht vnnd zehen Jahren zu treiben vnd am hellen Tag auff den Kirchhöfen / öfffentlichen Gassen vnd Gärten zu begehen / sich nicht geschewet“. Vgl. auch die Beschreibung des Kroateneinfalls in Neustadt a. d. Aisch am 18.7.1632 => Kehraus [Kerauß, Kehrauß], Andreas Matthias in den „Miniaturen“, bzw. die Aufzeichnungen des Pfarrers Lucas, Trusen (Anfang Januar 1635); LEHMANN, Leben und Sterben, S. 129: „[…] die Dorfschaften sind nacheinander alle ausgeplündert, die Leute übel geschlagen und beraubt worden, einige tot geblieben, Elmenthal und Laudenbach und Heßles sind ganz ledig [menschenleer] diese Zeit über gestanden, alles an Heu, Stroh, Holz hinweg ist geführt worden, das Getreide in den Scheunen ist ausgedroschen oder sonst verdorben worden, die Häuser sind zerschlagen, das Eisenwerk an Türen und Läden, Bratkacheln, Ofenblasen sind ausgebrochen und hinweg genommen worden [ …] sind über 300 Kroaten zu Elmenthal und Laudenbach gewesen, dort geplündert und folgenden Tag nach Brotterode gezogen und dort auch großen Schaden verübt, indem sie allein 100 Pferde allhier weggenommen, des anderen Viehs zu geschweigen, mancher Mensch ist übel traktiert worden, viele sind in großen Schaden gekommen, zu Herges sind alle Pferde hinweg genommen, desgleichen mehrentheils auch die Schafe und jungen Lämmer, in der Auwallenburg sind über 3 Kühe nicht verblieben, sondern alle hinweg genommen worden […]“.THEATRUM EUROPAEUM 2. Band, S. 630 (1631): „Den 10. Martii sind die Crabaten ein halbe Meil von der Prager Newstatt / zimblich starck zu Roß vnnd Fuß ankommen / ein schönes Dorf Micheln genant / in Brand gesteckt / Mann / Weib / vnnd Kinder / was nicht entlauffen können / entweder nidergehawen oder ins Fewer gejaget : ist also groß Elend gewesen. Das verbrandte Stroh hat der Wind / weil er gleich darbey entstanden / biß nach Prag gar auff die Brücke getrieben. Die Sächsische haben sich zwar alsbald zu Roß vnnd Fuß hinauß begeben / in Meynung sich an die Crabaten zumachen: aber selbige hatten sich vor jhrer Ankunfft schon weg gemacht / vnd vnderwegens noch etliche Dörffer angezündet“. WERTHER, Chronik der Stadt Suhl 1. Bd., S. 226f. (1634): „In einem Umlaufschreiben wies die gemeinschaftliche Regierung und das Consistorium zu Meiningen darauf hin: ‚Es gehen viele und große Sünden wider das sechste und siebente Gebot im Schwange, da die Weibspersonen sich leichtfertig an die Croaten gehänget“. Gefangene Kroaten wurden schon unter Gustav II. Adolf von den Schweden in ihre Kupferbergwerke verbracht; THEATRUM EUROPAEUM 2. Bd., S. 349; METEREN, Newer Niederländischen Historien Vierdter Theil, S. 87.
[13] Döhlau-Tauperlitz, südöstlich von Hof gelegen.
[14] Münchberg [LK Hof]; HHSD VII, S. 464.
[15] Kriegsgefangene: Zur Gefangennahme vgl. die Reflexionen des Söldners Monro bei MAHR, Monro, S. 46: „Es ist für einen Mann besser, tüchtig zu kämpfen und sich rechtzeitig zurückzuziehen, als sich gefangennehmen zu lassen, wie es am Morgen nach unserem Rückzug vielen geschah. Und im Kampf möchte ich lieber ehrenvoll sterben als leben und Gefangener eines hartherzigen Burschen sein, der mich vielleicht in dauernder Haft hält, so wie viele tapfere Männer gehalten werden. Noch viel schlimmer ist es, bei Gefangennahme, wie es in gemeiner Weise immer wieder geübt wird, von einem Schurken nackt ausgezogen zu werden, um dann, wenn ich kein Geld bei mir habe, niedergeschlagen und zerhauen, ja am Ende jämmerlich getötet zu werden: und dann bin ich nackt und ohne Waffen und kann mich nicht verteidigen. Man Rat für den, der sich nicht entschließen kann, gut zu kämpfen, geht dahin, daß er sich dann wenigstens je nach seinem Rang gut mit Geld versehen soll, nicht nur um stets selbst etwas bei sich zu haben, sondern um es an einem sicheren Ort in sicheren Händen zu hinterlegen, damit man ihm, wenn er gefangen ist, beistehen und sein Lösegeld zahlen kann. Sonst bleibt ihm nichts anderes übrig, als sich zu entschließen, in dauernder Gefangenschaft zu bleiben, es sei denn, einige edle Freunde oder andere haben mit ihm Mitleid“. Nach LAVATER, KRIEGSBüchlein, S. 65, hatten folgende Soldaten bei Gefangennahme keinerlei Anspruch auf Quartier (Pardon): „wann ein Soldat ein eysen, zinne, in speck gegossen, gekäuete, gehauene oder gevierte Kugel schiesset, alle die gezogene Rohr und französische Füse [Steinschloßflinten] führen, haben das Quartier verwirkt. Item alle die jenigen, die von eysen geschrotete, viereckige und andere Geschröt vnd Stahel schiessen, oder geflammte Dägen, sollt du todt schlagen“. Leider reduziert die Forschung die Problematik der de facto rechtlosen Kriegsgefangenen noch immer zu einseitig auf die Alternative „unterstecken“ oder „ranzionieren“. Der Ratsherr Dr. Plummern berichtet (1633); SEMLER, Tagebücher, S. 65: „Eodem alß die von Pfullendorff avisirt, daß ein schwedischer reütter bei ihnen sich befinnde, hatt vnser rittmaister Gintfeld fünf seiner reütter dahin geschickht sollen reütter abzuholen, welliche ihne biß nach Menßlißhausen gebracht, allda in dem wald spolirt vnd hernach zu todt geschoßen, auch den bauren daselbst befohlen in den wald zu vergraben, wie beschehen. Zu gleicher zeit haben ettlich andere gintfeldische reütter zu Langen-Enßlingen zwo schwedische salvaguardien aufgehebt vnd naher Veberlingen gebracht, deren einer auß Pommern gebürtig vnd adenlichen geschlächts sein sollen, dahero weiln rittmaister Gintfeld ein gůtte ranzion zu erheben verhofft, er bei leben gelassen wird“. Der Benediktiner-Abt Gaisser berichtet zu 1633; STEMMLER, Tagebuch Bd. 1, S. 415: „Der Bürger August Diem sei sein Mitgefangener gewesen, für den er, falls er nicht auch in dieser Nacht entkommen sei, fürchte, daß er heute durch Aufhängen umkomme. Dieser sei, schon vorher verwundet, von den Franzosen an den Füßen in einem Kamin aufgehängt und so lange durch Hängen und Rauch gequält worden, bis das Seil wieder abgeschnitten worden sei und er gerade auf den Kopf habe herabfallen dürfen“. Soldaten mussten sich mit einem Monatssold freikaufen, für Offiziere gab es je nach Rang besondere Vereinbarungen zwischen den Kriegsparteien. Das Einsperren in besondere Käfige, die Massenhinrichtungen, das Vorantreiben als Kugelfang in der ersten Schlachtreihe, die Folterungen, um Auskünfte über Stärke und Bewegung des Gegners zu erfahren, die Hungerkuren, um die „Untersteckung“ zu erzwingen etc., werden nicht berücksichtigt. Frauen, deren Männer in Gefangenschaft gerieten, erhielten, wenn sie Glück hatten, einen halben Monatssold bis zwei Monatssolde ausgezahlt und wurden samt ihren Kindern fortgeschickt. KAISER, Kriegsgefangene; KROENER, Soldat als Ware. Die Auslösung konnte das eigene Leben retten; SEMLER, Tagebücher, S. 65: „Zu gleicher zeitt [August 1630] haben ettlich andere gintfeldische reütter zu Langen-Enßlingen zwo schwedische salvaguardien aufgehebt vnd nacher Veberlingen gebracht, deren einer auß Pommern gebürtig vnd adenlichen geschlächte sein sollen, dahero weiln rittmeister Gintfeld eine gůtte ranzion zu erheben verhofft, er bei leben gelassen worden“. Teilweise beschaffte man über sie Informationen; SEMLER, Tagebücher, S. 70 (1633): „Wie beschehen vnd seyn nahendt bei der statt [Überlingen; BW] vier schwedische reütter, so auf dem straiff geweßt, von vnsern tragonern betretten [angetroffen; BW], zwen darvon alsbald nidergemacht, zwen aber, so vmb quartier gebeten, gefangen in die statt herein gebracht worden. Deren der eine seines angebens Christian Schultheß von Friedland [S. 57] auß dem hertzogthumb Mechelburg gebürtig vnder der kayßerlichen armada siben jahr gedient vnd diesen sommer zu Newmarckht gefangen vnd vndergestoßen [am 30.6.1633; BW] worden: der ander aber von Saltzburg, vnderm obrist König geritten vnd zu Aichen [Aichach; BW] in Bayern vom feind gefangen vnd zum dienen genötiget worden. Vnd sagte der erste bei hoher betheurung vnd verpfändung leib vnd lebens, dass die schwedische vmb Pfullendorff ankomne vnd noch erwartende armada 24 regimenter starck, vnd werde alternis diebus von dem Horn vnd hertzogen Bernhard commandirt; führen 4 halb carthaunen mit sich vnd ettlich klainere veld stückhlin. Der ander vermainte, daß die armada 10.000 pferdt vnd 6.000 zu fůß starckh vnd der so geschwinde aufbruch von Tonawerd [Donauwörth; BW] in diese land beschehen seye, weiln man vernommen, dass die kayserische 8000 starckh in Würtemberg eingefallen“. Auf Gefangenenbefreiung standen harte Strafen. Pflummern hält in seinem Tagebuch fest: „Martij 24 [1638; BW] ist duca Federico di Savelli, so in dem letzsten vnglückhseeligen treffen von Rheinfelden den 3 Martij neben dem General von Wert, Enckefort vnd andern obristen vnd officiern gefangen vnd bis dahin zu Lauffenburg enthallten worden, durch hilff eines weibs auß: vnd den bemellten 24 Martij zu Baden [Kanton Aargau] ankommen, volgenden morgen nach Lucern geritten vnd von dannen nach Costantz vnd seinem vermellden nach fürter zu dem general Götzen ihne zu fürderlichem fortzug gegen den feind zu animirn passirt. Nach seinem außkommen seyn ein officier sambt noch einem soldaten wegen vnfleißiger wacht vnd der pfarherr zu Laufenburg neben seinem capellan auß verdacht, daß sie von deß duca vorhabender flucht waß gewüßt, gefänglich eingezogen, die gaistliche, wie verlautt, hart torquirt [gefoltert; BW], vnd obwoln sie vnschuldig geweßt, offentlich enthauptet; die ihenige fraw aber, durch deren hauß der duca sambt seinem camerdiener außkommen, vnd noch zwo personen mit růthen hart gestrichen worden“. Der Benediktoner-Abt Gaisser berichtet über die Verschiffung schwedischer Gefangener des Obristen John Forbes de Corse von Villingen nach Lindau (1633); STEMMLER, Tagebücher Bd. 1, S. 319: „Abschreckend war das Aussehen der meisten gemeinen Soldaten, da sie von Wunden entkräftet, mit eigenem oder fremdem Blute besudelt, von Schlägen geschwächt, der Kleider und Hüte beraubt, viele auch ohne Schuhe, mit zerrissenen Decken behängt, zu den Schiffen mehr getragen als geführt wurden, mit harter, aber ihren Taten angemessener Strafe belegt“. Gefangene waren je nach Vermögen darauf angewiesen, in den Städten ihren Unterhalt durch Betteln zu bestreiten. Sie wurden auch unter Offizieren als Geschenk gebraucht; KAISER, Wohin mit den Gefangenen ?, in: http://dkblog.hypotheses.org/108: „Im Frühsommer 1623 hatte Christian von Braunschweig, bekannt vor allem als ‚toller Halberstädter’, mit seinen Truppen in der Nähe Göttingens, also im Territorium seines älteren Bruders Herzog Friedrich Ulrich, Quartier genommen. In Scharmützeln mit Einheiten der Armee der Liga, die damals im Hessischen operierte, hatte er einige Gefangene gemacht. Was sollte nun mit diesen geschehen? Am 1. Juli a. St. wies er die Stadt Göttingen an, die gefangenen Kriegsknechte nicht freizulassen; vielmehr sollte die Stadt sie weiterhin ‚mit nottürfftigem vnterhalt’ versorgen, bis andere Anweisungen kämen. Genau das geschah wenige Tage später: Am 7. Juli a. St. erteilte Christian seinem Generalgewaltiger (d. h. der frühmodernen Militärpolizei) den Befehl, daß er ‚noch heutt vor der Sonnen vntergangk, viertzig dero zu Göttingen entthaltenen gefangenen Soldaten vom feinde, den Lieutenantt vnd Officiers außsgenommen, Laße auffhencken’. Um den Ernst der Anweisung zu unterstreichen, fügte er hinzu, daß dies ‚bei vermeidung vnser hochsten vngnad’ geschehen solle. Der Generalgewaltiger präsentierte daraufhin der Stadt Göttingen diesen Befehl; bei der dort überlieferten Abschrift findet sich auf der Rückseite die Notiz vom Folgetag: ‚Vff diesen Schein seindt dem Gewalthiger 20 Gefangene vff sein darneben mundtlich andeuten ausgevolgtt worden’. Der Vollzug fand also offenbar doch nicht mehr am 7. Juli, am Tag der Ausfertigung des Befehls, statt. Aber es besteht kaum ein Zweifel, daß zwanzig Kriegsgefangene mit dem Strang hingerichtet wurden. (StA Göttingen, Altes Aktenarchiv, Nr. 5774 fol. 2 Kopie; der Befehl an die Stadt Göttingen vom 1.7.1623 a.St. ebd. fol. 32 Ausf.)“. Teilweise wurden Gefangene auch unter den Offizieren verkauft; MÜHLICH; HAHN, Chronik 3. Bd., S. 607 (Schweinfurt 1645). Zur Problematik vgl. KAISER, Kriegsgefangene in der Frühen Neuzeit, S. 11-14.
[16] Kompanie [schwed. kompani, dän. kompany]: Eine Kompanie zu Fuß (kaiserlich, bayerisch und schwedisch) umfasste von der Soll-Stärke her 100 Mann, doch wurden Kranke und Tote noch 6 Monate in den Listen weiter geführt, so dass ihre Ist-Stärke bei etwa 70-80 Mann lag. Eine Kompanie zu Pferd hatte bei den Bayerischen 200, den Kaiserlichen 60, den Schwedischen 80, manchmal bei 100-150, zum Teil allerdings auch nur ca. 30. Geführt wurde die Fußkompanie von einem Hauptmann, die berittene Kompanie von einem Rittmeister. Vgl. TROUPITZ, Kriegs-Kunst. Vgl. auch „Kornett“, „Fähnlein“, „Leibkompanie“.
[17] Flucht: Überlebensstrategie in Kriegszeiten. Der Schuhmacher Hans Heberle listet in seinem „Zeytregister“ 30 Fluchten nach Ulm auf. ZILLHARDT, Zeytregister, S. 225; DEMURA, Flucht, S. 187ff. Der Bieberauer Pfarrer Johann Daniel Minck; KUNZ/LIZALEK, Südhessische Chroniken, S. 253f.: „Viele verkrochen und versteckten sich zwar in Wälder, Höhlen, Klippen etc., waren aber ausgespähet, denn die [kaiserlich-bayerischen] Soldaten hatten bei sich menschenspürige Hunde, welche, wann sie an Mensch und Vieh kamen, mit ihrem Bellen die Leute verrieten und den Räubern Anzeig gaben. Darumb flohe alles auf die Schlösser. Da lagen alle Gassen, Höfe und Winkel voller Leute, besonders zu Lichtenberg, welches ein kleiner Behelf. Und derhalben auch viele im Regen, Schnee und Kälte unter dem freien Himmel lagen, teils lagen in Fässern und Bütten. Die Stuben waren Winterszeit so voll, dass wegen der Menge keines sitzen, sondern dicht ineinander stehen müssen. War ein groß Jammer und Elend anzusehen, zu geschweigen, selbst mit darin begriffen sein“. BENTELE, Protokolle, S. 192 (1634): „Des andern Tags, als man vernommen, dass die ganze Armee marchiere, haben sich Mann und Weib mit den Kindern in das Feld, Weinberg, Hülen, Klüften und Wäld mehistentails begeben, in Hoffnung, daselbsten sicher zue sein, bis das Ungewitter fürübergieng. Aber die wurden allerorten durch die Hund der Soldaten ausgespürt, gehetzt, gejagt, gefangen, ranzioniert, übel tractiert, und tails erbärmlich ermordet. War auch zu solcher Zeit Tag und Nacht schön und warm Wetter auf vierzehn Tag aneinander, daß doch also mancher dessentwegen desto besser in einem verborgenen Winkel durch Gottes väterliche Obacht bewahret gewesen, und sein Leben wie eine Ausbeut darvon gebracht hat“. Abt Veit Höser (1577-1634) von Oberaltaich bei Straubing berichtet; SIGL, Wallensteins Rache, S. 142f.: „In diesen Tagen [Dezember 1633; BW] trieben es die Schweden überall ganz arg. Sie streiften in alle Richtungen und Gegenden herum, durchstöberten sogar die menschenleeren Ödnisse und Wälder, alle Berghänge, jedes Tal, jede Schlucht, jeden Schlupfwinkel, daß die Menschen sich vor Todesängsten überhaupt nicht mehr auskannten, sich nicht mehr helfen und raten konnten. Unter dem eigenen Dache gab es ja ohnehin keine Sicherheit. In ihrer Bedrängnis flohen alle aus ihren Wohnungen, als wären das selbst Räuberhöhlen, flüchteten in die Berge, versteckten sich in Hecken, im Dickicht, in der Wildnis, obgleich sie auch dort nirgends bleiben konnten wegen der Winterkälte, die in unserer Waldgegend noch viel ärger ist. Wenn sie sich überhaupt ein Feuer machen konnten, verriet sie schon von weitem der aufsteigende Rauch bei Tag und bei Nacht der Feuerschein; ja, die Flucht in ein Versteck verriet sie selbst schon wieder durch die unvermeidlich im Schnee hinterlassenen eigenen Spuren. Die schlauen Spürhunde folgten mit ihrer Nase diesen tiefen Fußstapfen und spürten den Flüchtlingen fleißig nach, ohne deren Todesängste zu spüren. Schau, laß dir sagen, was diese ungemein scharfsinnigen Bösewichte nicht alles aushecken, damit ihnen ja kein einziger Mensch entwischt. Überall in den Wäldern, in Dickichten, auf Viehtriften, wo sich einer geflissentlich verstecken könnte, veranstalteten sie blutige Treibjagden (veneticam tragediam). Sie stellten Reihen von Scharfschützen in einem größeren Abstand voneinander auf und durchstreiften so das vom Eingang her das Gelände, indem sie obendrein noch abgerichtete Jagd- und Spürhunde vor sich herhetzten. Diese reizten sie mit ihrem Hussa-Hussa zum Bellen, ließen sie durchs Dickicht und Gebüsch stöbern, nach Feuerstellen schnüffeln, schickten sie in unzugängliche Stellen, damit sie überall die versteckten Menschen ausmachen, mit ihrem Verbellen verraten und heraustreiben. In undurchdringliches Heckengestrüpp (truteta) schossen sie mit ihren Gewehren hinein, um die allenfalls darin verborgenen Menschen zu zwingen, dass sie herauskriechen oder herausspringen. Wollten solche arme „Angsthasen“ jedoch sofort bei dem Hussa-Geschrei der Jäger und dem Hundegebell der unausbleiblichen Flucht zuvorkommen und davonlaufen, wurden sie dort von den Musketieren zur Strecke gebracht, die den Wald von draußen in regelmäßigen Abständen voneinander umzingelt hatten, sodaß die ohnehin schon zu Tode geängstigten Menschen, wohin sie auch immer flüchten wollten, in die Fänge und Fallen dieser Menschenjäger fielen“. Auch die Heranziehung zu schwersten Schanzarbeiten veranlasste Bürger zur Flucht. Das Einfliehen in die nächsten Städte war allerdings nicht umsonst. Im März 1636 verlangte die Reichsstadt Nordhausen von hereingeflüchteten Adligen über 20 Jahren 2 Reichstaler, von Bürgern und Bürgerinnen 1 Reichstaler, von einem Bauern je nach Vermögen 12 oder 6 Groschen. Für ein fremdes Pferd waren 12 Groschen zu zahlen. KUHLBRODT, Clara von Heringen, S. 82. Dazu kamen in der Regel auch Abgaben für Ochsen, Kühe etc. In Weimar hielten sich 1640 außer 2863 Einwohnern 4103 Fremde auf. PFISTER, Bevölkerungsgeschichte, S. 14. Zum Teil ließ der Rat wie in Augsburg die Flüchtlinge aus der Stadt bringen (SIGL, Geschichte, S. 47) oder verweigerte die Aufnahme. Zur Migration allgemein ASCHE, Krieg, Militär und Migration, S. 11ff. Die Flucht in die nächsten Städten war nicht umsonst. Im März 1636 verlangte die Reichsstadt Nordhausen von hereingeflüchteten Adligen über 20 Jahren 2 Reichstaler, von Bürgern und Bürgerinnen 1 Taler, von einem Bauern je nach Vermögen 12 oder 6 Groschen. Für ein fremdes Pferd waren 12 Groschen zu zahlen. KUHLBRODT, Clara von Heringen, S. 82. Dazu kamen in der Regel auch Abgaben für Ochsen, Kühe etc. KLUGE, Hofer Chronik, S. 180 (1641): „Den 11. januarii wurde der sächßischen von adel hier eingeflehet rindt- und schaafvieh, so theils zum thor hinaus, alles wieder hereingetrieben und aufs neue verarrestiret, und solten von einem stück rindvieh 1 thaler, von einem schaaf aber 1 groschen geben, unangesehen, daß das liebe vieh zum theil dermassen verhungert, daß es kaum gehen konnte, wie dann auch viel dahingefallen und aus mangel futters umkommen müßen“. In Weimar hielten sich z. B. 1640 außer 2863 Einwohnern 4103 Fremde auf. PFISTER, Bevölkerungsgeschichte, S. 14. Geflohenen Bürgern drohte man mit dem Verlust des Bürgerrechts und erlegte ihnen die dreifache Steuer auf. Zudem führte die Überfüllung mancher Städte durch Flüchtlinge zum Ausbruch von Seuchen und der Ausbreitung eingeschleppter Krankheiten.
[18] Heinrich Reichsgraf v. Holk [Holck, Holcke, Holcky, Holka] [28.4.1599 Kronborg auf Sjælland-9.9.1633 Troschenreuth], kaiserlicher Feldmarschall. Vgl. ARENDT, Holks Faktotum.
[19] Eberhard Zoege v. Manteufel [Montaiffel] [ -13.10.1633 bei Alesheim], kurbayerischer Obrist.
[20] Kulmbach [LK Kulmbach]; HHSD VII, S. 379f.
[21] Plassenburg, Die [Stadt Kulmbach]; HHSD VII, S. 587.
[22] ausspoliert: ausgeplündert.
[23] Menschenraub: ein übliches Vorgehen, um an Lösegeld heranzukommen oder Gefangene zu „vernehmen“. SEMLER, Tagebücher, S. 138f. (1634): „Hierauff die Schwedische ihre gewohnliche straiff vnd raubereyen noch ferner vnd ernstlicher continuirt, also daß nicht allein auf dem land vnd dörffern sich niemandt betreffen, sonder auch gar in die reben (außerhalb was gegen Sipplingen hinab gelegen, dahin der feind niehmaln kommen) niemandt blicken lassen dörffen, inmaßen ettliche burger vnd salmanßweilische vnderthonen, so in den reben bei vnd gegen Nußdorf und Burgberg schaffen wollen, von denen hin vnd wider vagierenden reüttern aufgehebt, vnd nach Pfullendorf geführt, deren jeder biß auf 60 vnd mehr reichsthaler ranzion angezogen, vnd weilen sie, alß arme rebleütt sollche zu bezahlen nicht vermögt, volgendts mit der armada fortgeführt worden, wie benantlich ein veberlingischer gmainder vmb 68 thaler vnd zwen Nußdorffer jeder vmd 58 thaler ranzioniert, vnd vneracht diese bede für sich 40 thaler angebotten, ein mehrers auch im vermögen nit gehabt, seyn sie doch bei sollchem nicht gelaßen worden“.
[24] Richtig wäre der 20. Juni.
[25] Einquartierung: Die kostenaufwendige Einquartierung von Truppen versuchten die Betroffenen oder ihre Vertreter nach Möglichkeit durch „Verehrungen“ bei den zuständigen Kommandierenden, Kriegskommissaren und Quartiermeistern abzuwenden. Gelang das nicht, so wurden je nach Rang, Vermögen und Steueraufkommen und auch der Religionszugehörigkeit der Betroffenen Mannschaften und Pferde in die Häuser eingelegt, wobei die Soldaten die besten Räume für sich in Anspruch nahmen. Billette (Einquartierungszettel) sollten zwar Unterkunft, Verpflegung (oder ersatzweise Geldleistungen) der Soldaten und Abgabe von Viehfutter durch ihre „Wirte“ regeln, was aber nicht nur zu Streitigkeiten in der Bürgerschaft selbst, sondern auch unter den Soldaten führen musste. Ausgenommen von der Einquartierung waren in der Regel bei eigenen Truppeneinlagerungen Kleriker (aber nicht deren Klöster), Universitätsangehörige, Bürgermeister, Ratsherrn, Apotheker, Ärzte und Gastwirte. 50-75% Anteil in Bezug auf die Bevölkerungszahl galt es verkraftbar. Auf die Beschwerden der Bürgerschaft wurde die Einquartierung durch den Rat der Stadt „als eine gerechte und für eure vielfältigen Sünden wohl verdiente Strafe Gottes“ bezeichnet; BORKOWSKY, Schweden, S. 20. Nach dem Überlinger Dr. Pflummern; SEMLER, Tagebücher, S. 393 (1642); sind „dise völckher zu roß vnd fůß nicht darumb zu vnß kommen, vnß oder daß land vor dem feind zu sichern, oder gegen denselbigen sich im veld sehen zu lassen, sonder allein hinder den mauren oder vnderm tach den bauch vnd seckhel zu füllen vnd alßdan den weeg weitter zu nemmen vnd vnß dem feind zum raub zu hinderlassen“. In den Quartieren gab es zudem Mord und Totschlag unter den Mannschaften, gewalttätige Übergriffe gegen Bürger und Bauern waren trotz errichteter Quartiergalgen und hölzerner Esel alltäglich. Teilweise wurde sogar Quartiergeld für die von Offizieren mitgeführten Hunde verlangt; SODEN, Gustaph Adolph III, S. 359. Teilweise wurde auch der Abzug vorgetäuscht, um Abzugsgelder zu erpressen; TRÄGER, Magister Adrian Beiers Jehnische Chronika, S. 60. Der protestantische Schuhmacher Bellinckhausen über die kaiserlichen Truppen in Osnabrück (1630); BELLINCKHAUSEN; TEGEDER; KREIENBRINK, S. 36: „Was denn inquartirten soldaten bey uns thut anlangen, ist ein gottlos diebisch und mordrisch volck, stehlenn jeymlich und rauben offenbar, saufen und fressen, dominirn tag und nacht, spielen und doblen, parten und beuten, ruffen und jautzen, schießen und morden sich unter andern, schlagen sich mit den burgern, verfuhrn der burger weiber und kinder und haben manig magd zur hurn gemacht. Die burger konnen bey abendts oder nacht zeyt nicht uber die straßen gehen. Sie schlagen dieselben, habe auch solchs zweymall von dem gesind leyden m mußen“. Beschwerdeschreiben Wernigerodes über Hamiltons Schotten (1632); NÜCHTERLEIN, Wernigerode, S. 108.: „die hier liegenden Schottischen Soldaten wollten mit ihren Wirthen und deren Lägern nicht zufrieden sein, trieben die Leute aus ihren Ehebetten, brächten Gesellschaft mit, gingen mit Sporen und Stiefeln zu Bett, aus denen sie dreitätige Kindbetterinnen jagten. Würde ihnen etwas gesagt, prügelten sie die Leute; sie vernichteten ihrer Wirthe Handwerkszeug. Kein Quartier sei ihnen gut genug, sie wollten stattliche Palatia haben. Wären die Wirthe nicht zu Hause, schlügen sie die Thüren ein. Der Oberste perturbire den Magistrat in seinen, indem er die Preise der Dinge vorschreibe, unter den Vorgeben, der Rath setze sie ihm zum Tort so hoch. Wollte man diese Waren für diese Preise nicht hingeben, so drohte er, sie gerade wegzunehmen“. Eine längere Einquartierung konnte den Ruin ganzer Gemeinden und Städte bedeuten. Zudem wurden die Quartiere verwüstet. So der Abt Friesenegger von Andechs über die einquartierten katholischen „welschen“ Truppen Ferias (Winter 1634): „Das Dorf stand ganz in Unflat, und Wüste, alles zum Grausen, und für Menschen unbegreiflich. In den Häusern wie auf den Gassen lagen nichts als abscheuliche Lumpen, zerschlagener Hausrat, Köpfe, Füße, und Gedärme von verzehrten Pferden, Menschen Unrat, und mehrere Toten Körper. In den Häusern waren nur Stuben, Kammer und Kuchl bewahret, das übrige davon hatte ein Dach, keinen Mantel, keine Mittelwand, keinen Balken, und meistens standen dieselben nur auf vier Säulen. Die Zäune, Planken, und schönste Obstbäume in den Gärten waren alle verbrennet. Auch aller Hausrat von Bänken, Kästen, Bettstätten, Geschirren, und die Baufahrnisse von Wägen, Pflügen, und was immer von Holz war, ging in den Flammen auf. Selbst in beiden Kirchen war ein Greuel zu sehen. Türen, und auch Fenster waren zerbrochen. Alles, was darin aufbewahret, und zum Gebrauch war, wurde geraubet. In der Frauenkirche brannten sie wenigst die letzte Woche eines, und in der Pfarrkirche stets 2 Feuer. Alles hölzerne Kirchengerät mußte hierzu dienen. Das Gemäuer war voll Rauch und Ruß, und der Boden voll Unrat. Auf dem Friedhofe konnte man vor Menschen-Unflat keinen Fuß mit Ehren setzen, und die Sakristei brauchten sie für ihr geheimes Ort. In der Kirche zu U. L. Frau lagen auch 4 unbegrabene Toten-Körper, die man außer der Kirche auf der Nordseite, wo schon mehrere lagen, in ein Grab zusammen warf“. Auch der Abzug musste je nach Vermögen erkauft werden (1644): „Zum Abzuge mußte dem Obristen von jedem Pfluge 20 Rtlr. und das beste Pferd gegeben werden.“ WALCZOK, Barsbüttel, Gott und die Welt. Vgl. den Bericht der Kapitelherren in Zeitz (1635), BORKOWSKY, Schweden, S. 65: „Keine Brauerei, keine Krämerei ist mehr im Stift, keine Feldbestellung, kein Ackerpferd, keine Kuh, kein Kleinvieh. Hie und da müssen sich Manns- und Weibspersonen in die Pflüge und Eggen spannen – was sonst nur als barbarische Grausamkeit aus der Türkei berichtet war. Häuser und Hütten stehen ohne Dach. Die Menschen haben keine Kleidung mehr. Viele sind im Winter erfroren, andere an Hunger, Krankheit und Mangel an Arznei dahingestorben. Die Leichen liegen unbegraben. Weiber und Kinder fallen den Kommunen zur Last. Viele Bürger laufen zu den Soldaten über. Die Kirchen- und Schuldiener können nicht mehr besoldet werden. Die Jugend bleibt unerzogen. Hospitäler und Armenhäuser werden nicht mehr unterstützt. Viele Menschen sind so jämmerlich gekleidet, dass sie sich nicht getrauen, zum Gottesdienst und zum Abendmahl zu gehen …“ VOGEL, Leipzigisches Geschicht-Buch, S. 443: „Den 11 Junii [1631; BW] zur Nacht hat sich eines vornehmen Doctoris Frau im Brühl / welches mit schwermüthigen Gedancken beladen aufm Gange im Hembde an eine Quele erhencket / weil sie / wie man sagte / denen Soldaten Quartier und Geld geben müssen / welche 2 alte Weiber loßgeschnitten / von Todtengräbern abgehohlet / und den 13. dieses mit einer kleinen Schule begraben worden“. Leipzig 1643; VOGEL, Leipzigisches Geschicht-Buch, S. 609: „Den 2 Augusti hat sich ein 70jähriger Mann / Richter zu Zwey Nauendorff / aus Furcht / weil er von dem Käyserlichen Anmarch gehöret / selbst erhencket“.
[26] Philipp [Filip] Sattler [Sadler] v. Salnecke [2.12.1594 Scheinfeld-20.9.1641 Stockholm], Diplomat, Obrist der Kavallerie u. Kriegsrat.
[27] Christoph Carl Graf v. Brandenstein [Bradsten], Freiherr zu Oppurg u. Knau [1593 Oppurg-1637 Dresden] schwedischer Reichsschatzmeister, Obrist.
[28] Kornett: die kleinste Einheit der Reiterei mit eigenen Feldzeichen, entsprach der Kompanie; 1 berittene Kompanie hatte in der kursächsischen Armee ca. 125 Pferde, 1 schwedische Reiterkompanie umfasste in der Regel 80 Mann. Der Kornett erhielt ca. 50 fl. Monatssold; nach Wallensteins Verpflegungsordnung (1629) standen ihm bei der Infanterie 60 Rt. monatlich zu; KRAUSE, Urkunden 1. Bd., S. 460; z. T. wurden allerdings 240 Rt. (!) in besetzten Städten (1626) erpresst (HEIMATMUSEUM SCHWEDT, Die Uckermarck, S. 15). => Fähnrich; Fahne.
[29] „Mutwillen“: beschöningender Ausdruck für Ausschreitungen aller Art, die man z. T. nicht mitteilen wollte. Der Überlinger Advokat Pflummern (März 1633); SEMLER, Tagebücher, S. 23: „Gleicher můtwillen auch an den burgern, die in den reben gewerckhet, verüebt, die arme leutt veriagt, thailß aufgefangen vnd genötiget worden mitzulauffen vnd den weeg zu weisen, den sie doch selbst allen anzeigungen nach gewüßt vnd derhalben die leutt nhur an ihrer arbeit hindern vnd plagen wollen“.
[30] KLUGE, Hofer Chronik, S. 20. Vgl. auch WIDMANN, Chronik der Stadt Hof, S. 363.
Sack [Sock], Otto von
Sack [Sock], Otto von; Obrist [1589 Trikaten/Livland-16.11.1658 Stockholm]
 Der Livländer Otto von Sack [Sock] [1589 Trikaten/Livland-16.11.1658 Stockholm] stand zuletzt als Obrist[1] in schwedischen Diensten.[2] 1633 sind in den schwedischen Listen 293 Kavalleristen unter seinem Befehl aufgeführt,[3] 4 Kompanien[4] nahmen unter ihm an der Schlacht bei Hessisch- Oldendorf[5] bzw. bzw. 240 Mann[6] an der Belagerung und Einnahme der noch von den Ligisten[7] gehaltenen Weserfestung Hameln[8] teil. In einer zeitgenössischen Flugschrift über die Schlacht bei Hessisch-Oldendorf (28.6./8.7.1633) heißt es „Aus einem andern Schreiben“: „Demnach S. Excell. der Herr Feldmarschalch[9] die Conjunction deß Graffen von Gronßfeld[10] mit Meroden[11] vnd Benninghausen[12] geschehen lassen müssen / hat er sich mit allen beyhabenden Trouppen / als den General Majeur[13] Kachen[14] vnnd Melander[15] wiederumb ins Läger den 29. dieses retirirt / die Reuter vnd Volck nahe bey Woll[16] campirt / vnd vberall gute ordre gestellet / damit nicht etwa ein Einfall geschehen / oder er an constanten vorgenommenen propos[17] in comportirung[18] der Stadt Hameln[19] verhindert werden möchte / Darauff seynd wie weiland 4 junge Grafen vnnd Herrn / als der von Gronßfeld / so commãdirt, Merode / Benninghausen / vnd der von Wertenberg[20] / der H. von Gleen[21] vñ andere von Minden[22] außgefolget / vnd den 27. dieses vffn Abend etwa vm die Glock 3. bey Schaumburg[23] zwischen Oldendorff vnd 2. Dörffern / als Tode[24] vnd Wolstorff[25] / etwa eine Meile[26] von vnserm Lager vor Hameln gesetzt / vnd 12000. Mann, 8000. zu Fuß vnd 4000. zu Pferde / effectivè (wie die vornehme Gefangene[27] fast alle aussagen / sollen da 14000. Mann complet gewesen seyn) starck in Batallie[28] gestellet / auch mit vier Canonschüssen den Belagerten die Loßkündigung gethan / welche darauff mit so vielen hinwieder geantwortet / der gar eyfferigen zuvor bey Abschied zu Minden beliebter resolution, vnd ohn fest gefaster courage, der Teuffel sie holen solte / wo sie nit Hameln entsetzen / oder sterben wolten / Ist darauff von S. F. Gn. Herrn General I. Excell. Herr Feldmarschalln vnd andern hohen Officirern in geschwinder Eil vffn Abend die billich gute gegen Resolution genommen / Im fall der Feind stünde / wie wir vns dann nicht wol einbilden kondten / sondern gedachten / er etwa eine Finte machen / vnd durch die Berge oder sonsten allein Volck in die Stadt zu bringen / oder vns davon zu locken suchen würde / durch Hülffe Gottes (wie dann das Feldgeschrey dieser Orten war) Hilff Gott I. Kön. Maj. höchstmilden Gnaden Blut zu rächen / vñ den Feind zu schlagen / vnd ob wol Mangel der ammunition anfangs vnd fast allerhand perplexität machte / massen die Convoy, so dieses falls nach Hañover[29] in so geschwinder Eil nicht wieder zurück kommen köndte / seyn doch I. Exc. der Herr Feldmarschall hingeritten zuförderst einen Ort zum Combat an vnser seiten bequembt : wie er dann auch sehr favorabel vnd commodè gewesen / da vff der rechten die Berg / vnd vff der lincken seiten die Weser neben obgedachter Stadt Oldendorff zu vnserm Vortheil zu erwehlen / darauff I. F. Gn. der Herr General zu marchiren befohlen / welche die ganze Nacht bis morgẽs vmb 8. Vhren gewäret / vmb welche Zeit die Bataglie von hochged. I. Exc. wol formirt, vñ darauff die Schwedische Loßkündigung durch 2 Canonschüssen vff etliche deß Feindes / so fast wie wir hinten im Hügel hielten / hervorguckende Trouppen gethan worden / welche eben den Geruch deß guten noch vbrigen Pulvers nicht wol vertragen können / dardurch dann den vnserigen die grosse courage zu fechten confirmirt[30] vnd grösser worden / der Feind aber / welcher ihm dañ vffs Fußvolck meist verlassen / commandirte die Mußquetirer[31] durch hole Wege am Berg / da er die ganze force hin emplorirte[32] / wurdẽ aber von den vnserigen durch Herrn General Majeur Kachens gute conduicte[33] so begegnet / daß es Lust anzusehen / vnd war nicht anders / als wann es eitel Kugel geregnet. Wie nun solches etwa 3 Stund continuellement gewäret / ward die sehr ersprießliche resolution genomen / den Feind dero gestalt anzugreiffen / daß Ihre F. Gn. Herr General vnd Ihre Exc. Herr Feldmarschall / dabey dann auch Herr Gustavus Gustaff Sohn[34] sich resolut befunden / vff der einen seiten mit der Cavallerie selbsten / General Major Kache / Vßler[35] vnd Obr. Stalhanß[36] / Obr. Soppe[37] / Obr. Sack / Obr. Isaac / Axesyn[38] vnd Major[39] von den Schmalendern / also mit dē Kern der hiesigen Armee vff der andern / vnd Melander in der Mitte den Feind angrieffen / doch nicht ohn einer guten reserve / welches dann auch dero gestalt geschehen / daß nach langen Gegenminē der Feind in confusion, darauff in die Flucht gelegt worden / verlauffend die Stücke[40] / Artolerey / munition / Pagage[41] / vnd alles was er bey sich gehabt / bey etlichen hunderten fielen nieder / vnd baten Quartir[42] / welches die Finnen nicht wol verstehen kondten / doch von den Teutschen bißweilen solches erhielten / die vnserigen haben die noch vbrigen biß Rinteln[43] vnd Minden verfolget / so fern es denn voller Toden vber Todẽ liget. Ist also der Feind dieses Orts / sonderlich die Infanterey vff einmal ganz ruinirt vnd höchstgedacht I. K. M. Tod der gebür eben vff Leonis Papsts / ut fasti docent,[44] Tag / an den Pfaffenknechten gerechnet worden / dazu dann die vnserige zuförderst ihre devoir vnd eusserliche Bildniß / so ein jeglicher fast vff der brust tregt / auch sonderlich das lebendige obged. Gustaff Gustaff Sohn (welches præsenz dabey nit ein geringes genutzet) ermahnetē. Vom Feind ist Gen. Merode durchn Leib geschossen / seynd in der flucht für Bruckeburg[45] gewiß gestorben / so wol der Herr von Geldern selbst vnd Obr. Quad[46] [neben noch andern Gen. derẽ Namen noch nit kundig / Obr. Westerholtz[47] ist vffn Kopf vnd in die Axel geschossen / vnd neben Obr. Westphal[48] gefangen / wohin Bennighausen vnd der von Wartēberg hinkom̃en / weiß man noch nit / der Graff von Gronßfeld ist naher Minden gelauffen / dessen Hut vnd Degen I. F. Gn. dem H. General zuhanden kommen / wie auch obged. Herrn Gustaff Gustaff Son / einen von deß Merode Page,[49] so seiner sprachen wol kundig / neben einē stab etlicher Hunden vnd Französischen Büchern / der Cornet[50] vnd Fahnē[51] seyn vber die massen viel / mehr dann etliche 50. schon gelieffert / darzu 12. Metallene Stück. An vnser seiten sind / Gott lob / nicht vber 100. verletzt vnd geblieben / keine hohe Officirer / als Obr. Stalhanß / so mit einer Pistolen vber den Elbogen durch den lincken Arm / vnd Obr. Soppe / durch die rechte Lenden / beyderseits ohn Gefahr deß Lebens oder sonsten geschossen wordē / daneben auch der Obr. Ranzow[52] vnserer seiten gefehrlich blessiret. Es ist nicht zu schreiben / wie statliche beute[53] die vnserigen gemacht / also daß auch ein geringer schütze mit einer roten sambten Casache[54] wol verbremet / vnd mit Plusch gefüttert auffgezogen kömpt / vnd fast biß Rinteln / wie ich dann selbst mit gefolget / die wege voller Pagage / welches mich auch verhindert / so wol im mangel gelegener botschafft / daß ich solches gestern nicht alsobald avisirt. Ist dieses nur gleich mein Entwurff dieser grossen vnd herrlichen victori / heut oder morgen wird man mehr particularia vnd etlicher mehrer Namen der Toden haben / Das Combat wäret von 8. vhr morgens biß 4. deß Abends / ausser dem Verfolg / vnd war ein schön gewünschtes Wetter / welches vns sonsten bißhero nicht wol favorisiren wollen / Jetzo wird ein Trompeter[55] an den Obr. Leut.[56] Schelhamer[57] mit etlichen Weibern vom Feind / davon er / wz gestern vorgangen / erfahren mag / geschickt / vnd catechotische[58] Erklärung begehrt / meyne das Herz sitze schon niedriger / vnnd sey durch das Gedöhn der gestrigen Carthaunen[59] ganz gefallen“.[60]
Der Livländer Otto von Sack [Sock] [1589 Trikaten/Livland-16.11.1658 Stockholm] stand zuletzt als Obrist[1] in schwedischen Diensten.[2] 1633 sind in den schwedischen Listen 293 Kavalleristen unter seinem Befehl aufgeführt,[3] 4 Kompanien[4] nahmen unter ihm an der Schlacht bei Hessisch- Oldendorf[5] bzw. bzw. 240 Mann[6] an der Belagerung und Einnahme der noch von den Ligisten[7] gehaltenen Weserfestung Hameln[8] teil. In einer zeitgenössischen Flugschrift über die Schlacht bei Hessisch-Oldendorf (28.6./8.7.1633) heißt es „Aus einem andern Schreiben“: „Demnach S. Excell. der Herr Feldmarschalch[9] die Conjunction deß Graffen von Gronßfeld[10] mit Meroden[11] vnd Benninghausen[12] geschehen lassen müssen / hat er sich mit allen beyhabenden Trouppen / als den General Majeur[13] Kachen[14] vnnd Melander[15] wiederumb ins Läger den 29. dieses retirirt / die Reuter vnd Volck nahe bey Woll[16] campirt / vnd vberall gute ordre gestellet / damit nicht etwa ein Einfall geschehen / oder er an constanten vorgenommenen propos[17] in comportirung[18] der Stadt Hameln[19] verhindert werden möchte / Darauff seynd wie weiland 4 junge Grafen vnnd Herrn / als der von Gronßfeld / so commãdirt, Merode / Benninghausen / vnd der von Wertenberg[20] / der H. von Gleen[21] vñ andere von Minden[22] außgefolget / vnd den 27. dieses vffn Abend etwa vm die Glock 3. bey Schaumburg[23] zwischen Oldendorff vnd 2. Dörffern / als Tode[24] vnd Wolstorff[25] / etwa eine Meile[26] von vnserm Lager vor Hameln gesetzt / vnd 12000. Mann, 8000. zu Fuß vnd 4000. zu Pferde / effectivè (wie die vornehme Gefangene[27] fast alle aussagen / sollen da 14000. Mann complet gewesen seyn) starck in Batallie[28] gestellet / auch mit vier Canonschüssen den Belagerten die Loßkündigung gethan / welche darauff mit so vielen hinwieder geantwortet / der gar eyfferigen zuvor bey Abschied zu Minden beliebter resolution, vnd ohn fest gefaster courage, der Teuffel sie holen solte / wo sie nit Hameln entsetzen / oder sterben wolten / Ist darauff von S. F. Gn. Herrn General I. Excell. Herr Feldmarschalln vnd andern hohen Officirern in geschwinder Eil vffn Abend die billich gute gegen Resolution genommen / Im fall der Feind stünde / wie wir vns dann nicht wol einbilden kondten / sondern gedachten / er etwa eine Finte machen / vnd durch die Berge oder sonsten allein Volck in die Stadt zu bringen / oder vns davon zu locken suchen würde / durch Hülffe Gottes (wie dann das Feldgeschrey dieser Orten war) Hilff Gott I. Kön. Maj. höchstmilden Gnaden Blut zu rächen / vñ den Feind zu schlagen / vnd ob wol Mangel der ammunition anfangs vnd fast allerhand perplexität machte / massen die Convoy, so dieses falls nach Hañover[29] in so geschwinder Eil nicht wieder zurück kommen köndte / seyn doch I. Exc. der Herr Feldmarschall hingeritten zuförderst einen Ort zum Combat an vnser seiten bequembt : wie er dann auch sehr favorabel vnd commodè gewesen / da vff der rechten die Berg / vnd vff der lincken seiten die Weser neben obgedachter Stadt Oldendorff zu vnserm Vortheil zu erwehlen / darauff I. F. Gn. der Herr General zu marchiren befohlen / welche die ganze Nacht bis morgẽs vmb 8. Vhren gewäret / vmb welche Zeit die Bataglie von hochged. I. Exc. wol formirt, vñ darauff die Schwedische Loßkündigung durch 2 Canonschüssen vff etliche deß Feindes / so fast wie wir hinten im Hügel hielten / hervorguckende Trouppen gethan worden / welche eben den Geruch deß guten noch vbrigen Pulvers nicht wol vertragen können / dardurch dann den vnserigen die grosse courage zu fechten confirmirt[30] vnd grösser worden / der Feind aber / welcher ihm dañ vffs Fußvolck meist verlassen / commandirte die Mußquetirer[31] durch hole Wege am Berg / da er die ganze force hin emplorirte[32] / wurdẽ aber von den vnserigen durch Herrn General Majeur Kachens gute conduicte[33] so begegnet / daß es Lust anzusehen / vnd war nicht anders / als wann es eitel Kugel geregnet. Wie nun solches etwa 3 Stund continuellement gewäret / ward die sehr ersprießliche resolution genomen / den Feind dero gestalt anzugreiffen / daß Ihre F. Gn. Herr General vnd Ihre Exc. Herr Feldmarschall / dabey dann auch Herr Gustavus Gustaff Sohn[34] sich resolut befunden / vff der einen seiten mit der Cavallerie selbsten / General Major Kache / Vßler[35] vnd Obr. Stalhanß[36] / Obr. Soppe[37] / Obr. Sack / Obr. Isaac / Axesyn[38] vnd Major[39] von den Schmalendern / also mit dē Kern der hiesigen Armee vff der andern / vnd Melander in der Mitte den Feind angrieffen / doch nicht ohn einer guten reserve / welches dann auch dero gestalt geschehen / daß nach langen Gegenminē der Feind in confusion, darauff in die Flucht gelegt worden / verlauffend die Stücke[40] / Artolerey / munition / Pagage[41] / vnd alles was er bey sich gehabt / bey etlichen hunderten fielen nieder / vnd baten Quartir[42] / welches die Finnen nicht wol verstehen kondten / doch von den Teutschen bißweilen solches erhielten / die vnserigen haben die noch vbrigen biß Rinteln[43] vnd Minden verfolget / so fern es denn voller Toden vber Todẽ liget. Ist also der Feind dieses Orts / sonderlich die Infanterey vff einmal ganz ruinirt vnd höchstgedacht I. K. M. Tod der gebür eben vff Leonis Papsts / ut fasti docent,[44] Tag / an den Pfaffenknechten gerechnet worden / dazu dann die vnserige zuförderst ihre devoir vnd eusserliche Bildniß / so ein jeglicher fast vff der brust tregt / auch sonderlich das lebendige obged. Gustaff Gustaff Sohn (welches præsenz dabey nit ein geringes genutzet) ermahnetē. Vom Feind ist Gen. Merode durchn Leib geschossen / seynd in der flucht für Bruckeburg[45] gewiß gestorben / so wol der Herr von Geldern selbst vnd Obr. Quad[46] [neben noch andern Gen. derẽ Namen noch nit kundig / Obr. Westerholtz[47] ist vffn Kopf vnd in die Axel geschossen / vnd neben Obr. Westphal[48] gefangen / wohin Bennighausen vnd der von Wartēberg hinkom̃en / weiß man noch nit / der Graff von Gronßfeld ist naher Minden gelauffen / dessen Hut vnd Degen I. F. Gn. dem H. General zuhanden kommen / wie auch obged. Herrn Gustaff Gustaff Son / einen von deß Merode Page,[49] so seiner sprachen wol kundig / neben einē stab etlicher Hunden vnd Französischen Büchern / der Cornet[50] vnd Fahnē[51] seyn vber die massen viel / mehr dann etliche 50. schon gelieffert / darzu 12. Metallene Stück. An vnser seiten sind / Gott lob / nicht vber 100. verletzt vnd geblieben / keine hohe Officirer / als Obr. Stalhanß / so mit einer Pistolen vber den Elbogen durch den lincken Arm / vnd Obr. Soppe / durch die rechte Lenden / beyderseits ohn Gefahr deß Lebens oder sonsten geschossen wordē / daneben auch der Obr. Ranzow[52] vnserer seiten gefehrlich blessiret. Es ist nicht zu schreiben / wie statliche beute[53] die vnserigen gemacht / also daß auch ein geringer schütze mit einer roten sambten Casache[54] wol verbremet / vnd mit Plusch gefüttert auffgezogen kömpt / vnd fast biß Rinteln / wie ich dann selbst mit gefolget / die wege voller Pagage / welches mich auch verhindert / so wol im mangel gelegener botschafft / daß ich solches gestern nicht alsobald avisirt. Ist dieses nur gleich mein Entwurff dieser grossen vnd herrlichen victori / heut oder morgen wird man mehr particularia vnd etlicher mehrer Namen der Toden haben / Das Combat wäret von 8. vhr morgens biß 4. deß Abends / ausser dem Verfolg / vnd war ein schön gewünschtes Wetter / welches vns sonsten bißhero nicht wol favorisiren wollen / Jetzo wird ein Trompeter[55] an den Obr. Leut.[56] Schelhamer[57] mit etlichen Weibern vom Feind / davon er / wz gestern vorgangen / erfahren mag / geschickt / vnd catechotische[58] Erklärung begehrt / meyne das Herz sitze schon niedriger / vnnd sey durch das Gedöhn der gestrigen Carthaunen[59] ganz gefallen“.[60]
Am 8./18.5.1634 wird Sack unter Banérs[61] Befehl mit einem Regiment[62] Kavallerie bei Müncheberg[63] aufgeführt.[64]
Im April 1640 soll Sack zusammen mit den Obristen Creutz,[65] Brunnecker[66] u. a. sowie mit Heinrich von Dönhof[67] und Ludwig von Weiher,[68] im folgenden Bericht als „gute Kavaliere“ bezeichnet, seine Bereitschaft erklärt haben, unter Baudissins[69] Führung in schwedische Dienste zu treten. Im Juni 1636 war Baudissin bei der Belagerung Magdeburgs[70] schwer verwundet worden und musste gezwungenermaßen den Kriegsdienst quittieren. Der Hildesheimer Chronist Dr. Jordan[71] hält dazu unter dem 9./19.6.1636 fest: „General-Liutnand Baudiß wird für Magdeburg durch beede Lenden geschoßen und der Obr. Vitzthumb[72] durch die Schultern im Laufgraben“.[73] „Währenddessen hatte der Kurfürst von Sachsen[74] aus seinem bei Egeln[75] errichteten Hauptquartier die Belagerung von Magdeburg vorbereitet. In Wittenberg[76] wurde eine Schiffsbrücke errichtet, deren Befestigung bei Schönebeck[77] Oberst Adam von Pfuel[78] auch durch einen Beschuss nicht verhindern konnte. Wolfersdorf[79] marschierte am 11. Juni 1636 über die Schiffsbrücke nach Magdeburg und begann, die dortige Neustadt zu belagern. Die Verteidiger wehrten sich erbittert. Ihre verbissenen, mit kurzen Gewehren,[80] Morgensternen,[81] Schlachtschwertern[82] und Handgranaten[83] geführten Ausfälle fügten der Reichsarmee immer wieder große Verluste zu. Besonders schwere Verletzungen verursachten die Böhmischen Ohrlöffel[84] mit ihren runden Kugeln und langen eisernen Zacken. Baudissin wurde durch den Oberschenkeldurchschuss schwer verletzt und nach Aken[85] zur Behandlung gebracht. Da er sich kaum noch am Stock fortbewegen konnte, entließ ihn Johann Georg I. auf dessen Wunsch. Im Nachhinein beklagte Baudissin sich allerdings immer wieder, weder eine Belohnung noch seine ausstehende Besoldung erhalten zu haben“.[86]
In dem bereits erwähnten Bericht des schwedischen Kapitänleutnants[87] Johann Walter[88] an den schwedischen Referendar Simon Mathaei[89] vom 13.4.1640 aus Stralsund[90] heißt es unter Berufung auf einen Vertrauten Baudissins: „Derselbe habe ihm offenherzig zu vestehen gegeben, daß er aus Affection gegen Schweden dem Feldmarschall[91] seine Dienste und die Lieferung von zehn und mehr tausend Mann angeboten, bisher aber keine Antwort erhalten hätte und nicht wüßte, ob man seine Dienste nicht achtete, oder ihn vielleicht wegen letztmals beigefallenen sächsischen Faction,[92] dazu er durch disgoustement[93] genötigt worden, nicht traute. Er meinte es redlich und wäre nicht etwa durch Unvermögen zu dem Anerbieten veranlaßt worden, da er zu leben hätte. Er könnte aber nicht stille sitzen, gute Kavalliere[94] hätten sich verpflichtet, ihm zu folgen und gute deutsche Mannschaft[95] zuzuführen. Die polnischen Consilia stünden ihm dabei nicht im Wege, weil rex Poloniae[96] der östreichisch-spanischen Faction abgeneigt wäre. Die Königin[97] hätte ihn, Baudissin, gebeten, den Kaiserlichen 10000 Mann zuzuführen. Er hätte sich mit seinem Alter entschuldigt. Der König aber hätte ihm geradezu abgerathen und gerathen, sich lieber der schwedischen Partei zu bedienen. Der König wäre der reformirt-kalvinistischen Religion zugethan, dürfte es sich aber wegen der Jesuiten[98] nicht merken lassen.
Der König hätte das Werk wegen der dänischen Schiffe vor dem Danziger Hafen auch sehr übel vermerkt und wäre Willens gewesen, ihn, Baudissin, deshalb mit Beschwerde an die Krone Schweden und zur Abschließung eines ewigen Bündnisses zu senden. Es hätte aber der Graf Dönhof erinnert, daß die dänische Belegung des Danziger Hafens mit schwedischer Bewilligung geschehen wäre, weshalb des König von Polen mit der Nachsuchung schwedischer Hülfe leeres Stroh dreschen würde. Der König hätte ihn dann ermahnt, mit 12000 Mann einen Einfall in Holstein und Jütland zu machen, was er aber abgelehnt. Auch den Herzog von Holstein hätte der König wider Dänemark aufzuwiegeln versucht.
Der König von Polen würde gewillt sein, sich mit Schweden in ein engeres Bündniß einzulassen, nachdem verlautet, daß Spanien, England und Dänemark eine Allianz getroffen. Wenn Schweden dazu geneigt wäre und man Baudissin ein geringes Beglaubigungsschreiben für diesen Zweck ausstellen würde, so würden von plnischer Seite deswegen Verordnungen ergehen. Er, Baudissin, kenne des Polenkönigs Gesinnung sehr genau. Derselbe ertrüge es ungern, daß ihm von den Reichssenatoren die Hände gebunden und die Krone auf Wahl stünde und nicht erblich wäre. Und selbst wenn auf dem künftigen Reichstage, auf welchem der Kaiser durch seinen Gesandten Greifenklau[99] um Überlassung einiger tausend Mann ansuchen und dagegen eventuell Türkenhilfe versprechen würde, der König etwas bewilligen sollte, so würde ihm solches von den spaniolosirten Räthen über dem Kopf genommen werden. Dem könnte zuvorgekommen werden: würde Baudissin vor Endigung des Reichstages von Schweden Antwort und Annahme seines Vorschlags erhalten, so könnte er alle jene Kavaliere auf die schwedische Seite ziehen, während dieselben sonst auf die kaiserliche Seite treten. Baudissin habe darauf ihn, Walter gebeten, dem schwedischen Feldmarschall unter Überreichung eines Kreditifs[100] Baudissins Gemüthsmeinung nochmals zu entdecken und um Bescheid zu bitten“.[101]
Otto von Sack verstarb 1641.
1645 erscheinen in den Listen noch 8 Kompanien Reiter des „seligen“ Obristen Sack unter Helmut Wrangels[102] Befehl.[103]
Nach anderen Angaben verstarb er erst 1658.[104]
Um weitere Hinweise unter Bernd.Warlich@gmx.de wird gebeten !
[1] Obrist [schwed. Överste]: I. Regimentskommandeur oder Regimentschef mit legislativer und exekutiver Gewalt, „Bandenführer unter besonderem Rechtstitel“ (ROECK, Als wollt die Welt, S. 265), der für Bewaffnung und Bezahlung seiner Soldaten und deren Disziplin sorgte, mit oberster Rechtsprechung und Befehlsgewalt über Leben und Tod. Dieses Vertragsverhältnis mit dem obersten Kriegsherrn wurde nach dem Krieg durch die Verstaatlichung der Armee in ein Dienstverhältnis umgewandelt. Voraussetzungen für die Beförderung waren (zumindest in der kurbayerischen Armee) richtige Religionszugehörigkeit (oder die Konversion), Kompetenz (Anciennität und Leistung), finanzielle Mittel (die Aufstellung eines Fußregiments verschlang 1631 in der Anlaufphase ca. 135.000 fl.) und Herkunft bzw. verwandtschaftliche Beziehungen (Protektion). Zum Teil wurden Kriegskommissare wie Johann Christoph Freiherr v. Ruepp zu Bachhausen zu Obristen befördert, ohne vorher im Heer gedient zu haben; Bayerisches Hauptstaatsarchiv München Kurbayern Äußeres Archiv 2398, fol. 577 (Ausfertigung): Ruepp an Maximilian I., Gunzenhausen, 1631 XI 25. Der Obrist ernannte die Offiziere. Als Chef eines Regiments übte er nicht nur das Straf- und Begnadigungsrecht über seine Regimentsangehörigen aus, sondern er war auch Inhaber einer besonderen Leibkompanie, die ein Kapitänleutnant als sein Stellvertreter führte. Ein Obrist erhielt in der Regel einen Monatssold von 500-800 fl. je nach Truppengattung, 500 fl. zu Fuß, 600 fl. zu Roß [nach der „Ordnung Wie es mit der verpflegung der Soldaten“ (1630)] in der kurbrandenburgischen Armee 1.000 fl. „Leibesbesoldung“ nebst 400 fl. Tafelgeld und 400 fl. für Aufwärter. Daneben bezog er Einkünfte aus der Vergabe von Offiziersstellen. Weitere Einnahmen kamen aus der Ausstellung von Heiratsbewilligungen, aus Ranzionsgeldern – 1/10 davon dürfte er als Kommandeur erhalten haben – , Verpflegungsgeldern, Kontributionen, Ausstellung von Salvagardia-Briefen – die er auch in gedruckter Form gegen entsprechende Gebühr ausstellen ließ – und auch aus den Summen, die dem jeweiligen Regiment für Instandhaltung und Beschaffung von Waffen, Bekleidung und Werbegeldern ausgezahlt wurden. Da der Sold teilweise über die Kommandeure ausbezahlt werden sollten, behielten diese einen Teil für sich selbst oder führten „Blinde“ oder Stellen auf, die aber nicht besetzt waren. Auch ersetzten sie zum Teil den gelieferten Sold durch eine schlechtere Münze. Zudem wurde der Sold unter dem Vorwand, Ausrüstung beschaffen zu müssen, gekürzt oder die Kontribution unterschlagen. Vgl. BELLINCKHAUSEN; TEGEDER; KREIENBRINK, der osnabrugischen handlung, S. 277: „Wir burger mußen alle wochen unse contribution zahlen, die obristen nehmmens geldt zu sich, und die gemeinen soldaten mußen hunger leyden“. Der Austausch altgedienter Soldaten durch neugeworbene diente dazu, ausstehende Soldansprüche in die eigene Tasche zu stecken. Zu diesen „Einkünften“ kamen noch die üblichen „Verehrungen“, die mit dem Rang stiegen und nicht anderes als eine Form von Erpressung darstellten, und die Zuwendungen für abgeführte oder nicht eingelegte Regimenter („Handsalben“) und nicht in Anspruch genommene Musterplätze; abzüglich allerdings der monatlichen „schwarzen“ Abgabe, die jeder Regimentskommandeur unter der Hand an den Generalleutnant oder Feldmarschall abzuführen hatte; Praktiken, die die obersten Kriegsherrn durchschauten. Zudem erbte er den Nachlass eines ohne Erben und Testament verstorbenen Offiziers. Häufig stellte der Obrist das Regiment in Klientelbeziehung zu seinem Oberkommandierenden auf, der seinerseits für diese Aufstellung vom Kriegsherrn das Patent erhalten hatte. Der Obrist war der militärische ‚Unternehmer‘, die eigentlich militärischen Dienste wurden vom Major geführt. Das einträgliche Amt – auch wenn er manchmal „Gläubiger“-Obrist seines Kriegsherrn wurde – führte dazu, dass begüterte Obristen mehrere Regimenter zu errichten versuchten (so verfügte Werth zeitweise sogar über 3 Regimenter), was Maximilian I. von Bayern nur selten zuließ oder die Investition eigener Geldmittel von seiner Genehmigung abhängig machte. Im April 1634 erging die kaiserliche Verfügung, dass kein Obrist mehr als ein Regiment innehaben dürfe; ALLMAYER-BECK; LESSING, Kaiserliche Kriegsvölker, S. 72. Die Möglichkeiten des Obristenamts führten des Öfteren zu Misshelligkeiten und offenkundigen Spannungen zwischen den Obristen, ihren karrierewilligen Obristleutnanten (die z. T. für minderjährige Regimentsinhaber das Kommando führten; KELLER, Drangsale, S. 388) und den intertenierten Obristen, die auf Zeit in Wartegeld gehalten wurden und auf ein neues Kommando warteten. Zumindest im schwedischen Armeekorps war die Nobilitierung mit dem Aufstieg zum Obristen sicher. Zur finanziell bedrängten Situation mancher Obristen vgl. dagegen OMPTEDA, Die von Kronberg, S. 555. Da der Obrist auch militärischer Unternehmer war, war ein Wechsel in die besser bezahlten Dienste des Kaisers oder des Gegners relativ häufig. Der Regimentsinhaber besaß meist noch eine eigene Kompanie, so dass er Obrist und Hauptmann war. Auf der Hauptmannsstelle ließ er sich durch einen anderen Offizier vertreten. Ein Teil des Hauptmannssoldes floss in seine eigenen Taschen. Dazu beanspruchte er auch die Verpflegung. Ertragreich waren auch Spekulationen mit Grundbesitz oder der Handel mit (gestohlenem) Wein (vgl. BENTELE, Protokolle, S. 195), Holz, Fleisch oder Getreide. Zum Teil führte er auch seine Familie mit sich, so dass bei Einquartierungen wie etwa in Schweinfurt schon einmal drei Häuser „durch- und zusammen gebrochen“ wurden, um Raum zu schaffen; MÜHLICH; HAHN, Chronik 3. Bd., S. 504. II. Manchmal meint die Bezeichnung „Obrist“ in den Zeugnissen nicht den faktischen militärischen Rang, sondern wird als Synonym für „Befehlshaber“ verwandt. Vgl. KAPSER, Heeresorganisation, S. 101ff.; REDLICH, German military enterpriser; DAMBOER, Krise; WINKELBAUER, Österreichische Geschichte Bd. 1, S. 413ff.
[2] schwedische Armee: Trotz des Anteils an ausländischen Söldnern (ca. 85 %; nach GEYSO, Beiträge II, S. 150, Anm., soll Banérs Armee 1625 bereits aus über 90 % Nichtschweden bestanden haben) als „schwedisch-finnische Armee“ bezeichnet. Die Unterscheidung zwischen der „Royal-Armee“, die v. Gustav II. Adolf selbst geführt wurde, u. den v. den Feldmarschällen seiner Konföderierten geführten „bastanten“ Armeen erscheint angesichts der Operationen der letzteren überflüssig. Nach LUNDKVIST, Kriegsfinanzierung, S. 384, betrug der Mannschaftsbestand (nach altem Stil) im Juni 1630 38.100, Sept. 1631 22.900, Dez. 1631 83.200, Febr./März 1632 108.500, Nov. 1632 149.200 Mann; das war die größte paneuropäische Armee vor Napoleon. Schwedischstämmige stellten in dieser Armee einen nur geringen Anteil der Obristen. So waren z. B. unter den 67 Generälen und Obristen der im Juni 1637 bei Torgau liegenden Regimenter nur 12 Schweden; die anderen waren Deutsche, Finnen, Livländern, Böhmen, Schotten, Iren, Niederländern und Wallonen; GENTZSCH, Der Dreißigjährige Krieg, S. 208. Vgl. die Unterredung eines Pastors mit einem einquartierten „schwedischen“ Kapitän, Mügeln (1642); FIEDLER, Müglische Ehren- und Gedachtnis-Seule, S. 208f.: „In dem nun bald dieses bald jenes geredet wird / spricht der Capitain zu mir: Herr Pastor, wie gefället euch der Schwedische Krieg ? Ich antwortet: Der Krieg möge Schwedisch / Türkisch oder Tartarisch seyn / so köndte er mir nicht sonderlich gefallen / ich für meine Person betete und hette zu beten / Gott gieb Fried in deinem Lande. Sind aber die Schweden nicht rechte Soldaten / sagte der Capitain / treten sie den Keyser und das ganze Römische Reich nicht recht auff die Füsse ? Habt ihr sie nicht anietzo im Lande ? Für Leipzig liegen sie / das werden sie bald einbekommen / wer wird hernach Herr im Lande seyn als die Schweden ? Ich fragte darauff den Capitain / ob er ein Schwede / oder aus welchem Lande er were ? Ich bin ein Märcker / sagte der Capitain. Ich fragte den andern Reuter / der war bey Dreßden her / der dritte bey Erffurt zu Hause / etc. und war keiner unter ihnen / der Schweden die Zeit ihres Lebens mit einem Auge gesehen hette. So haben die Schweden gut kriegen / sagte ich / wenn ihr Deutschen hierzu die Köpffe und die Fäuste her leihet / und lasset sie den Namen und die Herrschafft haben. Sie sahen einander an und schwiegen stille“.
Zur Fehleinschätzung der schwedischen Armee (1642): FEIL, Die Schweden in Oesterreich, S. 355, zitiert [siehe VD17 12:191579K] den Jesuiten Anton Zeiler (1642): „Copey Antwort-Schreibens / So von Herrn Pater Antoni Zeylern Jesuiten zur Newstadt in under Oesterreich / an einen Land-Herrn auß Mähren / welcher deß Schwedischen Einfalls wegen / nach Wien entwichen / den 28 Junii An. 1642. ergangen : Darauß zu sehen: I. Wessen man sich bey diesem harten und langwürigen Krieg in Teutschland / vornemlich zutrösten habe / Insonderheit aber / und für das II. Was die rechte und gründliche Ursach seye / warumb man bißher zu keinem Frieden mehr gelangen können“. a. a. O.: „Es heisst: die Schweden bestünden bloss aus 5 bis 6000 zerrissenen Bettelbuben; denen sich 12 bis 15000 deutsche Rebellen beigesellt. Da sie aus Schweden selbst jährlich höchstens 2 bis 3000 Mann ‚mit Marter und Zwang’ erhalten, so gleiche diese Hilfe einem geharnischten Manne, der auf einem Krebs reitet. Im Ganzen sei es ein zusammengerafftes, loses Gesindel, ein ‚disreputirliches kahles Volk’, welches bei gutem Erfolge Gott lobe, beim schlimmen aber um sein Erbarmen flehe“. Im Mai 1645 beklagte Torstensson, dass er kaum noch 500 eigentliche Schweden bei sich habe, die er trotz Aufforderung nicht zurückschicken könne; DUDÍK, Schweden in Böhmen und Mähren, S. 160.
[3] MANKELL, Uppgifter, S. 186.
[4] MANKELL, Uppgifter, S. 186. – Kompanie [schwed. Kompani]: Eine Kompanie zu Fuß (kaiserlich, bayerisch und schwedisch) umfasste von der Soll-Stärke her 100 Mann, ihre Ist-Stärke lag jedoch bei etwa 70 Mann, eine Kompanie zu Pferd bei den Bayerischen 200, den Kaiserlichen 60, den Schwedischen 80, manchmal bei 100-150, zum Teil allerdings auch nur ca. 30. Geführt wurde die Fußkompanie von einem Hauptmann, die berittene Kompanie von einem Rittmeister. Vgl. TROUPITZ, Kriegs-Kunst. Vgl. auch „Kornett“, „Fähnlein“, „Leibkompanie“.
[5] Schlacht bei Hessisch-Oldendorf am 28.6./8.7.1633: Schwedisch-hessische Truppen unter Dodo von Knyhausen, hessische unter Melander (Holzappel) und Georg von Braunschweig-Lüneburg schlagen die kaiserlich-ligistische Armee unter Gronsfeld, Mérode-Waroux und Bönninghausen, die an die 4000 Tote Verlust haben. In einer zeitgenössischen Flugschrift war auf die ungewöhnlich hohen Verluste in dieser Schlacht verwiesen worden; COPIA KÖNIGL. MAY. IN DENNEMARCK / ERGANGENES SCHREIBEN: „Vnnd ist der eigentliche Bericht von den Gräfflichen Schaumbergischen Dienern einbracht / daß derselben auffs höchste etwa in die vierhundert Mann / die man alle hätte zählen können / in Münden [Minden; BW] ankommen wehren / vnnd ist eine solche Schlacht geschehen / daß weder in der Leipzischen Anno 1631. noch Lützischen Schlacht / Anno 1632. so viel Todten auf der Wahlstatt gefunden vnnd gesehen worden / wie jetzo“. Abgesehen von der reichen Beute hatte der Sieg bei Hessisch-Oldendorf jedoch eine nicht zu unterschätzende Wirkung im protestantischen Lager, glaubte man doch, dass „deß feindes force vollents gebrochen sein solle“; Staatsarchiv Bamberg C 48/195-196, fol. 112 (Ausfertigung): Johann Casimir von Sachsen-Coburg an Markgraf Christian von Brandenburg-Kulmbach, Coburg, 1633 VII 04 (a. St.). In der COPIA KÖNIGL. MAY. IN DENNEMARCK / ERGANGENES SCHREIBEN hieß es: „Bei den Konföderierten sind fast alle Reuter Reich worden / vnnd ist Silber Geld vnnd Pferde gnug zur Beute gemacht worden / denn der Feind allen seinen Trost bey sich gehabt: Deßwegen vnsere Hohe- vnnd Nieder Officirer vnnd alles Volck dermassen Resolut zum fechten gewesen / daß nit zu glauben / noch gnugsam außzusprechen / vnd ist abermahls der Papisten Ruhm / in der Compositione pacis prächtig angeführt: Daß die Evangelische keine offene FeldSlacht wider die Papisten niemals erhalten / durch Gottes Krafft zu nicht vnd zur offnen Weltkündigen Lügen geworden“. Nach einer Nachricht in den Akten des Staatsarchivs Bückeburg aus dem Jahr 1633 betrug nach der Schlacht bei Hessisch-Oldendorf (1633) die Zahl der Gefallenen 6.534, die der Gefangenen zwischen 1.700 und 1.800 Mann; ZARETZKY, Flugschrift, S. 7, 3; darunter waren allein 1.000 Weiber; RIEZLER, Baiern Bd. 4, S. 170. Das Flugblatt „HAMMLLISCHE SCHLACHT“ [VD17 1:092231H] geht von 2.000 Gefangenen aus. In einem Bericht aus Bericht aus Osterode, 1633 VII 01 (a. St., Kopie); Postskriptum, heißt es sogar: „Ferner kompt bericht, daß in etlichen unseren kirchen und schulen der herrlichen vittory halber welche höher als die iüngste vor Lützen erhaltene schlacht zu æstimiren, gebetet und gesungen“ [worden]. Staatsarchiv Bamberg C 48/195-196, fol. 146 v.
[6] MANKELL, Uppgifter, S. 187.
[7] Liga: Die Liga war das Bündnis katholischer Reichsstände vom 10.7.1609 zur Verteidigung des Landfriedens und der katholischen Religion, 1619 neu formiert, maßgeblich unter Führung Maximilians I. von Bayern zusammen mit spanischen und österreichischen Habsburgern an der Phase des Dreißigjährigen Krieges bis zum Prager Frieden (1635) beteiligt, danach erfolgte formell die Auflösung. Das bayerische Heer wurde Teil der Reichsarmada. Zur Liga-Politik vgl. KAISER, Politik, S. 152ff.
[8] Hameln [LK Hameln-Pyrmont]; HHSD II, S. 192ff.
[9] Dodo I. Freiherr v. Knyphausen u. Innhausen [2.7.1583 Lütetsburg (Ostfriesland)-11.1.1636 bei Haselünne], braunschweigischer Obrist, Feldmarschall. Vgl. SATTLER, Reichsfreiherr Dodo zu Innhausen und Knyphausen.
[10] Jost Maximilian Graf v. Gronsfeld [6.11.1596 Rimburg-24.9.1662 Gronsveld], ligistisch-bayerischer Obrist, kurbayerischer Feldmarschall. Vgl. WARLICH, Für Bayern, Habsburg und Reich [Typoskript].
[11] Johann II. Graf v. Mérode-Waroux [Meroda, Merodi] [1584 oder um 1589-10.7.1633 Nienburg], kaiserlicher Generalfeldzeugmeister. Vgl. HALLWICH, Merode.
[12] Lothar Dietrich Freiherr v. Bönninghausen [ca. 1598 Apricke-13.12.1657 Schnellenberg], in ligistischen, kaiserlichen, spanischen u. französischen Diensten, zuletzt Feldmarschallleutnant. Vgl. LAHRKAMP, Bönninghausen.
[13] Generalmajor (schwed. Generalmajor): Der Generalmajor nahm die Aufgaben eines Generalwachtmeisters in der kaiserlichen oder bayerischen Armee war. Er stand rangmäßig bei den Schweden zwischen dem Obristen und dem General der Kavallerie, bei den Kaiserlichen zwischen dem Obristen und dem Feldmarschallleutnant.
[14] Lars [Laes] Graf Kagg [Kagge, Kache, Kaggin, Kaggi, Kago, Kalle, Kaach, Gaugk, Kiege] [1.5.1595 Källstorp-19./29.11.1661 Stockholm], schwedischer Reichsmarschall. Vgl. http://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=12302.
[15] Peter Melander Graf v. Holzappel [8.2.1589 Niederhadamar-17.5.1648 Augsburg], hessen-kasselischer, kaiserlicher Feldmarschall. Vgl. HÖFER, Peter Graf Holzappel; GEISTHARDT. Peter Melander; LEINS, Soziale und räumliche Mobilität; LEINS, Peter Melander von Holzappel. Militärwirtschaft, Bündnisdiplomatie und Miniaturherrschaft im späten Dreißigjährigen Krieg. Phil. Diss [in Arbeit].
[16] Wüllen (LK Ahaus]; HHSD III, S. 800. ?
[17] propos: Vorhaben.
[18] Unterstützung; vgl. auch JONES, A Lexicon, S. 223.
[19] Hameln; HHSD II, S. 192ff.
[20] Ferdinand Lorenz Graf v. Wartenberg [9.8.1606-18.3.1666], bayerisch-ligistischer Obrist.
[21] Gottfried Huyn van Geleen, Freiherr u. Graf v. Amstenrade u. Geleen [um 1598-27.8.1657 Alden Biesen],bayerischer u. kaiserlicher Feldmarschall. Vgl. SCHRIJNEMAKERS; CORSTJENS, Graaf Godfried Huyn van Geleen (in der deutschen Fachliteratur kaum beachtete Biographie).
[22] Minden [LK Minden]; HHSD III, S. 517ff.
[23] Schaumburg [Kr. Grafschaft Schaumburg]; HHSD II, S. 413.
[24] Tode: nicht identifiziert.
[25] Wüllen (LK Ahaus]; HHSD III, S. 800.
[26] Meile: 1 Meile = ca. 7,420 km, eine schwedische (auch große) wie auch westfälische große Meile wurde mit 10 km bzw. 10, 044 km gerechnet. In der Regel kein bestimmtes Maß, sondern eine Strecke, „die ein Fußgänger ohne Anstrengung in zwei Stunden zurücklegen“ konnte. HIRSCHFELDER, Herrschaftsordnung, S. 192.
[27] Kriegsgefangene: Zur Gefangennahme vgl. die Reflexionen bei MAHR, Monro, S. 46: „Es ist für einen Mann besser, tüchtig zu kämpfen und sich rechtzeitig zurückzuziehen, als sich gefangennehmen zu lassen, wie es am Morgen nach unserem Rückzug vielen geschah. Und im Kampf möchte ich lieber ehrenvoll sterben als leben und Gefangener eines hartherzigen Burschen sein, der mich vielleicht in dauernder Haft hält, so wie viele tapfere Männer gehalten werden. Noch viel schlimmer ist es, bei Gefangennahme, wie es in gemeiner Weise immer wieder geübt wird, von einem Schurken nackt ausgezogen zu werden, um dann, wenn ich kein Geld bei mir habe, niedergeschlagen und zerhauen, ja am Ende jämmerlich getötet zu werden: und dann bin ich nackt und ohne Waffen und kann mich nicht verteidigen. Mein Rat für den, der sich nicht entschließen kann, gut zu kämpfen, geht dahin, daß er sich dann wenigstens je nach seinem Rang gut mit Geld versehen soll, nicht nur um stets selbst etwas bei sich zu haben, sondern um es an einem sicheren Ort in sicheren Händen zu hinterlegen, damit man ihm, wenn er gefangen ist, beistehen und sein Lösegeld zahlen kann. Sonst bleibt ihm nichts anderes übrig, als sich zu entschließen, in dauernder Gefangenschaft zu bleiben, es sei denn, einige edle Freunde oder andere haben mit ihm Mitleid“. Nach Lavater, Kriegs-Büchlein, S. 65, hatten folgende Soldaten bei Gefangennahme keinerlei Anspruch auf Quartier (Pardon): „wann ein Soldat ein eysen, zinne, in speck gegossen, gekäuete, gehauene oder gevierte Kugel schiesset, alle die gezogene Rohr und französische Füse [Steinschloßflinten] führen, haben das Quartier verwirkt. Item alle die jenigen, die von eysen geschrotete, viereckige und andere Geschröt vnd Stahel schiessen, oder geflammte Dägen, sollt du todt schlagen“. Leider reduziert die Forschung die Problematik der de facto rechtlosen Kriegsgefangenen noch immer zu einseitig auf die Alternative „unterstecken“ oder „ranzionieren“. Der Ratsherr Dr. Plummern berichtet (1633); SEMLER, Tagebücher, S. 65: „Eodem alß die von Pfullendorff avisirt, daß ein schwedischer reütter bei ihnen sich befinnde, hatt vnser rittmaister Gintfeld fünf seiner reütter dahin geschickht sollen reütter abzuholen, welliche ihne biß nach Menßlißhausen gebracht, allda in dem wald spolirt vnd hernach zu todt geschoßen, auch den bauren daselbst befohlen in den wald zu vergraben, wie beschehen. Zu gleicher zeit haben ettlich andere gintfeldische reütter zu Langen-Enßlingen zwo schwedische salvaguardien aufgehebt vnd naher Veberlingen gebracht, deren einer auß Pommern gebürtig vnd adenlichen geschlächts sein sollen, dahero weiln rittmaister Gintfeld ein gůtte ranzion zu erheben verhofft, er bei leben gelassen wird“. Der Benediktiner-Abt Gaisser berichtet zu 1633; STEMMLER, Tagebuch Bd. 1, S. 415: „Der Bürger August Diem sei sein Mitgefangener gewesen, für den er, falls er nicht auch in dieser Nacht entkommen sei, fürchte, daß er heute durch Aufhängen umkomme. Dieser sei, schon vorher verwundet, von den Franzosen an den Füßen in einem Kamin aufgehängt und so lange durch Hängen und Rauch gequält worden, bis das Seil wieder abgeschnitten worden sei und er gerade auf den Kopf habe herabfallen dürfen“. Soldaten mussten sich mit einem Monatssold freikaufen, für Offiziere gab es je nach Rang besondere Vereinbarungen zwischen den Kriegsparteien. Das Einsperren in besondere Käfige, die Massenhinrichtungen, das Vorantreiben als Kugelfang in der ersten Schlachtreihe, die Folterungen, um Auskünfte über Stärke und Bewegung des Gegners zu erfahren, die Hungerkuren, um die „Untersteckung“ zu erzwingen etc., werden nicht berücksichtigt. Frauen, deren Männer in Gefangenschaft gerieten, erhielten, wenn sie Glück hatten, einen halben Monatssold bis zwei Monatssolde ausgezahlt und wurden samt ihren Kindern fortgeschickt. KAISER, Kriegsgefangene; KROENER, Soldat als Ware. Die Auslösung konnte das eigene Leben retten; SEMLER, Tagebücher, S. 65: „Zu gleicher zeitt [August 1630] haben ettlich andere gintfeldische reütter zu Langen-Enßlingen zwo schwedische salvaguardien aufgehebt vnd nacher Veberlingen gebracht, deren einer auß Pommern gebürtig vnd adenlichen geschlächte sein sollen, dahero weiln rittmeister Gintfeld eine gůtte ranzion zu erheben verhofft, er bei leben gelassen worden“. Teilweise beschaffte man über sie Informationen; SEMLER, Tagebücher, S. 70 (1633): „Wie beschehen vnd seyn nahendt bei der statt [Überlingen; BW] vier schwedische reütter, so auf dem straiff geweßt, von vnsern tragonern betretten [angetroffen; BW], zwen darvon alsbald nidergemacht, zwen aber, so vmb quartier gebeten, gefangen in die statt herein gebracht worden. Deren der eine seines angebens Christian Schultheß von Friedland [S. 57] auß dem hertzogthumb Mechelburg gebürtig vnder der kayßerlichen armada siben jahr gedient vnd diesen sommer zu Newmarckht gefangen vnd vndergestoßen [am 30.6.1633; BW] worden: der ander aber von Saltzburg, vnderm obrist König geritten vnd zu Aichen [Aichach; BW] in Bayern vom feind gefangen vnd zum dienen genötiget worden. Vnd sagte der erste bei hoher betheurung vnd verpfändung leib vnd lebens, dass die schwedische vmb Pfullendorff ankomne vnd noch erwartende armada 24 regimenter starck, vnd werde alternis diebus von dem Horn vnd hertzogen Bernhard commandirt; führen 4 halb carthaunen mit sich vnd ettlich klainere veld stückhlin. Der ander vermainte, daß die armada 10.000 pferdt vnd 6.000 zu fůß starckh vnd der so geschwinde aufbruch von Tonawerd [Donauwörth; BW] in diese land beschehen seye, weiln man vernommen, dass die kayserische 8000 starckh in Würtemberg eingefallen“. Auf Gefangenenbefreiung standen harte Strafen. Pflummern hält in seinem Tagebuch fest: „Martij 24 [1638; BW] ist duca Federico di Savelli, so in dem letzsten vnglückhseeligen treffen von Rheinfelden den 3 Martij neben dem General von Wert, Enckefort vnd andern obristen vnd officiern gefangen vnd bis dahin zu Lauffenburg enthallten worden, durch hilff eines weibs auß: vnd den bemellten 24 Martij zu Baden [Kanton Aargau] ankommen, volgenden morgen nach Lucern geritten vnd von dannen nach Costantz vnd seinem vermellden nach fürter zu dem general Götzen ihne zu fürderlichem fortzug gegen den feind zu animirn passirt. Nach seinem außkommen seyn ein officier sambt noch einem soldaten wegen vnfleißiger wacht vnd der pfarherr zu Laufenburg neben seinem capellan auß verdacht, daß sie von deß duca vorhabender flucht waß gewüßt, gefänglich eingezogen, die gaistliche, wie verlautt, hart torquirt [gefoltert; BW], vnd obwoln sie vnschuldig geweßt, offentlich enthauptet; die ihenige fraw aber, durch deren hauß der duca sambt seinem camerdiener außkommen, vnd noch zwo personen mit růthen hart gestrichen worden“. Der Benediktoner-Abt Gaisser berichtet über die Verschiffung schwedischer Gefangener des Obristen John Forbes de Corse von Villingen nach Lindau (1633); STEMMLER, Tagebücher Bd. 1, S. 319: „Abschreckend war das Aussehen der meisten gemeinen Soldaten, da sie von Wunden entkräftet, mit eigenem oder fremdem Blute besudelt, von Schlägen geschwächt, der Kleider und Hüte beraubt, viele auch ohne Schuhe, mit zerrissenen Decken behängt, zu den Schiffen mehr getragen als geführt wurden, mit harter, aber ihren Taten angemessener Strafe belegt“. Gefangene waren je nach Vermögen darauf angewiesen, in den Städten ihren Unterhalt durch Betteln zu bestreiten. Sie wurden auch unter Offizieren als Geschenk gebraucht; KAISER, Wohin mit den Gefangenen ?, in: http://dkblog.hypotheses.org/108: „Im Frühsommer 1623 hatte Christian von Braunschweig, bekannt vor allem als ‚toller Halberstädter’, mit seinen Truppen in der Nähe Göttingens, also im Territorium seines älteren Bruders Herzog Friedrich Ulrich, Quartier genommen. In Scharmützeln mit Einheiten der Armee der Liga, die damals im Hessischen operierte, hatte er einige Gefangene gemacht. Was sollte nun mit diesen geschehen? Am 1. Juli a. St. wies er die Stadt Göttingen an, die gefangenen Kriegsknechte nicht freizulassen; vielmehr sollte die Stadt sie weiterhin ‚mit nottürfftigem vnterhalt’ versorgen, bis andere Anweisungen kämen. Genau das geschah wenige Tage später: Am 7. Juli a. St. erteilte Christian seinem Generalgewaltiger (d. h. der frühmodernen Militärpolizei) den Befehl, daß er ‚noch heutt vor der Sonnen vntergangk, viertzig dero zu Göttingen entthaltenen gefangenen Soldaten vom feinde, den Lieutenantt vnd Officiers außsgenommen, Laße auffhencken’. Um den Ernst der Anweisung zu unterstreichen, fügte er hinzu, daß dies ‚bei vermeidung vnser hochsten vngnad’ geschehen solle. Der Generalgewaltiger präsentierte daraufhin der Stadt Göttingen diesen Befehl; bei der dort überlieferten Abschrift findet sich auf der Rückseite die Notiz vom Folgetag: ‚Vff diesen Schein seindt dem Gewalthiger 20 Gefangene vff sein darneben mundtlich andeuten ausgevolgtt worden’. Der Vollzug fand also offenbar doch nicht mehr am 7. Juli, am Tag der Ausfertigung des Befehls, statt. Aber es besteht kaum ein Zweifel, daß zwanzig Kriegsgefangene mit dem Strang hingerichtet wurden. (StA Göttingen, Altes Aktenarchiv, Nr. 5774 fol. 2 Kopie; der Befehl an die Stadt Göttingen vom 1.7.1623 a.St. ebd. fol. 32 Ausf.)“. Bericht aus Stettin vom 8.4.1631; Relation Oder Bericht Auß Pommern. o. O. 1631: „Den 27. Martii sind alhier 108 gefangene eingebracht deren nach mehr folgen sollen / die werden alle in Schweden ins bergwerck gesand / das sie etwas redliches arbeiten lernen“. Teilweise wurden Gefangene auch unter den Offizieren verkauft; MÜHLICH; HAHN, Chronik 3. Bd., S. 607 (Schweinfurt 1645). Zur Problematik vgl. KAISER, Kriegsgefangene in der Frühen Neuzeit, S. 11-14. 1633 kostete die Auslösung bei der Kavallerie: Obrist 600 Rt. aufwärts, Obristleutnant 400 Rt., Obristwachtmeister 300 Rt., Rittmeister 200 Rt., Kapitänleutnant 70 Rt., Leutnant 60 Rt. bis 10 Rt. für einen Marketender.
[28] Battallie: Schlachtaufstellung, Kampf, Schlacht. In der Regel wurde 1 Stunde für die Aufstellung von 1.000 Mann für notwendig gehalten.
[29] Hannover; HHSD II, S. 197ff.
[30] confirmiert: bestärkt.
[31] Musketier [schwed. musketerare, musketör]: Fußsoldat, der die Muskete führte. Die Muskete war die klassische Feuerwaffe der Infanterie. Sie war ein Gewehr mit Luntenschloss, bei dem das Zündkraut auf der Pulverpfanne durch den Abzugsbügel und den Abzugshahn mit der eingesetzten Lunte entzündet wurde. Die Muskete hatte eine Schussweite bis zu 250 m. Wegen ihres Gewichts (7-10 kg) stützte man die Muskete auf Gabeln und legte sie mit dem Kolben an die Schulter. Nach einem Schuss wichen die Musketiere in den Haufen der Pikeniere zurück, um nachladen zu können. Nach 1630 wurden die Waffen leichter (ca. 5 kg) und die Musketiere zu einer höheren Feuergeschwindigkeit gedrillt; die Schussfolge betrug dann 1 bis 2 Schuss pro Minute (vgl. BUßMANN; SCHILLING, 1648, Bd .1, S. 89). Die zielfähige Schussweite betrug ca. 300 Meter, auf 100 Meter soll die Kugel die damals übliche Panzerung durchschlagen haben. Die Treffsicherheit soll bei 75 Metern Entfernung noch 50 % betragen haben. Die Aufhaltewirkung war im Nahbereich sehr hoch, die Getroffenen sollen sich förmlich überschlagen haben. Je nach Entfernung sollen jedoch im Normalfall nur 5-7% aller abgegebenen Schüsse eine Wirkung im Ziel gehabt haben. Vgl. WALLHAUSEN, Kriegskunst zu Fuß. Zudem rissen sie auf etwa 10 Meter Entfernung etwa dreimal so große Wundhöhlen wie moderne Infanteriegeschosse. Ausführlich beschrieben wird deren Handhabung bei ENGERISSER, Von Kronach nach Nördlingen, S. 544ff. Eine einfache Muskete kostete etwa 2 – 3 ¼ Gulden, die qualitativ besseren Suhler Waffen das Doppelte, so dass seine Ausrüstung nicht so kostenintensiv war. Die Muskete löste das Handrohr ab. Die ab 1630 im thüringischen Suhl gefertigte schwedische Muskete war etwa 140 cm lang bei einer Lauflänge von 102 cm und wog etwa 4,5 – 4,7 kg bei einem Kaliber von zumeist 19,7 mm. Sie konnte bereits ohne Stützgabel geschossen werden, wenngleich man diese noch länger zum Lade- und Zielvorgang benutzte. Die Zerstörung Suhls durch Isolanos Kroaten am 16./26.10.1634 geschah wohl auch in der Absicht, die Produktionsstätten und Lieferbetriebe dem Bedarf der schwedischen Armee endgültig zu entziehen. BRNARDÍC, Imperial Armies I. Für den Nahkampf trug er ein Seitengewehr – Kurzsäbel oder Degen – und schlug mit dem Kolben seiner Muskete zu. In aller Regel kämpfte er jedoch als Schütze aus der Ferne. Deshalb trug er keine Panzerung, schon ein leichter Helm war selten. Eine einfache Muskete kostete etwa 3 ¼ Gulden, die qualitativ besseren Suhler Waffen das Doppelte, so dass seine Ausrüstung nicht so kostenintensiv war. Im Notfall wurden die Musketiere auch als Dragoner verwendet, die aber zum Kampf absaßen. MAHR, Monro, S. 15: „Der Musketier schoß mit der Luntenschloßmuskete, die wegen ihres Gewichtes [etwa 5 kg] auf eine Gewehrgabel gelegt werden mußte. Die Waffe wurde im Stehen geladen, indem man den Inhalt der am Bandelier hängenden hölzernen Pulverkapseln, der sog. Apostel, in den Lauf schüttete und dann das Geschoß mit dem Ladestock hineinstieß. Verschossen wurden Bleikugeln, sog. Rollkugeln, die einen geringeren Durchmesser als das Kaliber des Laufes hatten, damit man sie auch bei Verschmutzung des Laufes durch die Rückstände der Pulvergase noch einführen und mit Stoff oder Papier verdämmen konnte. Da die Treffgenauigkeit dieser Musketen mit glattem Lauf auf die übliche Kampfentfernung von maximal 150 Metern unter 20 Prozent lag, wurde Salvenschießen bevorzugt. Die Verbände waren dabei in sog. Treffen aufgestellt. Dies waren Linien zu drei Gliedern, wobei das zweite Treffen etwa 50 Schritt, das dritte 100 Schritt hinter der Bataille, d. h. der Schlachtlinie des ersten Treffens, zu stehen kamen, so daß sie diese bei Bedarf rasch verstärken konnten. Gefeuert wurde gliedweise mit zeitlichem Abstand, damit für die einzelnen Glieder Zeit zum Laden bestand. Ein gut geübter Musketier konnte in drei Minuten zwei Schuß abgeben. Die Bleigeschosse bis zu 2 cm Kaliber verformten sich beim Aufprall auf den Körper leicht, und es entstanden schwere Fleischwunden. In den Kämpfen leisteten Feldscherer erste Hilfe; doch insgesamt blieb die medizinische Versorgung der Verwundeten mangelhaft. Selbst Streifschüsse führten oft aufgrund der Infektion mit Tetanus zum Tode, erst recht dann schwere Verletzungen“. Der Hildesheimer Arzt und Chronist Dr. Jordan berichtet 1634, dass sich unter den Gefallenen eines Scharmützels auch ein weiblicher Musketier in Männerkleidern gefunden habe; SCHLOTTER, Acta, S. 194. Der Bad Windheimer Chronist Pastorius hält unter 1631 fest; PASTORIUS, Kurtze Beschreibung, S. 100: „1631. Den 10. May eroberte der General Tylli die Stadt Magdeburg / plünderte sie aus / eine Jungfrau hatte ihres Bruders Kleider angezogen / und sich in ein groß leeres Weinfaß verstecket / ward endlich von einem Reuter gefunden / der dingte sie für einen Knecht / deme sie auch drey Monat treulich die Pferde wartete / und als in einem Treffen der Reuter umkam / und sie von denen Schweden gefangen gen Erffurt kam / ließ sie sich für einen Musquetirer unterhalten / dienete fünff Jahr redlich / hatte in etlichen Duellen mit dem Degen obsieget / wurde endlich durch eine Müllerin / wo sie im Quartier lag / verrathen / daß sie ein Weib wäre / da erzehlete sie der Commendantin allen Verlauff / die name sie zu einer Dienerin / kleidete sie / und schenckte ihr 100. Ducaten zum Heyrath-Guthe“. Weiter gibt es den Fall der Clara Oefelein, die schriftliche Aufzeichnungen über ihren Kriegsdienst hinterlassen haben soll. Allerdings heißt es schon bei Stanislaus Hohenspach (1577), zit. bei BAUMANN, Landsknechte, S. 77: „Gemeiniglich hat man 300 Mann unter dem Fenlein, ist 60 Glied alleda stellt man welsche Marketender, Huren und Buben in Landsknechtskleyder ein, muß alles gut seyn, gilt jedes ein Mann, wann schon das Ding, so in den Latz gehörig, zerspalten ist, gibet es doch einen Landsknecht“. Bei Bedarf wurden selbst Kinder schon als Musketiere eingesetzt (1632); so der Benediktiner-Abt Gaisser; STEMMLER, Tagebuch Bd. 1, S. 181f.; WALLHAUSEN, Kriegskunst zu Fuß; BRNARDÍC, Imperial Armies I, S. 33ff.; Vgl. KEITH, Pike and Shot Tactics; EICKHOFF; SCHOPPER, 1636, S. 59ff.
[32] emplorieren, emploieren: gebrauchen, beschäftigen, anstellen.
[33] conduicte: Führung.
[34] Gustaf Gustafsson af Vasaborg [24.5.1616 Stockholm-25.10.1653 Wildeshausen], schwedischer Obrist.
[35] Thilo Albrecht v. Uslar [13.12.1586 Wake-14./24.10.1634 vor Minden], braunschweigisch-lüneburgischer Generalleutnant.
[36] Torsten Stålhandske [Stolhanscha, Stahlhandschuh, Stahlhanndtschuch, Stalhans, Stallhans, Stalhansch, Stallhuschl, Stalhanß, Stallhaus] [1594 Porvoo/Borgå (Finnland)-21.4./1.5.1644 Haderslev/Nordschleswig], schwedischer Generalmajor.
[37] Knut Soop [Sop, Stob] [1597-1648], schwedischer Obrist.
[38] Isaac Axelsson [Axesyn, Achsel] [ – ], schwedischer Obrist.
[39] Major (schwed. Major): Der Major war im Dreißigjährigen Krieg der Oberwachtmeister des Regiments (zunächst nur in der Infanterie). Er sorgte für die Ausführung der Anordnungen und Befehle des Obristen und Obristleutnants. Im Frieden leitete er die Ausbildung der Soldaten, sorgte für die Instandhaltung ihrer Waffen, hatte die Aufsicht über die Munition und war verantwortlich für die Regimentsverwaltung. Im Krieg sorgte der Major für Ordnung auf dem Marsch und im Lager, beaufsichtigte die Wach- und Patrouillendienste und stellte die Regimenter in Schlachtordnung. Zudem hatte er den Vorsitz im Kriegs- und Standgericht. Er erhielt 1633 monatlich 200 Rt. bei der Infanterie und 300 fl. bei der Kavallerie.
[40] Stück: Man unterschied Kartaunen [Belagerungsgeschütz mit einer Rohrlänge des 18-19-fachen Rohrkalibers [17,5 – 19 cm], verschoss 40 oder 48 Pfund Eisen, Rohrgewicht: 60-70 Zentner, Gesamtgewicht: 95-105 Zentner, zum Vorspann nötig waren bis zu 32 Pferde: 20-24 Pferde zogen auf einem Rüstwagen das Rohr, 4-8 Pferde die Lafette]; Dreiviertelkartaune: langläufiges Geschütz mit großer Reichweite, Rohrlänge 16-17faches Kaliber, schoss 36 Pfund Eisen. Vgl. MIETH, Artilleria Recentior Praxis. Halbe Kartaune: langläufiges Geschütz mit großer Reichweite, Rohrlänge 22-faches Kaliber (15 cm), schoß 24 Pfund Eisen. Das Rohrgewicht betrug 40-45 Zentner, das Gesamtgewicht 70-74 Zentner. Als Vorspann wurden 20-25 Pferde benötigt. ENGERISSER, Von Nördlingen, S. 579. Das Material und der Feuerwerker-Lohn für den Abschuss einer einzigen 24-pfündigen Eisenkugel aus den „Halben Kartaunen“ kostete fünf Reichstaler – mehr als die monatliche Besoldung eines Fußsoldaten“. EICKHOFF; SCHOPPER, 1636, S. 81. Sie hatte eine max. Schussweite von 720 Meter; DAMBOER, Krise, S. 211. Viertelkartaune: „ein stück, welches 12 pfund eisen treibt, 36 zentner wiegt, und 24 kaliber lang ist. man hält diese stücke in den vestungen für die allerbequemste“ [DWB]. Meist als Feldschlange bezeichnet wurde auch die „Halbe Schlange“: langläufiges Geschütz mit großer Reichweite, Rohrlänge 32-34-faches Kaliber (10,5-11,5 cm), schoss 8-10 Pfund Eisen. Das Rohrgewicht betrug 22-30 Zentner, das Gesamtgewicht 34-48 Zentner. Als Vorspann wurden 10-16 Pferde benötigt; die „Quartierschlange“: 40-36-faches Kaliber (6,5-9 cm), Rohrgewicht: 12-24 Zentner, Gesamtgewicht: 18-36 Zentner, Vorspann: 6-12 Pferde; Falkone: 39-faches Kaliber Rohrgewicht: 14-20 Zentner, Gesamtgewicht: 22-30 Zentner, Vorspann: 6-8 Pferde; Haubitze als Steilfeuergeschütz, 10-faches Kaliber (12-15 cm), zumeist zum Verschießen von gehacktem Blei, Eisenstücken („Hagel“) bzw. Nägeln verwendet; Mörser als Steilfeuergeschütz zum Werfen von Brand- und Sprengkugeln (Bomben). Angaben nach ENGERISSER, Von Kronach nach Nördlingen, S. 575ff. Pro Tag konnten etwa 50 Schuss abgegeben werden. „Vom Nürnberger Stückegießer Leonhard Loewe ist die Rechnung für die Herstellung zweier jeweils 75 Zentner schwerer Belagerungsgeschütze erhalten, die auf den heutigen Wert hochgerechnet werden kann. An Material- und Lohnkosten verlangte Loewe 2.643 Gulden, das sind ca. 105.000 bis 132.000 Euro. Das Material und der Feuerwerker-Lohn für den Abschuss einer einzigen 24-pfündigen Eisenkugel aus diesen ‚Halben [?; BW] Kartaunen’ kosteten fünf Reichstaler – mehr als die monatliche Besoldung eines Fußsoldaten“. EICKHOFF; SCHOPPER, 1636, S. 81; SCHREIBER, Beschreibung, bzw. Anleitung, 3. Kapitel.
[41] Bagage: Gepäck; Tross. „Bagage“ war die Bezeichnung für den Gepäcktrain des Heeres, mit dem die Soldaten wie Offiziere neben dem Hausrat auch ihre gesamte Beute abtransportierten, so dass die Bagage während oder nach der Schlacht gern vom Feind oder von der eigenen Mannschaft geplündert wurde. Auch war man deshalb darauf aus, dass in den Bedingungen bei der freiwilligen Übergabe einer Stadt oder Festung die gesamte Bagage ungehindert abziehen durfte. Manchmal wurde „Bagage“ jedoch auch abwertend für den Tross überhaupt verwendet, die Begleitmannschaft des Heeres oder Heeresteils, die allerdings keinen Anspruch auf Verpflegungsrationen hatte; etwa 1, 5 mal (im Anfang des Krieges) bis 3-4mal (am Ende des Krieges) so stark wie die kämpfende Truppe: Soldatenfrauen, Kinder, Prostituierte 1.-4. Klasse („Mätresse“, „Concubine“, „Metze“, „Hure“), Trossjungen, Gefangene, zum Dienst bei der Artillerie verurteilte Straftäter, Feldprediger, Zigeuner als Kundschafter und Heilkundige, Feldchirurg, Feldscher, Handwerker, Sudelköche, Krämer, Marketender, -innen, Juden als Marketender, Soldatenwitwen, invalide Soldaten, mitlaufende Zivilisten aus den Hungergebieten, ehemalige Studenten, Bauern und Bauernknechte („Wintersoldaten“), die während der schlechten Jahreszeit zum Heer gingen, im Frühjahr aber wieder entliefen, Glücksspieler, vor der Strafverfolgung durch Behörden Davongelaufene, Kriegswaisen etc. KROENER, „ … und ist der jammer nit zu beschreiben“; LANGER, Hortus, S. 96ff.
[42] Quartier: Pardon, Gnade. Das hing zumeist von den Möglichkeiten ab, sich zu ranzionieren: Lösegeld zahlen, (sich) auslösen, (sich) freikaufen, auslösen von Personen, Gegenständen oder Vieh. Der organisierte Vieh-, vor allem aber Menschenraub stellte neben der Plünderung angesichts der fehlenden Soldauszahlung die wichtigste Einnahmequelle gerade der unteren Chargen dar, wurden doch pro Person je nach Stand und Beruf oft 300 Rt. und mehr erpresst. Vgl. WAGNER; WÜNSCH, Gottfried Staffel, S. 116; GROßNER; HALLER, Zu kurzem Bericht, S. 29. Dieses Lösegeld erreichte trotz der zwischen den Kriegsparteien abgeschlossenen Kartelle z. T. enorme Höhen: So bot der ehemalige Kommandant von Hanau, Sir James (Jacob) Ramsay „the Black“ [1589-1639], 70.000 Rt. für seine Freilassung, die aber vom Kaiserhof abgelehnt wurde (KELLER, Drangsale, S. 357), da man von ihm wissen wollte, wo er die bei der Einnahme Würzburgs und Bad Mergentheims erbeuteten Schätze (KELLER, Drangsale, S. 355) verborgen hatte. Ramsays Kriegsbeute wurde auf 900.000 Rt. beziffert; KELLER, Drangsale, S. 361; GAIL, Krieg, S. 28f.; MURDOCH (Hg.), SSNE ID: 3315. Auch die Leichname gefallener Offiziere mussten in der Regel vom Gegner ausgelöst werden. Im Mai 1633 war die kaiserliche Garnison in der Festung Lichtenau (bei Ansbach) so schlecht verproviantiert, dass Nürnberger Untertanen gefangen genommen wurden, die sich dann gegen Kartoffeln auslösen mussten; SODEN, Gustav Adolph 3. Bd., S. 450. Nach Lavater, Kriegs-Büchlein, S. 65, hatten folgende Soldaten bei Gefangennahme keinerlei Anspruch auf Quartier (Pardon): „wann ein Soldat ein eysen, zinne, in speck gegossen, gekäuete, gehauene oder gevierte Kugel schiesset, alle die gezogene Rohr und französische Füse [Steinschloßflinten] führen, haben das Quartier verwirkt. Item alle die jenigen, die von eysen geschrotete, viereckige und andere Geschröt vnd Stahel schiessen, oder geflammte Dägen, sollt du todt schlagen“. Auch wurde beim Angriff zum Teil die Parole ausgegeben, kein Quartier zu gewähren; THEATRUM EUROPAEUM 3. Bd., S. 609f. (Treffen bei Haselünne 11.1.1636).
[43] Rinteln [Kr. Grafschaft Schaumburg]; HHSD II, S. 395f.
[44] ut fasti docent: wie die Geschichtsbücher lehren.
[45] Bückeburg; HHSD II, S. 80ff.
[46] Bertram Adolf v. Quadt [Quatt, Quade, Qued, Quandt] zu Alsbach [ -8.7.1633 bei Hessisch Oldendorf], ligistischer Obrist.
[47] Bernhard Hackfort [Berent Ackfort] Freiherr v. Westerholt [Westerholtz] zu Lembeck [1595-18.11.1638 vor Vechta gefallen], kaiserlicher Generalwachtmeister.
[48] Heinrich Leo v. Westphalen zu Fürstenberg [1591-19.4.1640 Fritzlar], ligistischer Obrist, Generalfeldwachtmeister.
[49] Page: junger Adeliger, der kleinere Dienstleistungen unter Aufsicht des Kammerherrn in der Umgebung eines Fürsten verrichtete. Er wurde bei Hofe erzogen und später Offizier oder selber Kammerherr.
[50] Kornett: das Feldzeichen der kleinsten Einheit der Reiterei (entsprach der Kompanie).
[51] Fahne: Fahne einer Kompanie; metonymisch die ganze Kompanie. Als Feldzeichen war die Fahne zur Unterscheidung von Freund und Feind unverzichtbar, da es im Dreißigjährigen Krieg kaum einheitliche Uniformen gab. Sieg und Niederlage wurden nach der Zahl der eroberten und verlorenen Fahnen ermittelt. Die Fahne wurde geradezu kultisch verehrt, Soldaten legten ihren Eid auf die Fahne, nicht auf den Kriegsherrn ab.
[52] Marquard Rantzau [ -1633], schwedischer Generalkommissar, Generalmajor, Obrist.
[53] Beute: Beute war im allgemeinen Verständnis das Recht des Soldaten auf Entschädigung für die ständige Lebensgefahr, in der er sich befand und das Hauptmotiv für den Eintritt in die Armee. BURSCHEL, Söldner, S. 206ff. Für den lutherischen Theologen Scherertz galten allerdings nur der Bestand der Christenheit, die Reinheit des Glaubens und der Erhalt der Gerechtigkeit aus hinreichender Grund; BITZEL, Sigmund Scherertz, S. 153. Dabei war Beute ein sehr weit gefasster Begriff, von Beutekunst wie sakralen Gegenständen, Altarbildern, Bildern, Büchern (wie etwa in der Mainzer Universitätsbibliothek; FABIAN u. a., Handbuch Bd. 6, S. 172), bis hin zu den Wertgegenständen der Bürger. STEGMANN, Grafschaft Lippe, S. 63: Interessant ist auch die Auflistung der von staatischen Truppen bei einem Überfall erbeuteten Wertsachen des ligistischen Generalproviantmeisters Münch von Steinach, darunter augenscheinlich auch Beutegut: „Ein gantz gülden Khetten mit zweyen Strengen. Daran ist gewesen ein gantz güldens Agnus Dei. Aber ein kleins auch güldens Agnus Dei Gefeß. Wieder eins von Silber und vergolt. Ein schönes Malekhidt-Hertz mit Goldt eingefast. Ein Goldtstückh mit einem Crucifix. Aber ein Goldstückh mit einem Kreutz. Aber ein Hertz von Jaspis vom Goldt eingefast, so für den bösen Jammer gebraucht wirdt. Ein großer Petschafftring von Goldt. Ein von Silber und vergolts Palsambüchsel. Ein Paternoster an silbern Tradt gefast. Ein Pethbuch. Dan an Geldt, so Herr General-Proviantmeister bey sich gehabt, 7 Thlr. 18 Gr. Von der Handt ein gülden verfachen Denckhring. Aber ein Petschafftring von Goldt, daß Wappen in Jaspisstein geschnidten. Ein gestickt Paar Handtschuch. Ein Paar von silberfarb Daffent Hosenbänder mit lang seiden Spitzen“. In Askola, einer Gemeinde in Südfinnland, nördlich der Hafenstadt Porvoo, befindet sich noch heute in der Holzkirche eine reich verzierte barocke Kanzel, die von finnischen Söldnern als Kriegsbeute mitgebracht wurde. Die Beutezüge wurden zum Teil mit Wissen der Offiziere unternommen, denen dafür ein Teil der Beute überlassen werden musste. Besonders wertvolle Stücke nahmen die Kommandierenden (oder auch die Marketender) den oft verschuldeten Soldaten gegen einen Bruchteil des Wertes ab. Auch Offiziersfrauen handelten mit Beute oder trieben damit Tauschhandel. Vgl. die Schadensliste vom März 1634 bei BARNEKAMP, Sie hausen uebell, S. 58ff.; HERRMANN, Aus tiefer Not, S. 32ff.; REDLICH, De Praeda; ZIEGLER, Beute; KAISER, „ … aber ich muß erst Beute machen“. Der Superintendent Braun (1589-1651), zit. bei ROTH, Oberfranken, S. 303f.: „Die Ursache dieses Übels wird jeder leicht verstehen, wenn er die völlig aufgelöste Disziplin der Armee näher bedenkt. Die Fürsten selber und die Heerführer bringen ihr Militär ohne Geld zusammen; das muß von schnödem Raub sich selbst erhalten. Sie öffnen ihnen damit die Tür zu aller Nichtswürdigkeit und Grausamkeit, und müssen zu allen abscheulichen Freveln die Augen zudrücken. Pünktlich bezahlte Löhnung erhält den Soldaten, auch den sehr unguten, durch die Furcht vor dem Kriegsrecht bei seiner Pflicht und hindert ihn an Übergriffen. Enthält man ihm hingegen die Löhnung vor, so verwildert er und ist zu jeder Schandtat bereit. Dazu kommt die schon erwähnte Lässigkeit der Führer beim Anwerben der Soldaten. Denen liegt ja an der reinen Lehre und an der Gottesfurcht gar nichts; sondern die blinde Beutegier treibt sie zum Kriegsdienst; dadurch geht alles zu grunde. Wird eine Stadt oder eine Festung eingenommen, so schenkt der Sieger den Mannschaften der Besatzung, wenn sie auch noch so sehr dem päpstlichen Aberglauben ergeben sind, ihr Leben und reiht die Feinde in seine Truppen ein, nicht ohne gewaltigen Schaden der evangelischen Verbündeten. Denn um ihre Niederlage gründlich zu rächen, speien diese Scheusäler unter dem Deckmantel der militärischen Freiheit alles Gift ihrer Seele aus gegen die Bekenner des evangelischen Glaubens und wüten auf alle Weise in unsäglicher Grausamkeit, Raub und Wegelagerei, zünden die Dörfer an, plündern die Häuser, zwingen die Bewohner mit Schlägen, zu tun, was sie verlangen und stehen in keiner Weise auch hinter den grimmigsten Feinden zurück. Wie viel unserer Sache durch den Zuwachs dieser ehrlosen Räuber gedient ist, sieht jedermann leicht ein“.
Bei der Plünderung Magdeburgs hatten die Söldner 10 % des Nominalwertes auf Schmuck und Silbergeschirr erhalten; KOHL, Die Belagerung, Eroberung und Zerstörung, S. 82. Profitiert hatten nur die Regimentskommandeure bzw. die Stabsmarketender. WÜRDIG; HEESE, Dessauer Chronik, S. 222: „Wie demoralisierend der Krieg auch auf die Landeskinder wirkte, ergibt sich aus einem fürstlichen Erlaß mit Datum Dessau, 6. März 1637, in dem es heißt: ‚Nachdem die Erfahrung ergeben hat, daß viele eigennützige Leute den Soldaten Pferde, Vieh, Kupfer und anderes Hausgerät für ein Spottgeld abkaufen, dadurch die Soldaten ohne Not ins Land ziehen und zur Verübung weiterer Plünderungen und Brandstiftungen auf den Dörfern, zum mindesten aber zur Schädigung der Felder Anlaß geben; sie auch oft zu ihrem eigenen Schaden die erkauften Sachen wieder hergeben müssen und dadurch das ganze Land dem Verderben ausgesetzt wird, befehlen wir (die Fürsten) hierdurch allen unseren Beamten und obrigkeitlichen Stellen, daß sie allen Einwohnern und Untertanen alles Ernstes auferlegen, Pferde, Vieh und sonstige Dinge von den Soldaten nicht zu kaufen“ ’. Gehandelt wurde mit allem, was nur einigermaßen verkäuflich war. Erbeutete Waffen wurden zu Spottpreisen an Städte und Privatleute verkauft; SEMLER, Tagebücher, S. 27f. Der Überlinger Pflummern berichtet in seinem Tagebuch unter dem 4.5.1635; SEMLER, Tagebücher, S. 199: „Vmb dise zeitt daß rauben, stehlen vnd plündern auff dem landt, sonderlich vmb die statt Veberlingen daß tägliche handwerckh geweßt, dan nirgendts ein remedium, kein zucht noch kriegsdisciplin, vnd hatt obrist von Ossa zu Lindaw selbst denen, so vmb abstellung diser straßenraubereyen bei ihme angehalten (der jedoch auf dieses landts defension vom kayßer patenten empfangen) sollche abzustellen nicht möglich, dan wie er discurrirt, müeße der kayßer knecht haben, die knecht müeßen geessen haben, müeßen auch wol gemundirt seyn, vnd müeßen noch darzu fir andere ihr notturfft ein stuckh gellt im peüttel haben, ergo sollen vnd mögen sie stehlen, rauben vnd plündern, waß vnd wa sie finden“. Teilweise waren sogar Pfarrer mit auf Beute ausgezogen“. STÜNKEL, Rinteln, S. 20: „Im Oktober [1623; BW] erhält der Rat Kenntnis von einer für die Stadt sehr unangenehmen Angelegenheit, die unter Umständen die schwerstwiegenden Verwicklungen nach sich ziehen konnte. Uns aber zeigt dieses Vorkommnis, wie sehr schon in den ersten Jahren des Krieges die Moral der Bürgerschaft gelitten hatte. Es handelt sich um folgendes: Bürger der Stadt haben von den kaiserlichen Kriegsvölkern Seiner Exzellenz des Grafen von Tilly, die links der Weser von Exten bis Hemeringen lagerten, unter anderem gestohlenes Vieh gekauft und es durch Tillysche Soldaten nach Rinteln bringen lassen. Bei der Rückkehr von der Stadt in ihre Quartiere haben diese Kriegsknechte die Kirche in Hohenrode aufgebrochen und ausgeplündert. Als der Rat am 2. Oktober davon erfährt, ordnet er sofort eine Untersuchung über diese Vorkommnisse unter den Bürgern und Bürgerschützen an. Dabei stellt sich heraus, daß nicht nur einzelne Bürger im Tillyschen Lager gewesen sind, sondern daß auch Schützen aus allen Korporalschaften die scheinbar billige Kaufgelegenheit wahrgenommen haben und daß in diese schmutzige Angelegenheit, denn es handelt sich ja meist um gestohlene Sachen, nicht nur die Männer, sondern auch deren Ehefrauen und Dienstmädchen und auch die Schutzjuden verwickelt sind. Bürgermeister Curt Hanes Magd hat von den Soldaten Kleider gekauft, ein Knecht dem Juden Leaser eine geringe Kuh für einen Taler abgenommen, ein Fremder hat zwei große Kessel mitgebracht, die Frau von Carl Schnar hat elf Kuhhäute für 4 Tonnen Broihan eingehandelt, Carsten Bohne hat einen Krug für 2 ½ Groschen, Jürgen Bennemanns Magd einige Kleider, Lewin Storck eine Kuh für 2 ½ Taler, Hans Rosemeyer zwei Kühe und ein Rind für 7 Taler gekauft. Andere haben eingehandelt ein Pferd für fünf Koppstück, eine Büchse für einen Taler, Kessel, Messingkannen, Schaffelle, ein Leibstück für drei Brote, fünf Schlösser, die aus dem Hause von Wartensleben in Exten stammten – der Käufer behauptet aber, sie dem früheren Besitzer schon wieder angeboten zu haben – , Feuerschlösser, 15 Stück Leder, Mäntel und Leinwand, ein altes Feuerrohr, Degen, einen Messingkessel für einen Hut, einen kupfernen Kessel für zwölf Groschen, ein Bandelier, eine Kuhhaut, ‚so durchschossen‘, für 2 Koppstück, einen kleinen ‚Pott‘, ein Leinenlaken, ein Stück Samt, Wollgarn usw. Einer kaufte eine Axt von einem Soldaten, ‚der ihn Hungers halber um Gottes Willen gebeten, ihm ein Brot dafür zu geben‘ “.
[54] Kasack: casache (ital.), sacaque: Poncho ähnlicher Überwurfmantel, ärmellos oder mit aufknüpfbaren Ärmeln.
[55] Trompeter: Eigener, mit 12 fl. monatlich wie der Trommelschläger recht gut bezahlter, aber auch risikoreicher Berufsstand innerhalb des Militärs und bei Hof mit wichtigen Aufgaben, z. B. Verhandlungen mit belagerten Städten, Überbringung wichtiger Schriftstücke etc., beim Militär mit Aufstiegsmöglichkeit in die unteren Offiziersränge.
[56] Obristleutnant [schwed. Överstelöjtnant]: Der Obristleutnant war der Stellvertreter des Obristen, der dessen Kompetenzen auch bei dessen häufiger, von den Kriegsherrn immer wieder kritisierten Abwesenheit – bedingt durch Minderjährigkeit, Krankheit, Badekuren, persönliche Geschäfte, Wallfahrten oder Aufenthalt in der nächsten Stadt, vor allem bei Ausbruch von Lagerseuchen – besaß. Meist trat der Obristleutnant als militärischer Subunternehmer auf, der dem Obristen Soldaten und die dazu gehörigen Offiziere zur Verfügung stellte. Verlangt waren in der Regel, dass er die nötige Autorität, aber auch Härte gegenüber den Regimentsoffizieren und Soldaten bewies und für die Verteilung des Soldes sorgte, falls dieser eintraf. Auch die Ergänzung des Regiments und die Anwerbung von Fachleuten oblagen ihm. Zu den weiteren Aufgaben gehörten Exerzieren, Bekleidungsbeschaffung, Garnisons- und Logieraufsicht, Überwachung der Marschordnung, Verproviantierung etc. Der Profos hatte die Aufgabe, hereingebrachte Lebensmittel dem Obristleutnant zu bringen, der die Preise für die Marketender festlegte. Um all diese Aufgaben bewältigen zu können, waren umfangreiche Kenntnisse und Erfahrungen notwendig. Nicht selten lag die eigentliche Führung des Regiments in der Verantwortung eines fähigen Obristleutnants, der im Monat je nach Truppengattung zwischen 120 [nach der „Ordnung Wie es mit der verpflegung der Soldaten“ (1630)] und 150 fl. bezog, in der brandenburgischen Armee sogar 300 fl. Voraussetzung war allerdings in der bayerischen Armee die richtige Religionszugehörigkeit. Maximilian I. hatte Tilly den Ersatz der unkatholischen Offiziere befohlen; Bayerisches Hauptstaatsarchiv München Dreißigjähriger Krieg Akten 236, fol. 39′ (Ausfertigung): Maximilian I. an Tilly, München, 1629 XI 04: … „wann man dergleich officiren nit in allen fällen, wie es die unuorsehen notdurfft erfordert, gebrauchen khan und darff: alß werdet ihr euch angelegen sein lassen, wie die uncatholischen officiri, sowol undere diesem alß anderen regimentern nach unnd nach sovil muglich abgeschoben unnd ihre stellen mit catholischen qualificirten subiectis ersezt werden konnde“. Der Obristleutnant war zumeist auch Hauptmann einer Kompanie, so dass er bei Einquartierungen und Garnisonsdienst zwei Quartiere und damit auch entsprechende Verpflegung und Bezahlung beanspruchte oder es zumindest versuchte. Von Piccolomini stammt angeblich der Ausspruch (1642): „Ein teutscher tauge für mehrers nicht alß die Oberstleutnantstell“. HÖBELT, „Wallsteinisch spielen“, S. 285.
[57] Gemeint ist der damalige Kommandant in Hameln Hans Wilhelm Schelhammer [Schellhamer, Schelhamer, Scheelhauer] [ -1635 Speyer], ligistischer Generalwachtmeister.
[58] chatechotisch: mündlich.
[59] Kartaune, halbe: langläufiges Geschütz mit großer Reichweite, Rohrlänge 22-faches Kaliber (15 cm), schoß 24 Pfund Eisen. Das Rohrgewicht betrug 40-45 Zentner, das Gesamtgewicht 70-74 Zentner. Als Vorspann wurden 20-25 Pferde benötigt. ENGERISSER, Von Nördlingen, S. 579. Das Material und der Feuerwerker-Lohn für den Abschuss einer einzigen 24-pfündigen Eisenkugel aus den „Halben Kartaunen“ kostete fünf Reichstaler – mehr als die monatliche Besoldung eines Fußsoldaten“. EICKHOFF; SCHOPPER, 1636, S. 81. Sie hatte eine max. Schussweite von 720 Meter; DAMBOER, Krise, S. 211.
[60] Kungliga Biblioteket Stockholm, Svea krig, Nr. 224a.
[61] Johan Banér [Bannier, Panier, Panner] [23.6./3.7.1596 Djursholm-20.5.1641 Halberstadt], schwedischer Feldmarschall. Vgl. BJÖRLIN, Johan Baner.
[62] Regiment: Größte Einheit im Heer, aber mit höchst unterschiedlicher Stärke: Für die Aufstellung eines Regiments waren allein für Werbegelder, Laufgelder, den ersten Sold und die Ausrüstung 1631 bereits ca. 135.000 fl. notwendig. Zum Teil wurden die Kosten dadurch aufgebracht, dass der Obrist Verträge mit Hauptleuten abschloss, die ihrerseits unter Androhung einer Geldstrafe eine bestimmte Anzahl von Söldnern aufbringen mussten. Die Hauptleute warben daher Fähnriche, Kornetts und Unteroffiziere an, die Söldner mitbrachten. Adlige Hauptleute oder Rittmeister brachten zudem Eigenleute von ihren Besitzungen mit. Wegen der z. T. immensen Aufstellungskosten kam es vor, dass Obristen die Teilnahme an den Kämpfen mitten in der Schlacht verweigerten, um ihr Regiment nicht aufs Spiel zu setzen. Der jährliche Unterhalt eines Fußregiments von 3.000 Mann Soll-Stärke wurde mit 400- 450.000 fl. eines Reiterregiments von 1.200 Mann mit 260.-300.000 fl. angesetzt. Zu den Soldaufwendungen für die bayerischen Regimenter vgl. GOETZ, Kriegskosten Bayerns, S. 120ff.; KAPSER, Kriegsorganisation, S. 277ff. Ein Regiment zu Fuß umfasste de facto bei den Kaiserlichen zwischen 650 und 1.100, ein Regiment zu Pferd zwischen 320 und 440, bei den Schweden ein Regiment zu Fuß zwischen 480 und 1.000 (offiziell 1.200 Mann), zu Pferd zwischen 400 und 580 Mann, bei den Bayerischen 1 Regiment zu Fuß zwischen 1.250 und 2.350, 1 Regiment zu Roß zwischen 460 und 875 Mann. Das Regiment wurde vom Obristen aufgestellt, von dem Vorgänger übernommen und oft vom seinem Obristleutnant geführt. Über die Ist-Stärke eines Regiments lassen sich selten genaue Angaben finden. Das kurbrandenburgische Regiment Carl Joachim v. Karberg [Kerberg] sollte 1638 sollte auf 600 Mann gebracht werden, es kam aber nie auf 200. Karberg wurde der Prozess gemacht, er wurde verhaftet und kassiert; OELSNITZ, Geschichte, S. 64. Als 1644 der kaiserliche Generalwachtmeister Johann Wilhelm v. Hunolstein die Stärke der in Böhmen stehenden Regimenter feststellen sollte, zählte er 3.950 Mann, die Obristen hatten 6.685 Mann angegeben. REBITSCH, Gallas, S. 211; BOCKHORST, Westfälische Adlige.
[63] Müncheberg [LK Märkisch-Oderland]; HHSD X, S. 284f.
[64] MANKELL, Uppgifter, S. 295. Unter dem Namen„Socken“ auch im THEATRUM EUROPAEUM 3. Bd., S. 176.
[65] Wolf v. Creytzen [Kreuz, Kreutz, Creutz, Creitz] [1598-1672], kaiserlicher Obristleutnant, Obrist.
[66] Anton Brunnecker [Brunacher, Brunneck, Brünneck, Breunecker, Brünecker, Brauneck, Braunegk, Bruncker, Buncker, Brunecker, Brennekenki, Braurock, „Grünecker“] [ – ], braunschweig-lüneburgischer, dann schwedischer Obrist.
[67] Heinrich Graf v. Dönhof [ – ], piltinscher Landrat, königlich-polnischer Rat, Starost auf Ermes [Ērģeme; Livland (lettisch: Vidzeme)].Vgl. HUPEL, Materialien, S. 351.
[68] Ludwig Graf v. Weiher [ -1656].
[69] Wolf Heinrich v. Baudissin [1579 (1597 ?) Schloss Lupa-4.7.1646 Elbing (Belschwitz)], schwedischer, dann kursächsischer Generalleutnant. Vgl. http://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=19088.
[70] Mägdeberg, einer von den Hegau-Bergen, Gem. Mühlhausen-Ehingen [LK Konstanz].
[71] Dr. Conrad Jordan [1591-1659], Chronist, seit 1620 Arzt, seit 1629 in Hildesheim wohnhaft, ab 1635 mehrfach Ratsherr, Stadtarchivar; SCHLOTTER, Acta; SCHLOTTER, Hans, Der Rat der Stadt Hildesheim von 1300-1634, in: Norddeutsche Familienkunde Heft 4, 1986, S. 581-585; SCHLOTTER, Hans, Die Bürgermeister und Ratsherren der Stadt Hildesheim 1147-1634, in: Norddeutsche Familienkunde Heft 3, 1979, S. 551-558.
[72] Dam [Thame, Tam, Damm] Vitzthum [Vitzdum, Vizthum] v. Eckstädt [10.9.1595-21.3.1638], kursächsischer Generalmajor.
[73] SCHLOTTER, Acta, 242f.
[74] Johann Georg I. Kurfürst v. Sachsen [5.3.1585 Dresden-18.10.1656 Dresden].
[75] Egeln [Kr. Wanzleben/Staßfurt]; HHSD XI, S. 98f.
[76] Wittenberg [Kr. Wittenberg]; HHSD XI, S. 504ff.
[77] Schönebeck [Kr. Calbe/Schönebeck]; HHSD XI, S. 420ff.
[78] Adam v. Pfuel [Pfull, Pfuhls, Phuell, Pfuell, Pfuhl] [1604-5.2.1659 Helfta], schwedischer Generalleutnant.
[79] Siegmund v. Wolframsdorf [Wolfersdorf] [6.12.1588 Bornsdorf-1.4.1651 Bornsdorf], kursächsischer Obrist, Generalwachtmeister.
[80] Untergewehr, Unterwehr: Degen oder Rapier.
[81] Morgenstern: Der Morgenstern war eine im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit gebräuchliche Hiebwaffe. Er war vermutlich ein Abkömmling des antiken Knüppels oder des Dreschflegels (ersteres ist wahrscheinlicher). Die klassische Ausführung bestand aus einem bis zu 50 cm langen, kräftigen Holzstab als Griff an dessen Ende der Kopf, eine schwere Eisenkugel, saß (etwa 8 bis 12 cm im Durchmesser). Diese war mit etwa 1 bis 2 cm langen Spitzen besetzt. Oft war am unteren Ende des Griffs ein Faustriemen befestigt, der verhindern sollte, dass die Waffe im Kampfgetümmel verloren ging. Die Handhabung war mit der eines Streithammers oder eines Beils zu vergleichen. Varianten, bei denen der Kopf über eine Kette mit dem Griffstück verbunden war, werden als Flegel (auch: Streitflegel) bezeichnet. Wenn der Kopf mit Klingen besetzt war, spricht man üblicherweise von einem Streitkolben. Morgensterne wurden gern im Grabenkampf in den Laufgräben eingesetzt. Die Waffen, bei denen Eisenkugeln mit Ketten an sehr kurzen Stielen befestigt sind, sind eine Erfindung des Historismus im 19. Jahrhundert. Die Verwendung eines Morgensterns galt als „unritterlich“. Der Morgenstern wurde bis in das 17. Jahrhundert hinein verwendet [wikipedia] und wurde auch bei Ausfällen, z. B. von den Kaiserlichen (1633) aus Osnabrück, verwendet; TEGEDER; KREIENBRINK, der osnabrugischenn handlung, S. 249.
[82] Schlachtschwert: Schlachtschwerter wurden z. B. bei Ausfällen der Belagerten und Angriffen verwendet und galten als geeignete Waffen für den Graben- und Nahkampf, so überliefert bei den Belagerungen Frankfurts/Oder 1631, Kronachs 1634, Regensburgs 1634 und der Veste Coburg 1635. Gustav Adolf hatte die hinteren Reihen der Infanterie angewiesen, zunächst die Schwerter zu benutzen und erst im Nahkampf zu Pistolen zu greifen. Allerdings besaßen viele Infanteristen wegen der zu geringen Stückzahl nur Äxte oder Beile.
[83] Handgranaten: runde, mit Pulver gefüllte Eisenkugeln, die mit einer Lunte gezündet wurden. Granaten können, als selten erhaltene Beispiele damaliger Feuerwerkerkunst, noch heute in den Kunstsammlungen der Veste Coburg besichtigt werden. Während die Handgranaten aus runden, mit Pulver gefüllten Eisenkugeln bestanden und mit einer Lunte gezündet wurden, gab es auch schon Fallgranaten, die beim Aufschlag mittels eines Reibungszünders explodierten. Granadiere waren ursprünglich Soldaten, die Handgranaten gegen den Feind schleuderten. Bereits 1631 wurden sie bei der Eroberung Frankfurt a. d. Oder von den Iren eingesetzt; MAHR, Monro, S. 112. Als Generalmajor Lars Kagge 1634 in Regensburg belagert wurde, forderte er zu dieser gefährlichen Tätigkeit – ihre Splitter konnten bis zu 50 Schritte gefährlich werden – Freiwillige gegen höheren Sold auf und wurde so der Schöpfer der Granadiere. Chemnitz, S. 467, beschreibt bei dieser Gelegenheit erstmalig den Einsatz von Handgranaten: „Gebrauchte sich [der Gen. Maj. Kagg] hierunter zuforderst der handgranaten, den Feind in confusion zubringen, nachgehends, wann solches geschehen, der Kurtzen wehren [Helmbarten] zum niedermetzeln. Wobey er jennige, so die handgranaten zu erst geworffen, mit einer gewissen recompens [nach Heilmann 2 Reichstaler] zu einer so gefährlichen action angefrischet‘. ENGERISSER, Von Kronach, S. 277.
[84] böhmischer Ohrlöffel: Partisane: „spießartige, vom 15.-18. Jahrh. gebräuchliche Stoßwaffe mit breiter, zweischneidiger Hauptspitze und zwei geraden oder wenig gekrümmten Nebenspitzen, im Gegensatz zur Korseke, deren Nebenspitzen stark gekrümmt sind“. [http://www.zeno.org/Meyers-1905/A/Partisane] „Die böhmischen Bauern trugen früher starke Prügel, die unten einen dicken Knorren hatten, und wegen ihrer Gestalt mit einem Ohrlöffel verglichen werden konnten“. [http://www.zeno.org/Wander-1867/A/Ohrloeffel].
[85] Aken [Kr. Calbe/Köthen]; HHSD XI, S. 2ff.
[86] KUNATH, Kursachsen, S. 212f.
[87] Kapitänleutnant [schwed. Kaptenslöjtnant]: Der Kapitänleutnant war der Stellvertreter des Kapitäns. Der Rang entsprach dem Hauptmann der kaiserlichen Armee. Hauptmann war der vom Obristen eingesetzte Oberbefehlshaber eines Fähnleins der Infanterie. (Nach der Umbenennung des Fähnleins in Kompanie wurde er als Kapitän bezeichnet.) Der Hauptmann war verantwortlich für Werbung und Soldzahlung, für Disziplin, Ausrüstung und Verpflegung sowie für die Ernennung der untergebenen Führer. Oft war er in erster Linie für die materielle Versorgung der Truppe zuständig und die eigentlichen militärischen Aufgaben wurden von seinem Stellvertreter, dem Kapitänleutnant übernommen. Der Hauptmann marschierte an der Spitze des Fähnleins, im Zug abwechselnd an der Spitze bzw. am Ende. Bei Eilmärschen hatte er zusammen mit einem Leutnant am Ende zu marschieren, um die Soldaten nachzutreiben und auch Desertionen zu verhindern. Er kontrollierte auch die Feldscher und die Feldapotheke. Er besaß Rechenschafts- und Meldepflicht gegenüber dem Obristen, dem Obristleutnant und dem Major. Dem Hauptmann der Infanterie entsprach der Rittmeister der Kavallerie. Junge Adlige traten oft als Hauptleute in die Armee ein.
[88] Johann Walter [ – ], schwedischer Kapitänleutnant.
[89] Simon Bartholomaeus Mathaei [ – ], schwedischer Sekretär. Vgl. ANREP, Svenska adelns attar-taflor 3. Bd., S. 478.
[90] Stralsund [LK Vorpommern-Rügen]; HHSD XII, S. 292ff.
[91] Johan Banér [Bannier, Panier, Panner] [23.6./3.7.1596 Djursholm-20.5.1641 Halberstadt], schwedischer Feldmarschall. Vgl. BJÖRLIN, Johan Baner.
[92] Faction: Gruppe, Tatgemeinschaft.
[93] Disgoustement: Ekel, Widerwillen, Verdruss.
[94] Hier erfolgt die angegebene Namensnennung.
[95] Das richtete sich wohl gegen poln. Soldaten, mit denen man schlechte Erfahrungen gemacht hatte.
[96] Władysław IV. Wasa [Władysław IV Waza] [9.6.1595 Krakau-20.5.1648 Merecz] ab 1632, als gewählter König v. Polen u. Großfürst v. Litauen, Herrscher v. Polen-Litauen sowie Titularkönig v. Schweden. Er war ab 1610 erwählter Zar v. Russland u. nach seiner Verdrängung durch Michael Romanow 1613-1634 Titularzar v. Russland.
[97] Cäcilia Renata v. Österreich [16.7.1611 Graz-24.3.1644 Wilna], Erzherzogin v. Österreich u. durch Heirat Königin v. Polen sowie Großfürstin v. Litauen.
[98] Jesuiten: Der katholische Jesuitenorden (Societas Jesu), 1534 gegründet von dem baskischen Adligen und ehemaligen Offizier Ignatius von Loyola, war der wichtigste institutionelle Träger der Gegenreformation. Seine Tätigkeitsfelder waren die Ausbreitung und Festigung des katholischen Glaubens mit zeitgemäßen Mitteln durch Mission, hervorragenden Unterricht und Erziehung, die „nachgehende Seelsorge“, wissenschaftliche und literarische Tätigkeit sowie die Bewunderung erregenden Theateraufführungen. Gerade im bayerischen Heer fanden sich auffällig viele Jesuiten als Militärseelsorger, die aufgrund ihrer Kenntnisse sogar als Geschützausrichter im Kampf tätig waren. Zudem fungierten sie am Kaiserhof und am kurfürstlichen Hof in München als Beichtväter und einflussreiche Berater. Die Jesuiten gelobten die Bereitschaft zu jeder Sendung durch den Papst. Die Aufnahme in den Orden setzt ein abgeschlossenes Studium der Theologie und eines weiteren Faches voraus. Es gab Brüder („Koadjutoren“) und Priester („Patres“). Die weltlichen Laienbrüder mit zeitlich einfachem Gelübde („Coadjutores probati“) unterschieden sich von denen mit dem ewigen Gelübde („Coadjutores temporales formati“). Die Priester werden unterschieden nach einfachen Ordenspriestern („Coadjutores spirituales formati“), die mit drei Gelübden („Professi trium votorum“) und die mit vier Gelübden („Professi quatuor votorum“). Nur Letztere waren für Führungspositionen ausersehen. Zwölf bis fünfzehn Jahre dauerte die gesamte Ausbildung, die ein zweijähriges Noviziat, ein siebenjähriges Scholastikat mit Studium der Theologie und Philosophie vorsah. Danach folgte eine mehrjährige Lehrtätigkeit (Magisterium), an die sich vier Jahre Theologiestudium anschlossen. Es folgten mehrere Jahre Seelsorge oder Schuldienst. Erst dann erfolgte das dritte Noviziatsjahr („Tertiat“), ab 33 Jahren konnte man zu den „ewigen Gelübden“ zugelassen werden. Vgl. MÜLLER, Jesuiten, S. 193-214.
[99] Alexander Greiffenclau v. Vollrads [ -1648], ksl. Resident am poln. Königshof.
[100] Kreditiv: Beglaubigungsschreiben.
[101] BÄR, Die Politik Pommerns, Nr. 204, S. 377.
[102] Herman Wrangel [29.6.1587 Estland-11.12.1643 Riga], schwedischer Feldmarschall. Vgl. auch die Erwähnungen bei BACKHAUS, Brev 1-2. Vgl. http://www.historiesajten.se/visainfo.asp?id=78.
[103] MANKELL, Uppgifter, S. 279.
[104] http://privat.bahnhof.se/wb261402/generaler.htm.
Veröffentlicht unter Miniaturen
Verschlagwortet mit S
Kommentare deaktiviert für Sack [Sock], Otto von
Plettenberg, N Graf von
Plettenberg, N Graf von; Obrist [ -12.5. 1644 Kolding] Plettenberg stand 1639 als Obrist[1] in schwedischen Diensten.[2]
„Diesmal hatte die Stadt [Bad Salzungen;[3] BW] besonders zu leiden, da mit dem Einverständnis der Landesregierung[4] die von dem Amt zu verquartierenden schwedischen Abteilungen sämtlich innerhalb der Ringmauer untergebracht werden mußten, sodaß im August das Regiment[5] des Majors von Boy[6] 12 Tage hier lag und im September dasjenige des Grafen von Plettenberg auf längere Zeit folgte. Mancher Bürger musste 10-14 Soldaten in seinem Hause beherbergen und unterhalten. Kein Wunder, daß ob dieser schweren Bedrückung in der Bürgerschaft großer Unmut herrschte. Derselbe kam schließlich zum offenen Ausbruch. Da man dem Rat irrtümlich die Schuld an diesen Verhältnissen zuschob, machte man der Erbitterung durch grobe Beleidigungen der regierenden Bürgermeister und des gesamten Rates Luft. Die Wut der Bevölkerung richtete sich besonders gegen den Stadtschreiber, der die Quartierlisten führte und die Quartierzettel[7] ausschrieb. Man rottete sich vor seinem Hause zusammen und obwohl er selbst das Haus voll Soldaten hatte, warf man ihm die Fensterscheiben ein. Die Erbitterten drohten, wie der Bericht vermeldet, dass ‚sie bei den Soldaten verraten und verkaufen wollten, wo sie nur könnten und möchten, also dass man sich endlich gar eines Aufstandes zu befahren gehabt’“.[8]
Das „Theatrum Europaeum“[9] berichtet unter dem 12.5.1644 über einen dänischen Teilerfolg gegen Wrangels[10] Truppen: „Bey Eingang deß Maij Monats / den den Dänischen die Fortun / gegen die Schwedischen / nicht vbel favorisiret. Dann als die Dänischen / am 2. 12. dieses / mit einer ziemblichen Anzahl deß Morgens bey Anbrechung deß Tages / bey Coldingen[11] angesetzt / haben sie sich entschlossen / denen daselbst Quartierenden vier Schwedischen Regimentern / als deß General Major[12] Wrangels / Obristen Lindens[13] / Obristen Plettenbergs[14] / vnd Obristen Paickels[15] / vnversehens einzufallen. Nun ist nicht ohn / es were dieses Orts den Schwedischen ein ziemblicher Schaden zugefügt worden: Im Fall diese gantze Compagny[16] der vier benanten Regimenter sich völlig in Coldingen befunden befunden hätten. Dieweilen aber die meisten dieser Völcker / vnd zwar zweyhundert nach Renßburg[17] / zweyhundert nach Hadersleben[18] / etliche hundert nach der Schantz Riepen[19] / vnd andere Oerter außcommandirt gewesen / auch viel in ihren zugeschriebenen Quartieren auff Salvaquardien[20] / vnd also nur theils Officirer / mit dem Vberrest / sich zu Hauß befunden: Als haben die Dänischen ausser was in beykommender Specification vermeldet / weiter nichts erhalten / weilen die meisten sich eylends auff das Schloß / wo selbsten die Fähnlein gewesen begeben / vnnd also vnangefochten verblieben.
Folget ein Verzeichnuß der Officirer / vnd gemeinen Soldaten / so in dem Einfall zu Coldingen gefangen / beschädiget / vnd todt geblieben. Von General Major Wrangels Regiment gefangen / 3. Leutenants[21] / 1. Fähnderich[22] / 17. gemeiner Knecht.[23] Todt / 1. Major[24] Namens Luther / 1. Unter-Officirer[25] / 5. Gemeine / etc. Von beschädigten aber hat sich niemand befunden.
Von deß Obristen Lindens Regiment gefangen / 1. Major genant Döring / 1. Leutenant / 2. Fähnderich / 3. Vnder-Officirer / 22. gemeine. Beschädigt / 1. Capitäin Leutenant[26] / vnnd 4. Gemeine. Todte / Obrister Plettenberg / 1. Capitäin / 1. Leutenant / 3. Vnder-Officirer / 4. Gemeine.
Von deß Obristen Paickels Regiment gefangen / 1. Capitäin / 3. Vnter-Officirer / 6. Gemeine / etc. beschädigt / 1. Obrist Leutenant[27] / Namens Lindy[28] / 6. gemeine. todt / 1 . Leutenant / 1. Fähnderich / vnd 5. Gemeine / etc“.[29]
[1] Obrist: I. Regimentskommandeur oder Regimentschef mit legislativer und exekutiver Gewalt, „Bandenführer unter besonderem Rechtstitel“ (ROECK, Als wollt die Welt, S. 265), der für Bewaffnung und Bezahlung seiner Soldaten und deren Disziplin sorgte, mit oberster Rechtsprechung und Befehlsgewalt über Leben und Tod. Dieses Vertragsverhältnis mit dem obersten Kriegsherrn wurde nach dem Krieg durch die Verstaatlichung der Armee in ein Dienstverhältnis umgewandelt. Voraussetzungen für die Beförderung waren (zumindest in der kurbayerischen Armee) richtige Religionszugehörigkeit (oder die Konversion), Kompetenz (Anciennität und Leistung), finanzielle Mittel (die Aufstellung eines Fußregiments verschlang 1631 in der Anlaufphase ca. 135.000 fl.) und Herkunft bzw. verwandtschaftliche Beziehungen (Protektion). Der Obrist ernannte die Offiziere. Als Chef eines Regiments übte er nicht nur das Straf- und Begnadigungsrecht über seine Regimentsangehörigen aus, sondern er war auch Inhaber einer besonderen Leibkompanie, die ein Kapitänleutnant als sein Stellvertreter führte. Ein Obrist erhielt in der Regel einen Monatssold von 500-800 fl. je nach Truppengattung. Daneben bezog er Einkünfte aus der Vergabe von Offiziersstellen. Weitere Einnahmen kamen aus der Ausstellung von Heiratsbewilligungen, aus Ranzionsgeldern – 1/10 davon dürfte er als Kommandeur erhalten haben – , Verpflegungsgeldern, Kontributionen, Ausstellung von Salvagardia-Briefen – die er auch in gedruckter Form gegen entsprechende Gebühr ausstellen ließ – und auch aus den Summen, die dem jeweiligen Regiment für Instandhaltung und Beschaffung von Waffen, Bekleidung und Werbegeldern ausgezahlt wurden. Da der Sold teilweise über die Kommandeure ausbezahlt werden sollten, behielten diese einen Teil für sich selbst oder führten „Blinde“ oder Stellen auf, die aber nicht besetzt waren. Auch ersetzten sie zum Teil den gelieferten Sold durch eine schlechtere Münze. Zudem wurde der Sold unter dem Vorwand, Ausrüstung beschaffen zu müssen, gekürzt oder die Kontribution unterschlagen. Vgl. BELLINCKHAUSEN; TEGEDER; KREIENBRINK, der osnabrugischen handlung, S. 277: „Wir burger mußen alle wochen unse contribution zahlen, die obristen nehmmens geldt zu sich, und die gemeinen soldaten mußen hunger leyden“. Der Austausch altgedienter Soldaten durch neugeworbene diente dazu, ausstehende Soldansprüche in die eigene Tasche zu stecken. Zu diesen „Einkünften“ kamen noch die üblichen „Verehrungen“, die mit dem Rang stiegen und nicht anderes als eine Form von Erpressung darstellten, und die Zuwendungen für abgeführte oder nicht eingelegte Regimenter („Handsalben“) und nicht in Anspruch genommene Musterplätze; abzüglich allerdings der monatlichen „schwarzen“ Abgabe, die jeder Regimentskommandeur unter der Hand an den Generalleutnant oder Feldmarschall abzuführen hatte; Praktiken, die die obersten Kriegsherrn durchschauten. Zudem erbte er den Nachlass eines ohne Erben und Testament verstorbenen Offiziers. Häufig stellte der Obrist das Regiment in Klientelbeziehung zu seinem Oberkommandierenden auf, der seinerseits für diese Aufstellung vom Kriegsherrn das Patent erhalten hatte. Der Obrist war der militärische ‚Unternehmer‘, die eigentlich militärischen Dienste wurden vom Major geführt. Das einträgliche Amt – auch wenn er manchmal „Gläubiger“-Obrist seines Kriegsherrn wurde – führte dazu, dass begüterte Obristen mehrere Regimenter zu errichten versuchten (so verfügte Werth zeitweise sogar über 3 Regimenter), was Maximilian I. von Bayern nur selten zuließ oder die Investition eigener Geldmittel von seiner Genehmigung abhängig machte. Im April 1634 erging die kaiserliche Verfügung, dass kein Obrist mehr als ein Regiment innehaben dürfe; ALLMAYER-BECK; LESSING, Kaiserliche Kriegsvölker, S. 72. Die Möglichkeiten des Obristenamts führten des Öfteren zu Misshelligkeiten und offenkundigen Spannungen zwischen den Obristen, ihren karrierewilligen Obristleutnanten (die z. T. für minderjährige Regimentsinhaber das Kommando führten; KELLER, Drangsale, S. 388) und den intertenierten Obristen, die auf Zeit in Wartegeld gehalten wurden und auf ein neues Kommando warteten. Zumindest im schwedischen Armeekorps war die Nobilitierung mit dem Aufstieg zum Obristen sicher. Zur finanziell bedrängten Situation mancher Obristen vgl. dagegen OMPTEDA, Die von Kronberg, S. 555. Da der Obrist auch militärischer Unternehmer war, war ein Wechsel in die besser bezahlten Dienste des Kaisers oder des Gegners relativ häufig. Der Regimentsinhaber besaß meist noch eine eigene Kompanie, so dass er Obrist und Hauptmann war. Auf der Hauptmannsstelle ließ er sich durch einen anderen Offizier vertreten. Ein Teil des Hauptmannssoldes floss in seine eigenen Taschen. Ertragreich waren auch Spekulationen mit Grundbesitz oder der Handel mit (gestohlenem) Wein (vgl. BENTELE, Protokolle, S. 195), Holz, Fleisch oder Getreide. II. Manchmal meint die Bezeichnung „Obrist“ in den Zeugnissen nicht den faktischen militärischen Rang, sondern wird als Synonym für „Befehlshaber“ verwandt. Vgl. KAPSER, Heeresorganisation, S. 101ff.; REDLICH, German military enterpriser; DAMBOER, Krise; WINKELBAUER, Österreichische Geschichte Bd. 1, S. 413ff.
[2] schwedische Armee: Trotz des Anteils an ausländischen Söldnern (ca. 85 %; nach GEYSO, Beiträge II, S. 150, Anm., soll Banérs Armee 1625 bereits aus über 90 % Nichtschweden bestanden haben) als „schwedisch-finnische Armee“ bezeichnet. Die Unterscheidung zwischen der „Royal-Armee“, die v. Gustav II. Adolf selbst geführt wurde, u. den v. den Feldmarschällen seiner Konföderierten geführten „bastanten“ Armeen erscheint angesichts der Operationen der letzteren überflüssig. Nach LUNDKVIST, Kriegsfinanzierung, S. 384, betrug der Mannschaftsbestand (nach altem Stil) im Juni 1630 38.100, Sept. 1631 22.900, Dez. 1631 83.200, Febr./März 1632 108.500, Nov. 1632 149.200 Mann; das war die größte paneuropäische Armee vor Napoleon. Schwedischstämmige stellten in dieser Armee einen nur geringen Anteil der Obristen. So waren z. B. unter den 67 Generälen und Obristen der im Juni 1637 bei Torgau liegenden Regimenter nur 12 Schweden; die anderen waren Deutsche, Finnen, Livländern, Böhmen, Schotten, Iren, Niederländern und Wallonen; GENTZSCH, Der Dreißigjährige Krieg, S. 208. Vgl. die Unterredung eines Pastors mit einem einquartierten „schwedischen“ Kapitän, Mügeln (1642); FIEDLER, Müglische Ehren- und Gedachtnis-Seule, S. 208f.: „In dem nun bald dieses bald jenes geredet wird / spricht der Capitain zu mir: Herr Pastor, wie gefället euch der Schwedische Krieg ? Ich antwortet: Der Krieg möge Schwedisch / Türkisch oder Tartarisch seyn / so köndte er mir nicht sonderlich gefallen / ich für meine Person betete und hette zu beten / Gott gieb Fried in deinem Lande. Sind aber die Schweden nicht rechte Soldaten / sagte der Capitain / treten sie den Keyser und das ganze Römische Reich nicht recht auff die Füsse ? Habt ihr sie nicht anietzo im Lande ? Für Leipzig liegen sie / das werden sie bald einbekommen / wer wird hernach Herr im Lande seyn als die Schweden ? Ich fragte darauff den Capitain / ob er ein Schwede / oder aus welchem Lande er were ? Ich bin ein Märcker / sagte der Capitain. Ich fragte den andern Reuter / der war bey Dreßden her / der dritte bey Erffurt zu Hause / etc. und war keiner unter ihnen / der Schweden die Zeit ihres Lebens mit einem Auge gesehen hette. So haben die Schweden gut kriegen / sagte ich / wenn ihr Deutschen hierzu die Köpffe und die Fäuste her leihet / und lasset sie den Namen und die Herrschafft haben. Sie sahen einander an und schwiegen stille“. Zur Fehleinschätzung der schwedischen Armee (1642): FEIL, Die Schweden in Oesterreich, S. 355, zitiert [siehe VD17 12:191579K] den Jesuiten Anton Zeiler (1642): „Copey Antwort-Schreibens / So von Herrn Pater Antoni Zeylern Jesuiten zur Newstadt in under Oesterreich / an einen Land-Herrn auß Mähren / welcher deß Schwedischen Einfalls wegen / nach Wien entwichen/ den 28 Junii An. 1642. ergangen : Darauß zu sehen: I. Wessen man sich bey diesem harten und langwürigen Krieg in Teutschland / vornemlich zutrösten habe / Insonderheit aber / und für das II. Was die rechte und gründliche Ursach seye / warumb man bißher zu keinem Frieden mehr gelangen können“. a. a. O.: „Es heisst: die Schweden bestünden bloss aus 5 bis 6000 zerrissenen Betellbuben; denen sich 12 bis 15000 deutsche Rebellen beigesellt. Da sie aus Schweden selbst jährlich höchstens 2 bis 3000 Mann ‚mit Marter und Zwang’ erhalten, so gleiche diese Hilfe einem geharnischten Manne, der auf einem Krebs reitet. Im Ganzen sei es ein zusammengerafftes, loses Gesindel, ein ‚disreputirliches kahles Volk’, welches bei gutem Erfolge Gott lobe, beim schlimmen aber um sein Erbarmen flehe“.
[3] [Bad] Salzungen [Wartburgkreis]; HHSD IX, S. 36ff.
[4] Albrecht Fürst v. Sachsen-Eisenach [27.7.1599 Altenburg-20.12.1644 Eisenach].
[5] Regiment: Größte Einheit im Heer: Für die Aufstellung eines Regiments waren allein für Werbegelder, Laufgelder, den ersten Sold und die Ausrüstung 1631 bereits ca. 135.000 fl. notwendig. Zum Teil wurden die Kosten dadurch aufgebracht, dass der Obrist Verträge mit Hauptleuten abschloss, die ihrerseits unter Androhung einer Geldstrafe eine bestimmte Anzahl von Söldnern aufbringen mussten. Die Hauptleute warben daher Fähnriche, Kornetts und Unteroffiziere an, die Söldner mitbrachten. Adlige Hauptleute oder Rittmeister brachten zudem Eigenleute von ihren Besitzungen mit. Wegen der z. T. immensen Aufstellungskosten kam es vor, dass Obristen die Teilnahme an den Kämpfen mitten in der Schlacht verweigerten, um ihr Regiment nicht aufs Spiel zu setzen. Der jährliche Unterhalt eines Fußregiments von 3000 Mann Soll-Stärke wurde mit 400- 450.000 fl., eines Reiterregiments von 1200 Mann mit 260.-300.000 fl. angesetzt. Zu den Soldaufwendungen für die bayerischen Regimenter vgl. GOETZ, Kriegskosten Bayerns, 120ff.; KAPSER, Kriegsorganisation, S. 277ff. Ein Regiment zu Fuß umfasste de facto bei den Kaiserlichen zwischen 650 und 1.100, ein Regiment zu Pferd zwischen 320 und 440, bei den Schweden ein Regiment zu Fuß zwischen 480 und 1.000 ((offiziell 1.200 Mann), zu Pferd zwischen 400 und 580 Mann, bei den Bayerischen 1 Regiment zu Fuß zwischen 1.250 und 2.350, 1 Regiment zu Roß zwischen 460 und 875 Mann. Das Regiment wurde vom Obristen aufgestellt, von dem Vorgänger übernommen und oft vom seinem Obrist-Lieutenant geführt. Über die Ist-Stärke eines Regiments lassen sich selten genaue Angaben finden. Das kurbrandenburgische Regiment Carl Joachim von Karberg [Kerberg] sollte 1638 sollte auf 600 Mann gebracht werden, es kam aber nie auf 200. Karberg wurde der Prozess gemacht, er wurde verhaftet und kassiert; OELSNITZ, Geschichte, S. 64. Als 1644 der kaiserliche Generalwachtmeister Johann Wilhelm von Hunolstein die Stärke der in Böhmen stehenden Regimenter feststellen sollte, zählte er 3.950 Mann, die Obristen hatten 6.685 Mann angegeben. REBITSCH, Gallas, S. 211; BOCKHORST, Westfälische Adlige.
[6] N v. Boy [ – ], schwedischer Major.
[7] Quartierzettel (Biletten): meist in Übereinkunft mit Stadtbeauftragten ausgestellter Einquartierungszettel, der genau festhielt, was der „Wirt“ je nach Vermögen an Unterkunft, Verpflegung (oder ersatzweise Geldleistungen) und gegebenenfalls Viehfutter zur Verfügung stellen musste, was stets Anlass zu Beschwerden gab. Ausgenommen waren in der Regel Kleriker, Apotheker, Ärzte, Gastwirte.
[8] TENNER, Salzungen, S. 142.
[9] Vgl. BINGEL, Das Theatrum Europaeum; SCHOCK; ROßBACH; BAUM, Das Theatrum Europaeum.
[10] Carl Gustav Wrangel, Graf zu Salmis u. Sölvesberg [13.12.1613 Schloss Skokloster-25.6.1676 Schloss Spyker auf Rügen], schwedischer Feldmarschall.
[11] Kolding [Vejle A, Jütland]; HHSDän, S. 99ff.
[12] Generalmajor: Der Generalmajor nahm die Aufgaben eines Generalwachtmeisters in der kaiserlichen oder bayerischen Armee war. Er stand rangmäßig bei den Schweden zwischen dem Obristen und dem General der Kavallerie, bei den Kaiserlichen zwischen dem Obristen und dem Feldmarschallleutnant.
[13] Lorenz Freiherr v. der Linde [Linden] [30.7.1610 Stockholm-25.6.1671 Stockholm], schwedischer Obrist, Feldmarschall.
[14] N Graf v. Plettenberg [ – ], schwedischer Offizier.
[15] Jöran [Jörgen, Jürgen, Jyri, Georg] Paykull [Paickel, Paijkull, Peikel, Peikul, Peykel, Patkul, Beckel, Beykel, Bickell, Pryckel, Poiquel, Putkul (Patrulius)] [2.5.1605 Reval-1.2.1657 Stockholm], schwedischer Generalmajor.
[16] Kompanie: Eine Kompanie zu Fuß (kaiserlich, bayerisch und schwedisch) umfasste von der Soll-Stärke her 100 Mann, ihre Ist-Stärke lag jedoch bei etwa 70 Mann, eine Kompanie zu Pferd bei den Bayerischen 200 Mann, den Kaiserlichen 60 Mann, den Schwedischen 80 Mann. Geführt wurde die Fußkompanie von einem Hauptmann, die berittene Kompanie von einem Rittmeister. Vgl. TROUPITZ, Kriegs-Kunst. Vgl. auch „Kornett“, „Fähnlein“, „Leibkompanie“.
[17] Rendsburg; HHSD I, S. 219ff.
[18] Hadersleben/Haderslev [Nordschleswig/Sønderjyllands A, Jütland]; HHSDän, S. 60ff.
[19] Ribe [Ribe A, Jütland]; HHSDän, S. 161ff.
[20] Salvaguardia: Ursprünglich kaiserlicher Schutzbrief, durch den der Empfänger mit seiner Familie und seiner ganzen Habe in des Kaisers und des Reichs besonderen Schutz und Schirm genommen wurde; zur öffentlichen Bekräftigung dieses Schutzes wurde dem Empfänger das Recht verliehen, den kaiserlichen Adler und die Wappen der kaiserlichen Königreiche und Fürstentümer an seinen Besitzungen anzuschlagen. Der Schutzbrief bedrohte jeden Angreifer mit Ungnade und Strafe. Im 30jährigen Krieg militärische Schutzwache; Schutzbrief (Urkunde, die, indem sie geleistete Kontributionen und Sonderzahlungen bestätigte, gegen weitere Forderungen schützen sollte, ggf. durch militärische Gewalt des Ausstellers); auch: sicheres Geleit; eine oft recht wirkungslose Schutzwache durch abgestellte Soldaten, in schriftlicher oder gedruckter Form auch Salvaguardia-Brief genannt, die meist teuer erkauft werden musste, und ein einträgliches Geschäft für die zuständigen Kommandeure darstellten. Teilweise wurden entsprechende Tafeln an Ortseingängen aufgestellt, „Salvaguardia“ an die Türen der Kirchen (HERRMANN, Aus tiefster Not, S. 55) geschrieben oder für die ausländischen Söldner ein Galgen angemalt. Die 1626 von Tilly erlassene Schultheißen-Ordnung hatte festgelegt: „Wer salua Guardia mit wortten oder that violirt, den solle niemandt zu verthädigen understehen, sonder welcher hoch oder nider Officir ein dergleichen erfahren mag, der solle den muthwilligen verbrecher sobalden zu dem Provosen schaffen, dem Schultheysen neben einandtwortung bey sich unrecht befundenen sachen und guetter hiervon berichten ohn einred, die Restitution und was bey der sachen underlauffen möcht dass Gericht entscheiden lassen, und welcher einem andern sein gewonnen beuth abnimbt oder an seinem freyen verkauff nachtheilig verhindert, den solle Schultheyss zur Restitution anhalten und noch darzu mit straffen hart belegen“. ZIEGLER, Dokumente II, S. 986. Der Abt Veit Höser (1577 – 1634) von Oberaltaich bei Straubing; SIGL, Wallensteins Rache, S. 140f.: „Da die Schweden so grausam wüteten und sich wie eine Seuche immer weiter ausbreiteten, alle Dörfer mit Taub, Mord und Jammer heimsuchten, erbaten die Bürger ab und zu von den Kapitänen der Weimaraner eine Schutzwache, die bei ihnen meist Salva Guardia heißt. Erhielten sie diesen Schutz zugesagt, so wurde jeweils ein Musketierer zu Fuß oder zu Pferd in das betreffende Dorf, die Ortschaft, den Markt abgestellt. Dieser sollte die herumstreifenden Soldatenhorden, kraft eines vom Kapitän ausgehändigten schriftlichen Mandats, im Zaume halten, ihre Willkür beim Rauben und Plündern einschränken. […] Es ist aber nicht zu bestreiten, dass eine solche Schutzwache unseren Leuten oder den Bewohnern anderer Orte, denen auf ihre Anforderung eine Salva Guardia zugestanden wurde, keinen Vorteil brachte. Im Gegenteil, sie schlugen ihnen vielmehr zum Schaden aus und waren eine Belastung. Offensichtlichen Nutzen dagegen hatten nur die Kapitäne, denn ihnen mussten die Leute gleich anfangs die ausgehandelte Geldsumme vorlegen oder wenigstens wöchentlich die entsprechende Rate (pensio) entrichten. Kurz, wie Leibeigene oder Sklaven mussten sie blechen, was die Kapitäne verlangten. Ich habe nur einen Unterschied zwischen den Orten mit und denen ohne Salva Guardia festgestellt: Die Dörfer ohne Schutzgeleit wurden früher, jene mit einer Salva Guardia erst später ausgeplündert. Da nämlich die Schweden vom Plündern nicht ablassen konnten, solange sie nicht alles geraubt hatten, so raubten und plünderten sie entweder alles auf einmal (sodaß sie nicht mehr zurückkommen mußten) oder sie ließen allmählich und langsam bei ihren Raubzügen alles mitgehen, bis nichts mehr zu holen war. Obendrein haben diese eigentlich zum Schutze abkommandierten Musketiere und Dragoner gewöhnlich die Ortschaften, ihre Bewohner und deren Habseligkeiten – als Beschützer – ausspioniert und dann verraten. Wurde nämlich der bisherige Beschützer – und Spion – unvermutet abberufen, dann brachen seine Kameraden, Raubgesellen und Gaunerbrüder ein und raubten alles, was bislang durch den Schutz der Salva guardia verschont geblieben war, was sie in Wirklichkeit aber für sich selbst hinterlistig und heimtückisch aufbewahrt hatten, und wüteten um so verwegener (pro auso suo) gegen die jämmerlich betrogenen und enttäuschten Menschen, beraubten sie nicht menschlicher und marterten sie“. Auch war das Leben als Salvaguardist nicht ungefährlich. Der Ratsherr Dr. Plummern berichtet (1633); SEMLER, Tagebücher, S. 65: „Eodem alß die von Pfullendorff avisirt, daß ein schwedischer reütter bei ihnen sich befinnde, hatt vnser rittmaister Gintfeld fünf seiner reütter dahin geschickht sollen reütter abzuholen, welliche ihne biß nach Menßlißhausen gebracht, allda in dem wald spolirt vnd hernach zu todt geschoßen, auch den bauren daselbst befohlen in den wald zu vergraben, wie beschehen. Zu gleicher zeit haben ettlich andere gintfeldische reütter zu Langen-Enßlingen zwo schwedische salvaguardien aufgehebt vnd naher Veberlingen gebracht, deren einer auß Pommern gebürtig vnd adenlichen geschlächts sein sollen, dahero weiln rittmaister Gintfeld ein gůtte ranzion zu erheben verhofft, er bei leben gelassen wird“. BLÖTHNER, Apocalyptica, S. 49f. (1629): „Eine Eingabe des Bauern Jacob Löffler aus Langenwetzendorf [LK Greiz] wegen der bei ihm einquartierten »Schutzgarde« schildert die Heldentaten der derselben ungemein plastisch: »Was ich armer Mann wegen anhero zweijähriger hiesigen Einquartierung für groß Ungemach ausstehen müssen, gebe ich in Unterthänigkeit zu vernehmen: Denn erstlichen habe berührte Zeit über 42 ganze 42 Wochen Tag und Nacht bei den Soldaten ich aufwarten, nicht allein viel Mühe und Wege haben, sondern auch welches zum Erbarmen gewesen, Schläge gewärtig zu sein und geprügelt werden zu müssen, 2. habe ich meine geringe Haushaltung wegen jetziger Unsicherheit beiseits setzen, meine Felderlein wüst, öd und unbesamt liegen lassen, daß seither ich im geringsten nichts erbauen, davon samt den Meinigen ich mich hätte alimentieren mögen, 3. haben die Soldaten mir die Gerste, so zu einem Gebräulein Bier ich eingeschüttet, aus den Bottichen genommen, zum Teil mutwilligerweise zerstreut, zum Teil mit sich hinweggenommen, verfüttert und verkauft, 4. haben sie mir das wenige Getreidig, so noch unausgedroschen vorhanden gewesen, mit dem Geströhde aus der Scheune in andere Quartiere getragen, ausgeklopft und ihres Gefallens gebraucht, 5. weil sie an meiner geringen Person sich nicht allzeit rächen können, haben sie mir die Bienen und derselben Stöcke beraubet, umgestoßen und zu Grund und Tode gerichtet, 6. sind von ihnen mir alle Hühner, Gänse und ander Federvieh erschossen, genommen und gefressen worden, meine Wiesen, Raine und Jagen mir dermaßen verödet, daß ich nicht eine einzige Bürde Heu und Grummet von denselben genießen kann, 7. endlich ist von ihnen mir eine Kuh aus dem Stalle, so meinen Geschwistern zuständig gewesen, gezogen, in ein anderes Losament getrieben, geschlachtet und gefressen worden.«
[21] Leutnant: Der Leutnant war der Stellvertreter eines Befehlshabers, insbesondere des Rittmeisters oder des Hauptmanns. Wenn auch nicht ohne Mitwissen des Hauptmannes oder Rittmeisters, hatte der Leutnant den unmittelbarsten Kontakt zur Kompanie. Er verdiente je nach Truppengattung monatlich 35-60 fl.
[22] Fähnrich (Kornett): Rangunterster der Oberoffiziere der Infanterie und Dragoner, der selbst bereits einige Knechte zum Musterplatz mitbrachte. Dem Fähnrich war die Fahne der Kompanie anvertraut, die er erst im Tod aus den Händen geben durfte. Der Fähnrich hatte die Pflicht, beim Eintreffen von Generalspersonen die Fahne fliegen zu lassen. Ihm oblagen zudem die Inspektion der Kompanie (des Fähnleins) und die Betreuung der Kranken. Der Fähnrich konnte stellvertretend für Hauptmann und Leutnant als Kommandeur der Kompanie fungieren. Bei der Kavallerie wurde er Kornett genannt. Vgl. BLAU, Die deutschen Landsknechte, S. 45f.
[23] Knecht, gemeiner: dienstgradloser einfacher Soldat. Er hatte 1630 monatlich Anspruch auf 6 fl. 40 kr. Ein Bauernknecht im bayerischen Raum wurde mit etwa 12 fl. pro Jahr (bei Arbeitskräftemangel, etwa 1645, wurden auch 18 bis 24 fl. verlangt) entlohnt. Doch schon 1625 wurde festgehalten; NEUWÖHNER, Im Zeichen des Mars, S. 92: „Ihme folgete der obrist Blanckhardt, welcher mit seinem gantzen regiment von 3000 fueßknechte sechß wochen lang still gelegen, da dann die stath demselben reichlich besolden muste, wovon aber der gemeine knecht nicht einen pfennig bekommen hatt“. In einem Bericht des Obristleutnants des Regiments Kaspar von Hohenems (25.8.1632) heißt es; SCHENNACH, Tiroler Landesverteidigung, S. 336: „daß sie knecht gleichsam gannz nackhent und ploß auf die wachten ziehen und mit dem schlechten commißbroth vorlieb nemmen müessen, und sonderlichen bey dieser kelte, so dieser orten erscheint, da mich, als ich an ainem morgen die wachten und posti visitiert, in meinem mantl und guetem klaidt gefrorn hat, geschweigen die armen knecht, so übel beklaidt, die ganze nacht auf den wachten verpleiben müessen. So haben sie auch gar kain gelt, das sie nur ain warme suppen kauffen khönnen, müessen also, wegen mangl der klaider und gelt, mit gwalt verschmachten und erkhranken, es sollte ainen harten stain erbarmen, daß die Graf hohenembsische Regiment gleich von anfang und biß dato so übel, und gleichsam die armen knecht erger alß die hundt gehalten werden. Es were gleich so guet, man käme und thete die armen knecht […] mit messern die gurgel abschneiden, alß das man sie also lenger abmatten und gleichsam minder als einen hundt achten thuett“. Gallas selbst schrieb am 25.1.1638 dem Kaiser; ELLERBACH; SCHERLEN, Der Dreißigjährige Krieg Bd. 3, S. 222: „Mochte wohl den Stein der erd erbarmen zuzuschauen, wie die arme knecht kein kleid am leib, keine schuh am fuße, die reiter keine stiefel oder sattel haben, auch den mehrerteil sich freuen, wenn sie nur die notdurft an eichelbrot bekommen können“. => Verpflegung.
[24] Major: Der Major war im Dreißigjährigen Krieg der Oberwachtmeister des Regiments (zunächst nur in der Infanterie). Er sorgte für die Ausführung der Anordnungen und Befehle des Obristen und Obristleutnants. Im Frieden leitete er die Ausbildung der Soldaten, sorgte für die Instandhaltung ihrer Waffen, hatte die Aufsicht über die Munition und war verantwortlich für die Regimentsverwaltung. Im Krieg sorgte der Major für Ordnung auf dem Marsch und im Lager, beaufsichtigte die Wach- und Patrouillendienste und stellte die Regimenter in Schlachtordnung. Zudem hatte er den Vorsitz im Kriegs- und Standgericht.
[25] Prima plana: das erste Blatt der Musterrolle, auf dem die Personen verzeichnet waren, die zum Kompaniebefehl gehörten: Hauptmann, Rittmeister, Leutnants, Fähnriche, Kornett (als Oberoffiziere der Prima plana), Feldwebel, Führer, Fourier, Musterschreiber, Feldscherer (Unteroffiziere der Prima plana). Korporäle, Gefreite, Spielleute und Fourierschützen galten dagegen als gemeine Befehlshaber.
[26] Kapitänleutnant: Der Kapitänleutnant war der Stellvertreter des Kapitäns. Der Rang entsprach dem Hauptmann der kaiserlichen Armee. Hauptmann war der vom Obristen eingesetzte Oberbefehlshaber eines Fähnleins der Infanterie. (Nach der Umbenennung des Fähnleins in Kompanie wurde er als Kapitän bezeichnet.) Der Hauptmann war verantwortlich für Werbung und Soldzahlung, für Disziplin, Ausrüstung und Verpflegung sowie für die Ernennung der untergebenen Führer. Oft war er in erster Linie für die materielle Versorgung der Truppe zuständig und die eigentlichen militärischen Aufgaben wurden von seinem Stellvertreter, dem Kapitänleutnant übernommen. Der Hauptmann marschierte an der Spitze des Fähnleins, im Zug abwechselnd an der Spitze bzw. am Ende. Bei Eilmärschen hatte er zusammen mit einem Leutnant am Ende zu marschieren, um die Soldaten nachzutreiben und auch Desertionen zu verhindern. Er kontrollierte auch die Feldscher und die Feldapotheke. Er besaß Rechenschafts- und Meldepflicht gegenüber dem Obristen, dem Obristleutnant und dem Major. Dem Hauptmann der Infanterie entsprach der Rittmeister der Kavallerie. Junge Adlige traten oft als Hauptleute in die Armee ein.
[27] Obristleutnant: Der Obristleutnant war der Stellvertreter des Obristen, der dessen Kompetenzen auch bei dessen häufiger, von den Kriegsherrn immer wieder kritisierten Abwesenheit – bedingt durch Minderjährigkeit, Krankheit, Badekuren, persönliche Geschäfte, Wallfahrten oder Aufenthalt in der nächsten Stadt, vor allem bei Ausbruch von Lagerseuchen – besaß. Meist trat der Obristleutnant als militärischer Subunternehmer auf, der dem Obristen Soldaten und die dazu gehörigen Offiziere zur Verfügung stellte. Verlangt waren in der Regel, dass er die nötige Autorität, aber auch Härte gegenüber den Regimentsoffizieren und Soldaten bewies und für die Verteilung des Soldes sorgte, falls dieser eintraf. Auch die Ergänzung des Regiments und die Anwerbung von Fachleuten oblagen ihm. Zu den weiteren Aufgaben gehörten Exerzieren, Bekleidungsbeschaffung, Garnisons- und Logieraufsicht, Überwachung der Marschordnung, Verproviantierung etc. Der Profos hatte die Aufgabe, hereingebrachte Lebensmittel dem Obristleutnant zu bringen, der die Preise für die Marketender festlegte. Um all diese Aufgaben bewältigen zu können, waren umfangreiche Kenntnisse und Erfahrungen notwendig. Nicht selten lag die eigentliche Führung des Regiments in der Verantwortung eines fähigen Obristleutnants, der im Monat je nach Truppengattung zwischen 120 und 150 fl. bezog. Voraussetzung war allerdings in der bayerischen Armee die richtige Religionszugehörigkeit. Maximilian hatte Tilly den Ersatz der unkatholischen Offiziere befohlen; Bayerisches Hauptstaatsarchiv München Dreißigjähriger Krieg Akten 236, fol. 39′ (Ausfertigung): Maximilian I. an Tilly, München, 1629 XI 04: … „wann man dergleich officiren nit in allen fällen, wie es die unuorsehen notdurfft erfordert, gebrauchen khan und darff: alß werdet ihr euch angelegen sein lassen, wie die uncatholischen officiri, sowol undere diesem alß anderen regimentern nach unnd nach sovil muglich abgeschoben unnd ihre stellen mit catholischen qualificirten subiectis ersezt werden konnde“. Von Piccolomini stammt angeblich der Ausspruch (1642): „Ein teutscher tauge für mehrers nicht alß die Oberstleutnantstell“. HÖBELT, „Wallsteinisch spielen“, S. 285.
[28] James Lundi [Lundy, Lundidh, Lindy] [ – ], schwedischer Obristleutnant.
[29] THEATRUM EUROPAEUM 5. Bd., S. 382f.
Veröffentlicht unter Miniaturen
Verschlagwortet mit P
Kommentare deaktiviert für Plettenberg, N Graf von
Nassau-[Katzenelnbogen]Dillenburg, Ludwig Heinrich Graf von
Nassau-[Katzenelnbogen]Dillenburg, Ludwig Heinrich Graf von; Generalwachtmeister [9.5.1594 Saarbrücken-12.7.1662 Dillenburg]
 Ludwig Heinrich, der Nachfolger des Grafen Georg, verheiratet seit 1615 mit Katharina Gräfin von Sayn-Wittgenstein, trat in schwedische Dienste und war ab 1.12.1631 Obrist der Kavallerie. Nach dem Prager Frieden (1635) stand er ab 3.8.1635 als Obrist und Generalwachtmeister in kaiserlichen Diensten und führte das Regiment Alt-Nassau. Durch seinen Übertritt verlor er seine Forderungen an Schweden in Höhe von 454.000 Rt. für zwei geworbene Regimenter.[1] Im Dezember 1637 trat er in hessen-darmstädtische Kriegsdienste.
Ludwig Heinrich, der Nachfolger des Grafen Georg, verheiratet seit 1615 mit Katharina Gräfin von Sayn-Wittgenstein, trat in schwedische Dienste und war ab 1.12.1631 Obrist der Kavallerie. Nach dem Prager Frieden (1635) stand er ab 3.8.1635 als Obrist und Generalwachtmeister in kaiserlichen Diensten und führte das Regiment Alt-Nassau. Durch seinen Übertritt verlor er seine Forderungen an Schweden in Höhe von 454.000 Rt. für zwei geworbene Regimenter.[1] Im Dezember 1637 trat er in hessen-darmstädtische Kriegsdienste.
„Eine Feuersbrunst legte in der Nacht zum 8. November [1623; BW] mehr als die halbe Stadt Haiger[2] in Schutt und Asche. Das Brandinferno war durch unvorsichtiges Hantieren mit den Leuchtern im Quartier des Rittmeisters ausgebrochen. Rittmeister von Lülsdorf [Luilsdorf; BW] sollte am nächsten Tag mit seiner hier einquartierten Kompanie vom Regiment Don Lorentzo del Mestro [Maestro; BW] die Stadt verlassen. Durch den starken Nachtwind konnte sich das Feuer schnell zu einem Großfeuer ausbreiten, so daß in nur drei Stunden 70 Gebäude, darunter 40 Wohnhäuser, ein Stadttor nebst Stadtturm und alles Hab und Gut eingeäschert wurden und Teile der Stadtmauer einstürzten. 250 Einwohner waren hiervon betroffen, wobei der Tod eines Kindes zu beklagen war. Graf Ludwig Heinrich, Sohn und Nachfolger von Graf Georg, taxierte den Schaden auf 50.000 Gulden. An anderer Stelle wird die Höhe des Schadensregulierung mit 500.000 Gulden angegeben“.[3]
„Im Februar [1624; BW] nahm General-Major von Lindeloh [Timon v. Lintelo, BW] mit seinem Stab in Herborn[4] Quartier. Im Dillenburgischen lagen außerdem 248 Mann mit 226 Pferden. Das Kirchspiel Renterode (Rennerod[5]) und Rotzenhain (Rodenhain[6]) mußte 180 Soldaten beherbergen. Die 315 Mann zählende Leibkompanie des Obristen von Ryvenheim [Nievenheim; BW] lagerte im Diezischen.[7] Von hier wird berichtet, daß bei den Soldaten sehr viel liederliches Gesindel an Frauen und Jungens aufhielten. In Ebersbach (Ewersbach[8]) brannten in der Nacht vom 2. auf den 3. März einige Häuser durch Brandstiftung auf. Die Not im Nassauischen wurde immer größer, da auch das Saatgut für die Bestellung der Felder fehlte. Obwohl man im Frühjahr Graf Tilly[9] diese Notlage der Nassauischen Lande unterbreitete und um Befreiung von Einquartierung ersuchte, wurden die Grafen Johann Ludwig von Nassau-Hadamar und Ludwig Heinrich von Nassau-Dillenburg zur Geduld verwiesen.
Die Durchmärsche und Einquartierungen wollten [1625; BW] kein Ende nehmen. Am 15. Januar marschierte eine Kompanie des Lindelohischen Regiments durch Herborn[10] und Dillenburg.[11] Am 16. Januar zogen 1.500 sächsische Kavalleristen [Julius Heinrich v. Sachsen-Lauenburg; BW] mit 6 Kompanien Infanterie durch Camberg[12] und das Hadamarische[13] auf Koblenz[14] zu. Alle diese Truppendurchmärsche brachten ansteckende Krankheiten mit, die auf die Bewohner übergriffen. So meldete Camberg den Tod vieler seiner Einwohner. Auch in Haiger und Umgebung brach im Februar abermals die Pest aus. Nachdem Graf Tilly im Mai genötigt wurde, seine Truppen abzuziehen, sollte sich in den Nassauer Landen die Ruhe nicht einstellen, denn andere Regimenter zogen in das Dillenburgische, Diezische und Hadamarische ein. Auch diese Einquartierten verfuhren mit den Untertanen auf übelste Art und Weise“.[15]
„Ende März [1626; BW] reiste Graf Ludwig Heinrich in Begleitung des verhandlungserfahrenen Heinrich von Rabenscheid von Dillenburg aus zum Herzog von Friedland. Durch diesen Bittgang wollte man eine Erleichterung für die Nassauischen Lande erreichen. Leider sollten sich die abgegebenen Zusicherungen des Herzogs hinsichtlich der Befreiung von Einquartierung nicht bewahrheiten. Der Haigerer Schultheiß Heinrich von Rabenscheid, der sich so erfolgreich als Vermittler bewährte, wurde auf der Rückreise von Sontra[16] von mit Stangen, Hacken und Gabeln bewaffneten Bauern auf das fürchterlichste mißhandelt. Graf Ludwig Heinrich war eine Stunde vorher aus Sontra abgereist und somit dem Überfall entgangen.
In Herborn wurde die ‚Sächsische Wacht‘ (Quartier der Sachsen-Lauenburger Soldaten) von betrunkenen Bauern angegriffen. Während diese allerdings auf das Übelste zugerichtet wurden, kam der Wirt Konrad Bott fast zu Tode“.[17]
Im Mai 1626 berichtete Graf Ludwig Heinrich Melchior von Hatzfeldt von der Schlacht an der Dessauer[18] Elb-Brücke zwischen dem Söldnerführer Ernst von Mansfeld[19] und den siegreichen Kaiserlichen unter Wallenstein.[20]
„Obwohl es zu keinen direkten Kampfhandlungen kam, zogen immer neue Regimenter durch den Westerwald,[21] erschlugen in den Dörfern 18 Bauern und stahlen Vieh, Kleidung und Hausgeräte. In Herborn entstand am 20. August [1626; BW] durch die Fahrlässigkeit eines Obristen ein Brand, der das Rathaus mit allen hier gelagerten Dokumenten und Gerichtsbüchern vernichtete. Die Begräbniskirche sowie die ganze Hinter- und Neugasse, insgesamt 214 Gebäude, waren die traurige Bilanz dieses Großbrandes. Der Obrist Eichstätt [Hans Ernst Vitzthum v. Eckstätt; BW] kam hierauf im Driedorfer[22] Schloß zu liegen“.[23]
„Obrist Leon Cropello (Capello) de Medicis von der Tillyschen Armee rückte am 15. Januar [1628; BW] ganz unvermutet mit 3 Kompanien Kavallerie in Herborn ein und verlangte, Quartier in dem Nassauischen zu nehmen. Graf Ludwig Heinrich eilte persönlich nach Herborn und versuchte durch allerlei Versprechungen und der Entrichtung von 1 000 Reichsthalern, die Einquartierung zu verhindern. Der Obrist verlangte aber von den Westerwälder Grafen insgesamt 31.100 Reichsthaler an Kontribution. Alle Gemeinden machten Graf Ludwig Heinrich daraufhin auf ihre Notlage aufmerksam. Dillenburg war durch die im Vorjahr hier grassierenden Krankheiten, die vielen Bürgern das Leben kosteten, besonders von Armut betroffen. Nachdem diese drei Kompanien aus Nassau-Dillenburg dem Hadamarischen und Diezischen 20.128 Reichsthaler an Unkosten verursacht hatten, marschierten sie in das Bergische weiter“.[24]
„Als Residenzstadt blieb Dillenburg [1629; BW] die Einquartierung vom Regiment des Markgrafen Hans Georg von Brandenburg Anfang Januar erspart. Im Mai sollte sich dies ändern. Die Grafen von Diez, Hadamar und Dillenburg mußten nunmehr 350 nebst dem Stab unterhalten. Des weiteren belastete die Grafschaft der Durchmarsch von Wallonen und Kroaten.
Graf Johann Ludwig trat im August, in Wien angekommen, zur katholischen Religion über und versprach, dieselbige auch im Hadamarischen einzuführen. Kaiser Ferdinand[25] ernannte ihn daraufhin zu seinem Kämmerer. Die Grafschaft Hadamar befreite der Kaiser fortan von allen Kriegslasten. Diese Ruhe endete, als Graf Ludwig Heinrich in die Kriegsdienste des Schwedenkönigs Gustav Adolf eintrat.
Am 13. August plünderten 15 Reiter und 50 Musketiere den herrschaftlichen Hof in Sinn.[26] Sie führten 600 Schafe, 50 Schweine, 13 Pferde und 160 Stück Rindvieh vom Hofgut. Ein Untertan wurde erschossen und mehrere Bürger verletzt. Unter den Verletzten war auch Heimberger Söllen. Graf Ludwig Heinrich überbrachte die diesbezüglichen Beschwerden durch Johann Ludwig dem Kaiser in Wien. Hierzu zählten auch die fahrlässig verursachten Brände 1623 in Haiger und 1626 in Herborn. Auf Veranlassung Kaiser Ferdinands wurde die Zurückgabe des abgenommenen Viehs angeordnet. Nachdem im Dezember sieben Kompanien des Witzlebischen [Julius v. Witzleben; BW] Regiments aus dem Nassau-Dillenburgischen und Diezischen abgezogen waren, besetzten die Truppen des Grafen Anholt diese Grafschaften.
Der grauenhafte Krieg tobte nun schon im 12. Jahr, und die protestantischen Grafschaften befanden sich in höchster Bedrängnis. Das Elend war in diesem Jahr [1630; BW] in Deutschland allgemein groß. Viele Menschen starben den Hungertod. Es wurde Brot aus Eicheln, Hanfkörnern und Wurzeln gebacken, um den Hunger zu stillen. In Dillenburg und Umgebung grassierten im Februar erneut ansteckende böse Krankheiten. Hinzu kam, daß der Kaiserliche Kommissar Brumer noch im Februar Graf Ludwig Heinrich die Kontributionsabgabe um die Hälfte erhöhte. Nachdem aber Graf Ludwig Heinrich, noch am 18. April in Frankfurt[27] angekommen, um Nachlaß der Abgaben beim Kaiserlichen Kommissar bat, verzichtete dieser auf die Erhöhung und beließ es bei der monatlichen Kontribution von 3.500 fl. (Florin Gulden)“.[28]
In der Grafschaft Nassau(-Dillenburg) müssen 97 % der Bevölkerung als arm bzw. sehr arm eingestuft werden.[29] Sechs Morgen Land grenzten die Mittelschicht von der Oberschicht ab; unter sechs Morgen Land konnte man vom Ertrag seiner Ländereien nicht existieren.[30] Dass musste sowohl die Einwohner als auch Soldaten bei Einquartierungen vor kaum lösbare Probleme in der Versorgung mit Subsistenzmitteln stellen und latente Aufruhrstimmung erzeugen.
„Seit Ende des vorigen Jahres hatten sich einige hundert Soldaten von Graf Pappenheims[31] Regiment in Dillenburg und Herborn einquartiert. Ein schwedischer Kapitän, der in Herborn gebürtig war und den man den jungen Messerschmidt nannte, vertrieb [1631; BW] mit 70 Mann das Pappenheimische Regiment, das noch in seiner Geburtsstadt lagerte. Im gleichen Jahr beendete Kaiser Ferdinand die Graf Johann Ludwig zugebilligte Kriegslastenbefreiung für das Hadamarische. Die schwedischen Einfälle in Hadamar formierten sich aus Religionshaß Tag für Tag mehr. In Dillenburg und Umgebung grassierte auch in diesem Jahr die Pest.
Graf Ludwig Heinrich versicherte Graf Johann Ludwig, daß er zur Sicherheit seiner eigenen Familie und der seines Landes und letztlich zur Aufrechterhaltung der protestantischen Religion im Dezember als Obrist in schwedische Dienste getreten sei. König Gustav Adolf übertrug Graf Ludwig Heinrich das Kommando über ein Regiment Infanterie von 8 Kompanien zu je 150 Mann, die er anzuwerben hatte. Von dem Regiment sollten 2 Kompanien auf Schloß Dillenburg zur Sicherheit des Westerwaldes stationiert werden“.[32]
„Am 4. Januar [1632; BW] fielen die Soldaten vom Regiment des Grafen Ludwig Heinrich in Höhn[33] auf dem Westerwald ein, holten dort den katholischen Pastor aus seinem Haus und plünderten dieses gänzlich aus. Das gleiche Schicksal widerfuhr fast zur gleichen Zeit dessen Amtsbruder in Oberfischbach[34] im Amt Freudenberg.[35] Auch hier ließen die Eindringlinge alles Verwertbare mitgehen. Im gleichen Monat stürmten Chur-Trierische Bauern das dortige Haus Molsberg.[36] Sie ermordeten sämtliche hier kampierenden schwedischen Offiziere. Unter den Toten befand sich auch Graf Otto Wilhelm von Solms-Lich“.[37]
„Im Zuge der militärischen Ereignisse des Jahres 1632 standen im oberen Sauerland in schwedischen Diensten stehende Truppen unter den Obristen [Kurt v.; BW] Dalwigk und Mercier, die zunächst von Medebach[38] aus operierten, den Kaiserlichen unter dem Hauptmann Hans Wulf von Wrede [zu Reigern; BW] gegenüber. Im Dienste der Schweden stand auch Graf Ernst von Sayn-Wittgenstein, der – einem Warnschreiben Wredes an die Schmallenberger[39] vom 17. April 1632 zufolge – sein Kriegsvolk aufgeboten hatte, um zum Grafen [Ludwig Heinrich; BW] von [Nassau-; BW] Dillenburg und dann gemeinsam mit diesem auf Olpe,[40] Attendorn[41] und Schmallenberg zu ziehen. In diesem Zusammenhang wandten sich die Schmallenberger und Nachricht und Hilfe an die verwitwete Gräfin Maria Johanna zu Sayn-Wittgenstein, die am 20. April 1632 antwortete, daß ihr nichts dergleichen bekannt sei. Sie wolle Nachricht geben, wenn etwas gegen Schmallenberg und Kloster Grafschaft[42] vorgehe und dieses nach Möglichkeit abwenden. Gut vierzehn Tage später antwortete der ebenfalls persönlich angeschriebene Graf Ernst der Stadt.
Der Königlichen Maiestät zu Schweden bestelter Obrist Lieutenant, des löblichen gräflich Sölmischen regiments zu roß, Ernst Grave zu Seyn und Wittgenstein, Herr zu Homburg[43] etc.
Unsern gunstigen grus und geneigtten willen zuvor, ersame und vorsichtige, besonders liebe benachbarte.
Ab ewrem schreiben, wie auch dem abgeordnetten richter Ebert Quincken, unsern freigraven der freigraveschafft Zuschen,[44] haben wir mitt mehrerm verstandten, daß ir bittet, wir wolten euch wegen des besorgendten einfals der Heßischen soldatesca ainige salvaguartiam ertheilen. Nun seindt wir solches, umb etwes gegen uns und unsere underthane wolverhaltens willen, bevorab, weil unser hoffmeister Caspar von Dorlar (der ohnedaß in ihrer Koniglichen Maiestät zu Schweden dienst und protection mitt allem dem seinigen ist) sein haus und gutter daselbsten hatt, zu thun nicht ungeneigtt. Weil aber wir under genannter armee nichtt, sondern allein under der Schwedischen commando haben, so konnen wir anders nichtt alß mitt vorschreiben und intercediren, wenn wir zeittig advisiret [= unterrichtet], euch zu hulff kommen. Darzu wir uns nicht allein willig erkleren, sondern wollen auch alßdann, wans die nott erfordertt, jemandts von den unserigen, damitt ir zum wenigsten fur der plunderung gesichertt seytt, der endts incontinenti [= sofort] abferttigen und soviel mensch- und muglich abwehren helffen laßen.
Sollte aber wieder zuversichtt der einfall so plotzlich, ehe wirs berichtett wurden, vorgehen, so hette der richter vorgenannt, welcher in unsern diensten, dieß schreiben den furstlich Heßischen kriegsbedienten mitt vermeldung unsers respective dienst und grußes vorzuzeigen und vor gewaltthatsamkeitt zu bitten, umb die contribution aber auf träg- und thunlichkeitt zu handlen, wie wir uns zu ihnen, daß sie euch dießes unsers vorbittens wurcklich genießen laßen werden, versehen thun. So wir hinwieder gegen einen jeden nach standts gebur zu verdienen erbiettig. Und wir habens euch, denen wir mitt allem gutten wol beygethan, zur wiederanttwortt mitt entpfehlung gottlicher allmacht nichtt verhalten wollen. Datum Berleburg,[45] den 2ten Mai anno 1632“.[46]
„Das von Graf Ludwig Heinrich in diesem Jahr aufgestellte 1.200 Mann starke Regiment bewährte sich u. a. erfolgreich bei der Vertreibung der Spanier am 21. Juni aus der Stadt Koblenz“.[47]
Der nassau-dillenburgische „Schultheiß Teichmann vermeldete, daß die Armut unter den Untertanen so groß sei, daß in seinem ganzen Amt Tringenstein[48] nicht einmal 30 Personen Brot hätten. Am 16. Oktober [1632; BW] rückte General von Baudißin mit 11 Regimentern Kavallerie und 10.000 Mann in das Amt Herborn und die benachbarten Dörfer ein. Nach nur einem Nachtquartier marschierte die ganze schwedische Armee dann auf Hadamar zu. Die zum katholischen Glauben übergetretenen Menschen wurden gequält und beraubt. Fast kein Dorf entging den Plünderungen, und viele Einwohner verloren ihr Leben. Zu Oberrod[49] im Kirchspiel Elsoff[50] wurde eine alte Frau lebendig verbrannt. Die Schweden entführten aus dem Hadamarischen über 500 Pferde und mehrere tausend Stück Rindvieh. Das übrige Vieh schlugen sie tot und verwüsteten vor ihrem Abzug die Gehöfte.
Der Landesherr von Nassau-Hadamar, Graf Johann Ludwig und seine Untertanen mußten für den beibehaltenen katholischen Glauben bitter bezahlen“.[51]
Vom 15.8.1633 datiert der in Siegen[52] abgeschlossene Vertrag zwischen dem Landdrosten Friedrich von Fürstenberg als Bevollmächtigtem des Herzogtums Westfalen und den Bevollmächtigten der Grafschaften Wittgenstein, Nassau und anderen, um die Übergriffe der streifenden Rotten in den Territorien untereinander einzustellen.
„Es wurde nicht nur zwischen beiden großen Lagern Krieg geführt, sondern in grenznahen Bereichen auch zwischen den Untertanen. Diese nutzten insbesondere in den Territorien mit ausgeprägten Konfessionsgrenzen, wie diese zwischen dem Herzogtum Westfalen und den Wittgensteinschen Grafschaften sowie der Grafschaft Nassau-Siegen bestanden, die militärischen Aktionen der großen Parteien zu privaten Raubzügen. Damit nicht zwischen den Colnischen und Nassawischen Underthanen selber in diesen landen vor diesen mit raub, plündereien, fangen, rantzoniren und anderen placcareyen, vielen thatlichkeiten und feintseeligkeiten verubt worden, dadurch die arme leuth undt underthanen beiderseits in großen und alsolchen armuth und verbitterungh gerathen … trafen sich am 14. August 1633 der Westfälische Landdrost und der Rittmeister Johann Conrad von Selbach gen. Lohe zur Lohe[53] als Beauftragter des Hans Georg von und zu Holdinghausen, trierischer Amtmann zu Freusberg,[54] und bereiteten die nachfolgende Punktation vor […].
Nachdem zur vorkohmmung des hochschadtlichen landsverderben in vorschlag komen, wie ohne praejuditz des hauptwercks iezigen zustandts und kriegswesen im reich zwischen den Colnischen landen Westfälischen theils soviel und herren Colnischen westphalischen landtdrösten anbefohlenen ampt begriffen, wie solches von dem herrn Colnischen landtdrosten und anwesenden assistenten vorgeschlagen worden und den graffschaften Nassaw, Catzenelenbogen, Sayn, Witgenstein, der graffschaft Wiedt undt den gantzen Westerwalt bis an Rhein undt Lahnstromb eine particularvergleich uffzurichten.
1. So wirt erstlich unvorgriflich und unverbindlich uff ratification der Königlichen Majestet und cron Schweden reichscantzlers als directorn des evangelischen bunts, daß von plunderung, brantschatzung die lender beiderseitz der streiffenden hin und wider lauffenden eintzelen partheyen befreyet werden mogen.
2. Das die underthanen, so sich etwan zutragen mochten, daß commandirte partheyen durchziehen oder aber auch generalmarche oder durchzug ein oder anderseitz armeen sich begeben, solten von allen feintlich insolention verschonet pleiben und die durchziehende armeen oder commandirte partheyen sich mit nothwendig verpflegung contentiren und abfinden laßen möge.
3. Das männiglich, wes stants dieselbe sein, geistlich und weltlich, adell undt unadell, es ihren heuseren, ackerbaw und viehzucht sich[er] sein, nicht gefangen, noch rantioniren oder andere wege betrangt werden moegen.
4. Das auch hierunder die beampten, dero weib undt kinder, ingleichen auch der kriegsofficirer, so in diensten sein erachtet, weiber und kinder, so sich ein oder anderseits aufhalten, verstanden werden moegen.
5. Undt damit zwischen den landen und underthanen der effect und zweck beßer erlangt werden moege, so wirt den herren Colnischen ad referendum gegeben, daß die guarnison zu Andernach[55] und in der Eintracht zu Lintz[56] und anderswho diesseits Rhein zu streiffen nicht zugelassen werden moege, dan sonsten auf den Westerwalt extraordinariguarnison nothwendig verpleiben werden, welches die vergleichung undt vorhaben leichtlich hindern wurde.
6. Da nun bei beiderseits hoechsten heupteren zu erlangen, daß keine fernere extraordinariguarnisonen oder -einquartirung eingelegt, so wehre zu hoffen, wan die in vorschlag kommene vergleich getroffen, consentirt werden mochte, daß solche bestendig auch moechte gehandhabt werden.
7. Und weill nun diesen particularvergleich der hochloblichen cron Schwedens und gemeinen evangelischen confoederirten in dem hauptwerck nicht praejudizirt werden kan, man sonste zu abbruch des feints etwas vorgenohmen werden solte oder müßte.
8. So wirt solches vorbehalten und vorgeschlagen, daß die underthanen beiderseits alleinig zu ihrer notturfft nachbarliche commercia in denen gegeneinander gesetzten landen gebrauchen.
9. Nicht aber, daß under solchen schein oder andererseits underthanen sich die commercien in zufuhr, zu vorschub und understerckung des feints armee nachtheilig gebrauchen sollen.
10. Außerdem aber frei und sicher nach erlangter ratification der vergleich zu ihrer nottdurfft wie obgedacht, wandelen und handelen mogen.
11. Undt das, was unverbindlich vorgeschlagen wirt, bis dahin die hohe beiderseits heupter uff underthenigste und underthenige relation sich erkleret, die handlung ratificirt oder auch ufgehoben, die underthanen von den eintzelen partheyen nicht molestiret, auch die verbrechen angesehen bestrafft und zur restitution angehalten werden mogen.
Undt nachdem von Nassaw-, Saynisch- und Witgensteinischen deputirten diese media, soweit das itziger zustand und gelegenheit erleidet, vorgeschlagen worden, alß ersuchen demnach hiemit von der Königlichen Majestet undt crohn Schwedens reichscantzlern und directorn des evangelischen bunts, herrn abgesandten und commissarien, herrn Johan Albrecht Tyllium, die puncta ad referendum zu nehmen und dem gewunschten werck nach aller moglichkeit zu befordern. Gestalt herren Colnischen landtdrosten diese puncten gegen empfang ihrerseits unvorgrifflichen vorschlag auch zugestellet worden. So geschehen Siegen, 15. August 1633“.[57]
„Die Grafschaft Hadamar mußte weiterhin Tribut an den Schwedengeneral von Baudißin entrichten. Die Frühjahrsbestellung der Felder konnte nicht erfolgen, da den Einheimischen die Pferde weggenommen worden waren. Im Oktober [1633; BW] wurde auf der Dillenburg ein schwedisches Magazin angelegt. Nassau-Dillenburg, Siegen, Hadamar, Diez, Nassau-Weilburg, Solms, Greifenstein, Braunfels, Hohensolms, Solms und Wittgenstein, Westerburg, Wied, Runckel und Beilstein mußten hier den Zehnten in das Schloß liefern“.[58]
Diepholtt war 1633/34 nassau-dillenburgischer Rittmeister. Von ihm stammt der Bericht über ein verlorenes Treffen gegen Bönninghausen vor Brilon[59] an Otto Heinrich von Calenberg, hessen-kasselischer Obrist zu Paderborn,[60] Rüthen,[61] 1633 XII 27 (a. St.): „Klagend bericht ich hiermit, daß als unser regiment vor Brilen kommen, der feindt alda gewesen. Demnach aber unser herr obristleutenant berichtet worden, daß Paul Daube [ligistischer Freikorpsführer; BW] mit 6 compagnien alda gewesen und eine compagnie dragoner, haben wir allesampt die resolution gefasset, sie anzugreifen. Weil dan wohlgemelter unser obristleutenandt mehrer vorsichtigkeit halber erstlich einen ridtmeister mit namen Koelen hingeschickt mit 60 pferden, alda quartir zu machen, gleichfals auch den leutnant vom hern major mit einem vortrab commendirt, welche underschiedtliche chargen mit den feindt getan, endtlichen einen quartirmeister vom feinde neben einen reutern gefangen gebracht, der berichtet mit seiner warheit, weil er niederzumachen bedreuet worden, daß des feindts ganze macht als 60 compagnien pferde da weren, worauf wir uns gewandt. Und ehe solches kaum geschehen können, ist der feindt mit dreien gar starcken trouppen, welchen andere alsobaldt folgten, auf uns gangen, als das wir uns reteriren müssen, und obwohl wie [wir ?; BW] uns einmal in den waldt gewendet, so hat jedoch solches nicht helfen können und ist in solchen wenden unser her o(brist)leut(enandt) [Seelbach; BW] entweder plieben oder gefangen, mein cornet ist plieben, gleichfals mein quartirmeister und viele reuter von mir, und enden allen comp(agnie) hiermit befehl etc. Zu e(uer) wohled(dlen) g(naden) dienstgef(elliger) Hieron(ymus) Diepholtt ridtmeister. Die pagage ist all weg“.[62]
„Graf Ludwig Heinrichs Infanterie-Regiment verlor in diesem Monat [Mai 1634; BW] bei der Belagerung von Rheinfelden[63] 300 Mann an Toten und Deserteuren“.[64]
„Cardinal Infant von Spanien, ein Bruder von König Philipp IV., kam mit seinem 12.000 Mann starken Korps in den Westerwald und belegte dort Quartier. Sechs Meilen im Umkreis von Hadamar blieb kein Dorf von Plünderungen verschont. Die Schlösser Westerburg[65] und Weilburg[66] wurden gleichfalls ausgeplündert. Graf [Emmerich v.; BW] Metternich gab für seine Soldaten die Stadt Herborn, in der im Mai die Metzgerzunft ihren Anfang genommen hatte, preis. Kein Haus blieb ungeschoren und die Bürgersweiber mit ihren Kindern wurden auf das Grausamste tyrannisiert. Nach der Bezahlung von 200 Reichsthalern zog der Graf seine Truppen aus der Stadt ab. [Philipp v.; BW] Mansfeldische Truppen nahmen am 24. November [1634; BW] die Festung Braunfels[67] ein.
Nachdem eine Braunfelser Garnison in das zur Grafschaft Dillenburg zählende Dorf Bicken[68] eingefallen war, einen Bauern erschossen hatte und 27 Pferde von dort entführte, erfolgte umgehend der Vergeltungsschlag. Mitte Januar [1635; BW] zog Ludwig Heinrich mit einem Infanteriekommando von 300 Mann und 120 Reitern gegen Braunfels. Er kam dort am 18. Januar morgens um 4 Uhr an. Mit Sturmleitern wurden die Stadtmauern erstiegen, die Schloßtore angezündet und das Schloß im Sturm genommen. Der Graf, der bei seiner kämpfenden Truppe war, sprang als zweiter Mann von der Mauer in den Schloßhof herunter. Während er bei diesem Vergeltungsschlag nur einen Mann verloren hatte, mußten 29 Garnisonssoldaten ihr junges Leben lassen.
Die Eroberung von Braunfels durch das Heer des Grafen Ludwig Heinrich erzürnte Graf Philipp von Mansfeld, der daraufhin drohte, daß im Nassauischen fortan kein Schweinestall mehr stehen bleiben sollte und alle Gebäude verbrannt werden würden. Ludwig Heinrich reagierte auf diese kaiserliche Drohung, indem er ihn wissen ließ, daß er dann im Gegenzug in katholischen Landen die Dörfer anzünden würde. Trotz dieser angedrohten Gegenmaßnahmen wurde am 7. Mai die halbe Stadt Driedorf ein Raub der Flammen, und man mußte hier an Graf Mansfeld noch 400 Reichsthaler zusätzlich zahlen. Hinzu kamen nochmals 200 Reichsthaler, die der dortige Pastor für seine eigene Freilassung entrichten mußte. Drei Tage hatte der Geistliche, nachdem ihn Rittmeister Edelmans in einem schloßnahen Gewölbe gefangen genommen hatte, um sein Leben gebangt. […] Zur gleichen Zeit rückte eine 10.000 Mann starke Truppe auf die Stadt Herborn zu. Verschiedene Kommandos hatten den Befehl, Herborn, Seelbach,[69] Bicken, Offenbach[70] und Burbach[71] abzubrennen. In Bicken gingen 53, in Herbornseelbach[72] 89, in Offenbach 60 und in Burbach 18 Häuser in Flammen auf. Andere Einheiten wüteten in Ebersbach.[73] Nachdem Ludwig Heinrichs Infanterie seine in Herborn lagernde Einheit nach Dillenburg zurückgezogen hatte, war Herborn der Plünderung preisgegeben.
Am nächsten Tag marschierte Graf Mansfeld über Niederscheid[74] und Hof Feldbach mit seinem Korps gegen Dillenburg. Es kam hier zu heftigen Gefechten im Bereich des Hofgartens. Die Schloßgeschütze und Doppelbacken[75] eröffneten das Feuer auf die kaiserlichen Truppen eröffneten das Feuer auf die kaiserlichen Truppen. Der Hof Feldbach wurde in Brand geschossen. Während Graf Ludwig Heinrich ein halbes Regiment auf dem Schloß zurückließ, gelang ihm mit vier Kompanien der Rückzug von dem Schloßwall. Graf Mansfelds Soldaten begannen mit der Stadtplünderung. Schultheiß Hatzfeld, der wegen seines hohen Alters nicht fliehen konnte, wurde verschleppt, später aber wieder ausgelöst. Der jüngere Bürgermeister Konrad Sengel, die Witwe des ehemaligen Pfarrers zu Ballersbach, Wendelini Gudelli […] und der Hofgärtner Reuß verloren nebst 180 Menschen bei diesem Raubzug ihr Leben.
Am 5. Mai marschierte Graf Mansfeld mit seinem ganzen Korps auf Herborn zurück und verließ von da aus am nächsten Tage das Nassauische. Der Schaden, den das Mansfeldische Korps im Dillenburgische anrichtete, war beträchtlich. In den Dörfern des Amtes Dillenburg sind weitere 17 Menschen totgeschlagen und vier verwundet worden. 1.010 Stück Rindvieh, 30 Schweine, 54 Schafe und 94 Pferde trieben die Truppen weg.
Das Amt Herborn meldete 32 totgeschlagene und 60 verwundete Menschen. Fortgetrieben wurden hier 1.128 Stück Rindvieh, 1.514 Schafe und 221 Pferde. Im Amt Haiger wurden 12 Menschen getötet und 26 Personen verwundet. 639 Rinder, 100 Schafe und 84 Pferde hat man hier davongetrieben. Eine Person kam im Amt Tringenstein zu Tode, und neben 2 Verwundeten verlor man hier 16 Kühe und 36 Pferde. Die Ebersbacher meldeten den Verlust von 38 Stück Rindvieh und 4 Pferden. 5 totgeschlagene und 4 verwundete Bürger meldete das Amt Driedorf. Außerdem beklagten die Westerwälder den Verlust von 997 Stück Rindvieh, 234 Schweinen, 18 Ziegen und 255 Pferden.
Im Amt Burbach ergab die Verlustliste 4 Todesfälle und 4 Verwundete, 471 Stück Rindvieh und 52 Pferde. Insgesamt soll der Schaden über 100.000 Reichsthaler betragen haben. Der Truppenrückzug durch das Hadamarische und Diezische kostete neben einigen Toten 36.386 Reichsthaler. Graf Johann Ludwig hatte auf seinen eigenen Gehöften alles Vieh verloren. Überall mußten die Leute hungern, und die Pestilenz, die von den kaiserlichen Truppen eingeschleust wurde, fand neue Nahrung. Das Dillenburgische Kirchspiel hatte abermals 209 Tote zu beklagen.
Am 20. Juli reiste Graf Johann Ludwig zu Graf Mansfeld nach Mainz[76] und teilte ihm das ausgebrochene Elend in seinem Lande mit. Sein Bitten um Hilfeleistungen wurde erhört, und Graf Johann Ludwig brachte eine Aussöhnung zwischen Graf Ludwig Heinrich und dem Kaiserlichen Hof durch Graf Mansfeld und dem General Hatzfeld zustande“.[77]
Poiler aus Hilchenbach[78] war wegen zahlreicher Überfälle, Diebstähle und Gewalttaten im Amt Bilstein[79] und angrenzenden Orten Ende April 1635 gefasst worden. „Poiler gibt in der Vernehmung zu, daß er zuvor in kaiserlichen Diensten gewesen sei. Er sei aber nicht – wie ihm vorgeworfen wird – ohne Paßzettel von der Truppe weggegangen, sondern habe diesen in Arnsberg[80] erhalten. Er habe sich seiner Kompanie nicht wieder anschließen können, da diese vor Hameln[81] geschlagen worden sei. Erhalten. Zu einigen Delikten bekennt sich Poiler, andere – insbesondere Mordtaten – leugnet er und beschuldigt zugleich seine Kumpane. So soll die Erschießung des Hermann Gutbier 1634 in Kirchhundem[82] durch Johann von der Heiden erfolgt sein. Die Entführung und Mißhandlung des Jost Kin aus (Ober-)Veischede[83] gehe auf Johann von [.]etphe, Contzen Sohn, und Johan Tier zurück. Bedeutsam erscheint, daß der Graf zu Nassau-Dillenburg den gefangenen Übeltäter gegen ‚rantzonen‘ (Lösegeld) frei bekommen möchte“.[84]
Bei dem Überfall auf Haus Valbert[85] bei Oedingen[86] durch Ludwig Heinrich von Nassau-Dillenburg am 16.6.1635 wurde dessen Besitzer, der kaiserliche Obrist Timan Dietrich von Lintelo, getötet. In den Aufzeichnungen aus dem Gemeindearchiv Kirchhundem heißt es: „Anno 1635 die 16. Junii ist der fiendt in die 300 sta[rk] ungefer under dem commando grafflicher gnadt von Dillenburgh offs hauß Falbert gefallen, selbes gantz ausgeplundert und den herren obristen de Linthlo Thima[n] Theodorum todt geschossen“.[87]
Nach dem Frieden von Prag trat Ludwig Heinrich in kaiserliche Dienste und wurde am 3.8.1635 zum kaiserlichen Obristen ernannt.[88] Viele seiner Soldaten sollen wegen des Seitenwechsels desertiert sein.
Im August 1635 weilte Ludwig Heinrich wieder in Dillenburg und gratulierte Melchior von Hatzfeldt zur Ernennung zum Generalfeldzeugmeister. Im Oktober berichtete er ihm vom Abzug der Garnison von Schloss Braunfels[89] und der Eroberung von Montabaur,[90] im November teilte er ihm den Tod des Grafen Konrad Ludwig von Solms-Braunfels mit.[91]
„Während in Hadamar noch täglich bis zu 9 Personen an der Pest verstarben, flauten in Dillenburg die Erkrankungen ab. Bis Mitte des Jahres mußten nur noch 25 Stadtbewohner zu Grabe getragen werden, unter ihnen befanden sich 10 Pestopfer. Truppenbewegungen mit Raub und Plünderungen, Brandschatzungen und Morden wurden aus dem Siegerland gemeldet. Graf Ludwig Heinrich trat am 17. Dezember als Generalmajor in den Hessisch-Darmstädtischen Kriegsdienst mit der Erlaubnis, auch jederzeit, sofern es erforderlich werde, zu Hause für Ordnung sorgen zu können. Diesmal waren es die Schweden, die Graf Ludwig Heinrich zu fürchten hatte, da die Schwedenarmee die kaiserlichen Truppen aus dem Hessenland zurücktreiben konnten.
Durch den Rückzug befürchtete auch Graf Johann Ludwig, aus Sicherheit nicht länger mit seiner Familie in Hadamar bleiben zu können.
Ängste und Sorgen überfielen die Nassau-Dillenburgischen Untertanen [1637; BW], als die Order des Landgrafen Georg von Hessen-Darmstadt eintraf. Graf Heinrich Ludwig sollte mit seinen Soldaten nach Sachsen marschieren und sich dort mit dem kaiserlichen Heer unter Feldmarschall Graf Götz vereinigen. Überrascht und erbost zugleich mußte Graf Ludwig Heinrich bei seiner Ankunft wahrnehmen, daß man sein im Dienst der kaiserlichen Armee stehendes Infanterieregiment aufgelöst und die Soldaten dem Infanterieregiment Lesli [Walter Leslie; BW] zugeteilt hatte. Der Graf erhielt nach heftigen, dem Kaiser in Schriftform übergebenen Beschwerden sein Regiment, allerdings um eine Kompanie reduziert, zurück. Unterdessen verstarb Kaiser Ferdinand am 15. Februar, und sein Sohn Ferdinand III.[92] bestieg den kaiserlichen Thron. Am 22. Mai traf Graf Ludwig Heinrich mit seinem Sohn, dem Grafen Georg Ludwig, der ihn ständig begleitet hatte, wieder in Dillenburg ein, reiste aber nach seiner Ankunft sogleich zum Kaiser nach Prag weiter. […] Die Durchmärsche der kaiserlichen und ligistischen[93] Völker vermehrten sich so stark, daß es im ganzen Dillenburger Land erneut zu einer Hungersnot kam“.[94] Der Rudolstädter[95] Landrichter Michael Heubel [1605 – 1684][96] schreibt in seinen „Anmerkungen“ zu 1637: „Den 5. Februar [15.2.1637; BW] sind die keyserlichen Croaten[97] von Saalfeldt[98] herein, Blankenburg[99] und Illmen[100] vorbey zue Wüllersleben,[101] Bösleben[102] und Marlshausen[103] das Quartier genommen, des andern Tages fort auf Mühlhausen[104] mit guter Ordre marchiret, und hat der Hofjunker, der von Boseck, dieselbe von Schwartze {Schwarzburg)[105] aus bis Wüllersleben geführet. Den 16. März [26.3.1637; BW] ist der Graf von Nassau mit einer Compagnie Rudolstadt,[106] Rembda[107] und Dienstedt[108] vorbey, das Nachtquartier zue Witzleben[109] genommen und sich in die Erffurther[110] Dörfer logirt“.[111]
„In der Nacht zum 13. März [1638; BW] überstieg ein Kommando des Grafen Ludwig Heinrich die Stadtmauer in Weilburg und plünderte die dortigen Häuser aus. Dieser Racheakt geschah aus Vergeltung, da ein dortiger Leutnant sich der Kaiserlichen Order widersetzt hatte“.[112]
Am 16.3.1638 schrieb Ferdinand III. aus Pressburg[113] an Ludwig Heinrich: Die Kaiserlichen hätten Hanau[114] besetzt, der schwedische Kommandant Ramsay habe die Stadt übergeben. Ein Teil der Armee müsse an den Rhein geführt werden. Ludwig Heinrich möge der Armee behilflich sein und ihm gelegentlich Nachricht gaben.[115] Im Juni 1638 stand die erneute Übernahme Ludwig Heinrichs in den kaiserlichen Kriegsdienst an, im Juli informierte er Melchior von Hatzfeldt über seine Schwierigkeiten bei der Ausrüstung des Regiments. Die ehemaligen hessen-darmstädtischen Truppen unter Urias Martin und Vinthus wurden in kaiserliche Dienste übernommen.[116] „Am 5. Oktober starb auf dem Dillenburger Schloß Graf Ludwig Philipp von Wied. Er wurde am 29. desselben Monats nachmittags um 1 Uhr in der Stadtkirche begraben. Die Nassauischen Lande hatten den ganzen Sommer hindurch sowohl von den kaiserlichen, ligistischen und sachsen-weimarischen Truppen vieles erleiden müssen. Erste Friedensallianzen bahnten sich an. Im November trafen sich die Abgesandten in Köln, Leipzig,[117] Nürnberg[118] und Worms.[119] Zu dem Kreistag in Worms wurde Graf Ludwig Heinrich von Kaiser Ferdinand III.[120] als Kommissarius beauftragt. Gemeinsam mit dem Rat [Philipp Henrich; BW] Hoen von Dillenburg reiste er am 9. November dorthin ab“.[121] In diesem November berichtete Ludwig Heinrich Hatzfeldt von der Niederlage seines Regiments bei Bielefeld.[122]
„Von dem Nassauischen Regimente haben wir noch nachzutragen, dass sich dasselbe nach der Belagerung von Wismar[123] im Juni 1638 zu Oldendorf,[124] umweit Hamburg[125] an der Elbe befand. Es war in dem Grade zusammengeschmolzen, daß Oberstlieutenant von Klenow [Kleinau; BW] erklärte, das ganze Regiment werde abgedankt werden müssen, wenn es nicht bald mit den nöthigen Neugeworbenen versehen würde. Graf Ludwig Heinrich [v. Nassau-Dillenburg] ließ zwar alle im Nassauischen sich heimlich aufhaltenden Ausreißer aufsuchen und an das Regiment abliefern; er hatte aber die nöthigen Gelder nicht, welche zu einer vollständigen Ausrüstung erforderlich waren. Einstweilen glaubte der demselben schon dadurch aufzuhelfen, daß ihm bessere Quartiere angewiesen würden. Auf sein Ansuchen wurde daher das Regiment dem Westphälischen Heere unter dem Grafen Hatzfeld zugetheilt. Dies hatte auch den besten Erfolg und die Compagnien konnten bald wieder vollzählig gemacht werden. Nachdem sich aber das Regiment einigermaßen gekräftigt hatte, mußte es abermals einen starken Verlust erleiden.
Graf Hatzfeld beorderte nämlich den Oberstlieutenant von Klenow, mit dem Regimente Nassau zu der Brigade des Generalmajors [Bernhard Hackfort Freiherr v.; BW] Westerholz zu stoßen, welche nach Bielefeld[126] marschirte. Die Schweden standen damals in Lemgow.[127] Obristlieutenant von Klenow bildete die Vorhut der Brigade und stieß bei Bielefeld auf ein starkes Corps Schweden. Klenow griff die Schweden an und brachte sie zum Weichen, das Regiment Nassau erlitt aber dabei einen sehr starken Verlust. Der Major, welcher sich zu weit vorgewagt hatte, wurde mit achtzig Mann gefangen und Oberstlieutenant von Klenow, welcher im Treffen schwere Wunden erhielt, starb den andern Tag zu Bielefeld und wurde daselbst mit allen militärischen Ehren begraben.
Das Regiment kehrte bald darauf ins Vaterland zurück, wurde durch drei Hessen-Darmstädtische Compagnien wieder vollzählig gemacht und unter Befehl des Hessischen Oberstlieutenant von Urias Martin gestellt“.[128]
„Ludwig Heinrich [v. Nassau-Dillenburg; BW] trat nun am Sonntag, Abends 10 Uhr, mit seiner kleinen Mannschaft unbekümmert, ob er den Obersten [Heinrich; BW] von Metternich bei Bergen[129] antreffen werde oder nicht, bei anhaltendem Regen seinen Marsch an und kam den 22. Februar [1638; BW], Morgens sechs Uhr, als eben die Reveille[130] geschlagen wurde, in einem Walde vor Hanau an, also zwei Stunden später, als verabredet war. Dieser Verzug rührte aber davon lediglich her, weil die Soldaten bei der sehr dunklen Nacht und dem eingefallenen Regenwetter nicht geschwind fortkommen konnten. Unterdessen beschloß der Graf, damit der Anschlag nicht verrathen und die Ausführung unmöglich gemacht würde, mit dieser kleinen Macht sogleich den Angriff zu thun. Major Winter von Güldenbronn hatte zwei Tage vorher die Schlüssel, welche die Thore und Brücken aus der Altstadt und die Mühlenschanze bei dem rothen Hause schließen, in Wachs abgedrückt, in einem Hasen versteckt, zugeschickt erhalten und diese in Frankfurt[131] nachmachen lassen. Die Heranziehenden waren aber bereits in der Stadt bemerkt worden. Da es nun die Zeit nicht mehr erlaubte, Nachen herbeizuschaffen und Brücken zu schlagen, so mußte Winter, der mit 60 Mann vorausgeschickt wurde, unter Führung eines Bauern, der sich als Spion gebrauchen ließ, durch die Kinzig waden. Dieser Fluß war aber durch das Thauwetter sehr angelaufen und es wurden einige Mann fortgerissen, welche umkamen, aber Major Winter drang sogleich durch Mühlenschanze in die Altstadt ein. Diesem folgte Graf Ludwig Heinrich auf dem Fuße nach und indem sogleich die Wache überrumpelt wurde, bemächtigte er sich der ganzen Altstadt und des Schlosses. Die Gräfliche Familie wurde nun alsbald in Freiheit gesetzt. Nachdem dies glücklich ausgeführt worden, erwartete Graf Ludwig Heinrich den Obersten von Metternich und den Oberstlieutenant von Bettendorf, Commandanten von Königstein, welche in der Nacht sich verirrt hetten und wegen einer abgebrochenen Brücke nicht früher, als gegen Mittag, zu ihm stoßen konnten.
Ramsay, welcher sich eines solchen Überfalls nicht vorgesehen hatte, zog seine Leute in der Neustadt zusammen, nachdem er die Thore hatte verschließen lassen; auch bot er alles auf, sich in dem Besitz der Neustadt zu erhalten. Am 20. (23.) des Morgens ließ der Graf Ludwig Heinrich die Neustadt mit den mitgebrachten zwei Kanonen beschießen und als er im Begriffe stand, dieselbe zu bestürmen, wurde Ramsay vor seiner Wohnung, dem weißen Löwen, durch eine Musquetenkugel von hintenher, unter dem Rückgrad, nach der Hüfte zu, stark verwundet. Nun fand sich Ramsey genöthigt, mit seinen dreihundert Soldaten sich zu ergeben; er schickte daher einen Tambour an den Grafen ab, ‚mit dem Begehren, ihm und seinen Soldaten Quartier zu geben, da er übel geschossen worden’, jedoch wie er dem Hauptmann Helmerich, der zuerst zu ihm kam, ausdrücklich sagte, unter der Bedingung, daß der abgeschlossene Vertrag aufrecht gehalten würde.
Die ganze Schaar, mit der Graf Ludwig Heinrich diesen Überfall ausgeführt hatte, überstieg nicht 600 Mann.
So waren denn die Grafen Philipp Moritz von Hanau und Wilhelm Otto von Solms-Laubach nach einer langwierigen Gefangenschaft in Freiheit gesetzt und Ramsay, dieser tapfere, aber dabei stolze Soldat, einer der Schönsten in Gustav Adolphs Heer, wurde auf die Hauptwache gebracht, um da verbunden und dann einer langen Gefangenschaft unterworfen zu werden. Hier wurde er strenge bewacht, zwei Schildwachen standen in seinem Zimmer und nur Arzt, Chirurg und Prediger durften zu ihm kommen. Bald erschienen auch Graf Ludwig Heinrich, Oberst Metternich und andere Officiere an seinem Bette, um dem tapferen Schweden ihre Hochachtung zu bezeugen und den Niedergebeugten aufzurichten. Ob nun von Graf Ludwig Heinrich, Oberst Metternich und andere Officiere an seinem Bette, um dem tapferen Schweden ihre Hochachtung zu bezeugen und den Niedergebeugten aufzurichten. Ob nun von Graf Ludwig Heinrich dem Schwerverwundeten, an dessen Aufkommen man allgemein zweifelte, gewisse Versprechungen wegen Aufrechterhaltung des früher abgeschlossenen Akkords gemacht wurden, an die man sich später ungern erinnerte, geht zwar aus dem Vorliegenden nicht ganz klar hervor, aber als Ramsay später darauf zurückverwies, hatte man wenigstens darüber kein Wort der Entschuldigung oder des Widerspruchs“.[132]
Die Einquartierung kaiserlicher Regimenter auf dem Westerwald und in den Grafschaften Nassau-Dillenburg und Sayn-Wittgenstein, der Anmarsch der Truppen Piccolominis und deren Verpflegungsschwierigkeiten waren im Februar 1639 Thema der Korrespondenz mit Hatzfeldt; im März 1639 berichtete er ihm von der Einquartierung in der Grafschaft Homburg[133] und von dem kaiserlichen Überfall auf Villmar.[134]
„General Wilhelm Ramsay, Graf von Dalwaste, drohte [1639; BW] das Dillenburger Schloß zu zerstören, da man dort seinen Vetter, den schwedischen Generalmajor [Jacob; BW] Ramsay,[135] gefangen hielt. Die Drohungen, daß er mit dem Schloß so verfahren wolle, daß kein einziger Stein mehr auf dem anderen sitzen solle, blieben unbeachtet. Alle Bittgesuche des Gefangenen, hierzu zählt auch das Zahlungsangebot von 70.000 Reichsthalern, die von Ramsay dem Grafen für seine Freilassung übergeben wollte, blieben erfolglos. ‚Den 21sten April entschloß sich Ramsey ein Testament zu machen. Nach demselben sollten von den Interessen[136] seines nachlassenden Vermögens fünf arme Schüler studieren. Wann sein Sohn David ohne Erben sterben würde, so sollte sein ganzes Vermögen auf seinen Vetter Wilhelm Ramsay, Graf von Dalwaste und dessen männliche Erben fallen. Die fünf Hundert paar Schu, welche er in Elbingen[137] für sein Regiment erhalten, sollten zugleich bezahlt werden. Sein ganzes Vermögen sollte seine Frau Isabella Speris zum Besten seines Sohns wohl anwenden, und solchen in der Gottesfurcht erziehen lassen. Sie sollte nur sevhs Wochen nach seinem Tod trauern, und sie sollte sich bald nachhero an einen Cavalier von einer alten guten Familie verheyrathen, und alsdann sollte sein Vermögen in drey Theile getheilt werden werden, einen Theil sollte seine Frau, einen Theil sein Sohn, und einen Theil seiner Frau neuer Ehemann haben. Dieses Testament wurde unterschrieben von Sebstian Wetzlarius (Wetzflarius), Heinricus Pithanius und M. Casparus Stippius, Prediger in der Grafschaft Dillenburg‘.
Am 28. Juni, nachdem Freiherr Jacob von Ramsay einen Besuch vom Schloßkommandanten Kapitän Helmerich und Fähnrich König erhalten hatte, ließ sich dieser durch seinen ständigen Bediensteten Georg Racamus auf den Nachtstuhl bringen. Er fiel kurz daraufhin in Ohnmacht und verstarb etwa 50jährig in den Armen seines treuen Dieners. Graf Ludwig Heinrich ließ umgehendst im Beisein von Ärzten und Feldscherer den Leichnam des einst so gefürchteten Haudegens öffnen und seine Eingeweide entnehmen, die dann auf dem Dillenburger Friedhof begraben wurden. Seiner in St. Andre[138] in Schottland wohnenden Gemahlin wurde dessen Tod bekannt gemacht. Ihr wurde freigestellt, ob sie nach der Bezahlung seiner hinterlassenen Schulden den einbalsamierten Körper überführt haben wollte oder seine letzte Ruhestätte in Dillenburg wünschte. Sie antwortete dem Grafen aber, daß sie ihres Mannes Tod bis in ihr Grab beklagen werde. Er hätte sein eigenes Vermögen im Dienste der Krone Schwedens fast gänzlich eingebracht. Ihres Mannes Gelder könne sie so leicht nicht eintreiben. Aus diesem Grunde könnte sie weder seine Schulden noch dessen Begräbniskosten bezahlen. Sie erhoffte sich aber, daß die Krone Schwedens die Verdienste des Verstorbenen anerkennen werde und ihr die noch zu zahlenden Gelder ausbezahlt würden. Erst nachdem man ihr die noch offenen Geldforderungen übergeben habe, könne sie sich wegen des Begräbnisses entscheiden. Da sich dieser Entschluß 11 Jahre dahinzog, wurde der einbalsamierte Körper des Generalmajors am 18. August 1650 im adeligen Chor der Dillenburger Stadtkirche begraben. Ob es der Witwe gelungen ist, die angeblich großen Vermögenswerte ihres so berühmten Gemahls von der Krone einzuklagen, ist nicht belegt.
Dem Nassauischen Lande wurden erneut ständige Drangsale aufgebürdet. Am 11. Oktober kam ein starkes Kommando Schweden nach Dillenburg und ließ dort 200 Rinder, Kühe und Ochsen mitgehen“.[139]
Im Januar 1640 meldete Ludwig Heinrich Melchior von Hatzfeldt das Übersetzen sachsen-weimarischer Truppen bei Kaub[140] und deren Weitermarsch nach Wetter[141] und Marburg.[142] „In Nassau lag seit Dezember [1639; BW] des vorigen Jahres der Obrist von Metternich [[Emmerich Freiherr v. Metternich-Winneburg-Beilstein; BW]. Als die Weimarische Armee hier anrückte, ließ er kurzerhand die Lahnbrücke zerstören, um die Eindringlinge vorerst abhalten zu können. Die Orte Frickhofen[143] und Dehm[144] wurden durch unvorsichtig hantierende Soldaten ein Raub der Flammen. Feuer brach auch in Ellar[145] und Steinbach[146] aus. Die ganze Weimarische Armee zog in diesem Jahr [1640; BW] durch das Nassauische und Dillenburgische und trieb das Vieh fort. Graf Ludwig Heinrich unterbreitete Kaiser Ferdinand III. die traurige Lage, in welcher er sich mit seinen Untertanen befand. Er sah sich nun ohne dessen Hilfe, obwohl er doch für den Kaiser stets sein Bestes gegeben hatte, allein gelassen.
Eibelshausen[147] wurde von dem Müllerschen Regiment ausgeraubt. Am 25. März erschütterte in Herborn ein starkes Erdbeben die Häuser und das Schloß. Die Schweden hatten die kaiserliche Armee gänzlich von der Nassau-Dillenburgischen abgeschnitten, dies bedeutete für Graf Ludwig Heinrich und seine Untertanen erneut größte Gefahr“.[148]
Schwedische Truppen standen im August 1640 bei Frankenberg,[149] Wetter und im Amt Blankenstein.[150] Der Überfall des Obristen Vollmar von Rosen bei Frankfurt[151] beschäftigte ihn im Dezember dieses Jahres.[152]
„Durch die Unterhaltung der Kaiserlich-Dillenburger Schloßgarnison [1641; BW] sei sein Land völlig erschöpft, ließ Graf Ludwig Heinrich Kaiser Ferdinand III. Wissen, der ihm daraufhin abermalig die Befreiung von allen Einquartierungen und Kriegslasten zusicherte“.[153]
Die Exekutionen des Obristleutnant Frangipani, Kommandanten von Friedberg,[154] zur Eintreibung der Kontribution waren Thema seiner Korrespondenz mit Hatzfeldt im Februar 1641. Auch Generalkriegskommissar von der Düssen und dessen Methoden waren Anlass zu Beschwerden im Juni dieses Jahres. Im August meldete er Hatzfeldt die Verzögerung des Abzugs der sachsen-weimarischen Besatzung von Braunfels.[155] „Der auf Schloß Dillenburg geborene Graf Wilhelm Otto von Nassau-Siegen starb am 14. August [1641; BW] im Gefecht bei Wolfenbüttel durch eine Gewehrkugel im Alter von 34 Jahren“.[156] Im November unterrichtete Graf Ludwig Heinrich von Nassau-Dillenburg Melchior von Hatzfeldt von der Beerdigung Wilhelm Ottos.[157]
Im November verteidigte er sich bei Ferdinand von Köln[158] und Melchior von Hatzfeldt gegen Verleumdungen seiner Person, berichtete über den Herborner Grafentag und die sachsen-weimarische Besatzung in Braunfels.[159]
Er bat Melchior von Hatzfeldt im Januar 1642, ihm sein Regiment zu lassen. Die Verpflegung des Regiments Beeck aus der Herrschaft Homburg sowie die Kontributionserhebung aus der Grafschaft Nassau-Diez waren Themen des Monats Februar. Im August 1642 beschwerte sich Otto zur Lippe-Brake bei Ludwig Heinrich über unrechtmäßige Kontributionserhebungen durch den umstrittenen Kriegskommissar von der Düssen.[160] Otto zur Lippe-Brake beklagte sich auch über Catherina zur Lippe-Detmold [Waldeck; BW] und den Kommandanten von Lemgo[161] bei ihm.[162]
„Obwohl Graf Ludwig Heinrich im April [1643; BW] dem Kaiserlichen Hof durch seinen Rath Schöler nochmals die strategisch wichtige Festung Dillenburg als Schlüssel zu dem Kurfürstentum Köln und den angrenzenden Ländern der Wetterau unter Beweis stellte, blieb es auch diesmal nur bei nicht erfüllten Versprechungen. Graf Johann Ludwig, der sich wegen der anstehenden Friedensverhandlungen als kaiserlicher Gesandter längere Teit in Köln aufgehalten hatte, reiste im Juli von hier aus direkt nach Münster,[163] wo er als einer der ersten Verhandlungsteilnehmer ankam. In der Zeit, als die Friedensabordnungen verschiedener ausländischer Staaten in München eintrafen, standen die Nassauischen Reiter in Schlesien, wo sie bei mehreren Gefechten große Verluste erlitten“.[164]
„Glücklich war die Nassauische Bevölkerung über den Abzug des schwedischen Generals von Königsmarck, der im Januar [1644; BW], mit seinem Korps nach Sachsen weiterzog. Auch im Siegener Land verarmte die Bevölkerung. Der hier einst blühende Eisenhandel lag schon seit Jahren still. Seit März mußte die Grafschaft monatlich 400 Reichsthaler an den Kaiserlichen Generalkommissar Hilger abführen, der das Geld nach Hamm weiterleitete. Graf Christian von Nassau-Siegen, der im 28. Jahr im Kampf sein Leben ließ, wurde am 4. Juni in der Stadtkirche Dillenburg im obersten Chor auf der rechten Hand beigesetzt. Später wurde dann sein Leichnam nach Siegen überführt.
Die Regimenter Graf Ludwig Heinrichs von Nassau-Dillenburg und Graf Moritz Heinrichs von Nassau-Hadamar hatten unter starken Verlusten den Feldzug größtenteils bei der Kaiserlichen Armee in Böhmen und Schlesien mitgemacht“.[165]
„Über die Lahn kamen [1645; BW] ständig Französisch-Weimarische Kommandos und raubten hier das Vieh. An den in Weilburg liegenden französisch-weimarischen Obristenleutnant Heilmann mußte die Grafschaft Dillenburg ausliefern: 700 Achtel Hafer, 70 Achtel Roggen, 50 Rinder, 130 Ohm[166] Bier, 6 Achtel Salz, 180 Pfund Lichter und 10 fette Schweine und für den Rittmeister noch zusätzlich 2 Rinder, 2 Kälber, 10 Pfund Butter, 10 Pfund Speck, 6 Dutzend Eier, 2 Achtel Weizen nebst 12 Hühnern und 30 Reichsthalern an Geld. Der Major in Weilheim erhielt monatlich die gleiche Lieferung nebst 11 Wagen Heu. Hadamar mußte wöchentlich 550 Achtel Hafer, 70 Achtel Roggen, 44 Rinder, 100 Ohm Bier, 5 Achtel Salz, 50 Pfund Lichter, 4 fette Schweine und 12 Wagen Heu über 2 Monate hindurch an den Obristen liefern“.[167]
Am 11.5.1645 teilte Erzherzog Leopold Wilhelm Gallas mit, dass das Regiment Alt-Nassau in den Raum Schüttenhofen,[168] Krumau[169] und Budweis[170] zu legen sei.[171] Im Oktober dieses Jahres bat Ludwig Heinrich Hatzfeldt um Ergänzung seines Regiments.[172]
Im Februar 1646 teilte er Hatzfeldt die Besetzung von Hammerstein[173] – das bis 1654 in lothringischem Besitz bleiben sollte – durch Truppen Karls IV. von Lothringen[174] mit, im Juni die Plünderungen schwedischer Truppen in der Grafschaft Nassau-Dillenburg.[175] „Diesmal waren es die Schweden, deren Proviantmeister für die in Marburg und Wetzlar lagernden Kommandos in der Grafschaft Dillenburg Proviant aufkaufte. Es verging kein Tag, an dem nicht starke schwedische Patrouillen und Kommandos in die Dillenburger Orte eindrangen und die Bürger belästigten.
Dem sich in Herborn sicher fühlenden Schwedischen Kommando erging es sehr übel. Kaiserliche Truppen hatten von Seelbach aus kommend die Schweden überfallen und unter hohen Verlusten aus der Stadt vertrieben. Daraufhin überfielen starke Kommandos der Schweden Dillenburgs Grafschaft. Herborn wurde verschont, da die Bewohner die bei dem Überfall blessierten 60 Schweden fürsorglich gepflegt und betreut hatten“.[176]
„Durch ihren Rückzug ermöglichten die Kaiserlichen Truppen, daß die Schweden wieder ungestört in den Nassauischen Landen hausen konnten. Im März [1647; BW] wurden von einigen Schwedischen Partien die Dörfer Oberscheid,[177] Niederscheld,[178] Nanzenbach[179] und Gusternhain[180] ausgeplündert und das Vieh den Bauern abgenommen“.[181]
Der Chronist und Bürgermeister Georg Leopold[182] aus dem von Eger[183] abhängigen Marktredwitz[184] erinnert sich an den Februar bzw. März 1647: „Weil am 18. Februar das kaiserliche Hauptquartier samt der ganzen Armada aufgebrochen ist, um sich gegen Böheim(b) zu wenden, sind die hier eingeflohenen Leute den 25., 26. und 27. dito wieder nach Hause gezogen. Es hat aber nit lange dauern wollen, indem uns im jüngst gesetzten Datum ein edler Rat der Stadt Eger in der Nacht durch einen eigenen Boten andeuten ließ, daß der kaiserliche Generalwachtmeister Graf Lacron [Jan van der Croon; BW] mit den nassauischen [Ludwig Heinrich v. Nassau-Dillenburg, BW] und königseckischen [Ernst Graf Königsegg, BW] Regimentern zu Roß im Egerkreis angelangt [wäre]. Sie würden samt der Garnirischen [Garnier; BW] Eskadron, die bisher im Egerland gelegen habe, ihren nächsten Weg nach Franken nehmen, um daselbst ihre Winterquartiere zu beziehen.
Wir sollten daher die hierum(b)gelegenen Dorfschaften durch Boten warnen und zum Zeichen, daß Kriegsvolk vorhanden sei, unsere Doppelhacken auf dem Kirchturm losbrennen lassen. Daraufhin ist dann alles Volk wieder hereingeflohen. […]
Um 1 Uhr [am 28.2.; BW] nachmittags kamen die Quartiermeister von diesen Völkern vor das Tor. Sie hatten Order von H[errn] Oberst Paradeiser aus Eger, daß es die kaiserlichen Dienste jetzt nit anders leiden wollten und er unumgänglich wider seinen Willen befehlen müsse, daß wir dem kaiserlichen Generalwachtmeister, Ihro Gräfl. Gnaden von Lacron, ferner H[errn] Generalwachtmeister Günther, dazu Graf Deuring [Maximilian v. Töerring; BW] als auch H[errn] Oberstleutnant Cappell vom königseckischen Regiment das Nachtquartier hier im Markt, ihren Völkern aber das Quartier außerhalb – in den Vorstädten – geben sollten. Als wir das bewilligt [hatten] und ans Austeilen der Quartiere gingen, wollten die Quartiermeister damit keineswegs zufrieden sein, sondern begehrten auch für die vollen Regimenter – samt Troß und Bagage – die Quartiere im Ort, was wir gänzlich abgeschlagen haben. Wir erklärten uns [aber] bereit, dem H[errn] Grafen entgegenzugehen, um deswegen mit ihm zu reden. Sie wollten aber darauf nit antworten und einwilligen, sondern begehrten, wir sollten die Bilette ausgeben, Quartier machen oder sie wollten es selbst(en) tun, wie sie es ja bereits begonnen hatten. Wir haben darwider protestiert und ihnen (auch) die schwere Verantwortung freigestellt. Als sie aber [mit dem Quartiermachen] fortfuhren, bin ich [zusammen] mit H[errn] Richter, dem Grafen entgegen[ge]gangen, in der Hoffnung, solches [doch noch] abzuwenden. Als wir auf den Anger hinauskamen, sind [dort] die Völker alle in Bataglia gestanden, die Generalspersonen aber waren noch hinterstellig und in Eger beim Trunk geblieben. Dahero konnten wir nichts anderes richten, als daß sie uns für gefangene Leute annahmen und uns solange nit frei lassen wollten, bis wir ihnen vorher die Quartierung bewilligten. Wir (be)warfen uns auf die Order und sagten, daß wir nit darwider handeln dürften. Wir baten sie auch, sie sollten sich gedulden, bis der Graf herbeikäme. Es war aber alles vergebens, denn unser Kapitänleutnant [Uchatz v. Abschütz; BW] hatte neben den Quartiermeistern zu viel Offiziere(r) und Reiter hereingelassen, die nit wieder hinauszubringen [waren]. Als sie daher die Quartiere nach ihrem (eigenen) Belieben gemacht hatten und damit fertig waren, machten sie die Tor[e] und Schranken auf und zogen alle – außer 2 Kompagnien, die zu(m) Dörflas[185] lagen – mit Heerpauken und Trompetenschall ein.
Als sie in die Häuser gekommen waren, fingen sie alsobald(en) nach ihrem Gefallen zu hausen an, schatzten die Bürger um Geld und plagten sie deswegen sehr. Geld sollten und mußten sie ihnen schaffen, das übrige, das sie sonst(en) in den Häusern fänden, wäre ohnedies von Rechts wegen ihnen. So machten diese Leut(e), die wir auf Befehl und Order als Freund(e) in den Markt und in die Vorstädt(e) [her]einnehmen sollten, unseren Leuten großen Jammer und [großes] Herzeleid. Um 9 Uhr nachts kamen die Generalspersonen. Wir brachten viel[e] Klagen vor. Es wurde auch alsobald(en) versprochen, alles abzuschaffen, was aber doch nur ein Spiegelfechten war.
Es wurde mit großer Gewalt vorgegangen. Unsere Leute wurden die ganze Nacht über um(b) Geld und allerhand Sachen [angegangen] und hart geängstigt. Und obwohl wir am nötigsten der Hilfe bedurften, haben wir [dennoch] den Grafen Lacron, der das Kommando hatte, im Schlaf nit anschreien und beunruhigen dürfen.
Früh morgens – am 1. Martii also – hat der Graf auf unser Anschreien hin zwar den Aufbruch befördert und zu Pferd blasen lassen, doch sind bei diesem Lärm(en) noch viel[e] gute Leute in ihren Häusern spoliert, ausgezogen und sehr übel tractiert worden. Man hat ihnen auch auf ihre Wagen und Pferd[e] Fleisch, Kälber, Hühner, Butter(n) und Fässer Bier und auf den Weg 8 bis zu 10 Meßlein Hafer(n) mitgeben müssen. H[err] B[ürgermeister] Christof Miedel ist bei dem Aufbruch so geängstigt worden, daß er oben, von seinem Erkerfenster herauß auf den Misthaufen gesprungen ist. Obwohl die Offiziere(r) die Reiter an etlich[en] Orten mit Prügeln und bloßem Degen abgewehrt haben, so konnten sie aber doch nit überall sein. [Vielfach] kamen sie auch zu spät.
Dieses ein[z]ige Nachtquartier hat sehr viel gekostet [und] hat auch mehr einer feindlichen Plünderung als einer Quartierung gleichgesehen. Wir haben dies alsobald(en) nach ihrem Abreisen sowohl H[errn] Oberst Paradeiser, als auch einem redlichen Magistrat berichtet und dabei auch – weil wir sie nit mehr verpflegen und besolden konnten – um(b) Abforderung unserer Salva Guardi[a] angehalten, worauf in der Nacht Schreiben an den Grafen kamen, worin sich die Stadt und der Kommandant wider unseren zugefügten Schaden hoch beschwerten. Wir haben sie (hi)nachgeschickt, haben aber den Schaden behalten müssen“.[186]
„Noch schlimmeres Leid mußte im vorletzten Kriegsjahr die Familie des Johann Thomae ertragen. Der aus Willingen[187] stammende und vorerst als Praeceptor in Herborn[188] tätige Geistliche hinterließ uns folgende Schreckensmeldung: ‚Bei dem Ueberfall der Löwensteinschen Reiter auf Bicken[189] am 14./24. Dezember wurde ihm mit seiner Familie übel mitgespielt. Nach seinem eigenen Berichte im Kirchenbuch wurde er, nachdem bereits einige Einwohner, auch Kinder, teils erschossen, teils verwundet worden waren, mit seiner Hausfraw unbarmhertzig geschlagen, sonderlich also zugerichtet und zermartelt, daß sie alle gemeinet, ich sey gantz todt; sie haben ihm auch großen Schimpff und Schaden gethan, Kleydt, Schuh, Hembd alles nackend ausgezogen, seiner Fraw einen newen Rock, Schuh, Strümpffe ausgezogen; seine Kinder beraubet und dem kleinen in der Wiegen seine Lumpen weggenommen‘. Thomae ging 1658 als Konrektor nach Hanau“.[190]
„Graf Johann Moritz von Nassau-Siegen reiste zusammen mit dem Nassau-Dillenburger Rat Schöler am 23. März [1648; BW] von Dillenburg aus nach Wien zum kaiserlichen Hof. Rat Schöler sollte im Auftrag von Graf Ludwig Heinrich an die versprochene finanzielle Unterstützung seiner Grafschaft, die der Kaiser ihm seinerzeit zugebilligt hatte, erinnern. Gleichzeitig wünschte sich der Graf, daß der Hohen Schule in Herborn ein Universitätsprivilegium zugesprochen werde, um in allen Fakultäten so wie in Heidelberg[191] und Marburg[192] graduieren zu können. Weder die zugesicherten Patentrechte für das Universitätsprivilegium der hohen Schule in Herborn noch die offenstehenden Geldforderungen in Millionenhöhe wurden vom Kaiser erfüllt“.[193]
Sein Regiment kämpfte unter großen Verlusten in der Schlacht von Zusmarshausen[194] am 17.5.1648 zusammen mit den anderen kaiserlichen Regimentern unter Holzappel und den kurbayerischen Regimentern unter Jost Maximilian Graf von Gronsfeld gegen die schwedisch-französischen Konföderierten unter Wrangel und Turenne.[195]
„Als Dank für die Kriegsverdienste und die vielen Blutopfer der Nassauischen Regimenter wurden die Grafen Johann Ludwig von Nassau-Hadamar im Jahr 1650 und Ludwig Heinrich von Nassau-Dillenburg im Jahre 1652 in den Reichsfürstenstand erhoben. Fürst Ludwig Heinrich, der aus drei Ehen 18 Kinder hatte, verstarb am 2.6.1662 im Alter von 68 Jahren. Seine letzte Ruhestätte fand er in der Dillenburger Stadtkirche“.[196]
[1] LORENTZEN, Die schwedische Armee, S. 74.
[2] Haiger [Dillkreis]; HHSD IV, S. 196f.
[3] GAIL, Krieg, S. 12.
[4] Herborn [Dillkreis], HHSD IV, S. 212ff.
[5] Rennerod [Westerwaldkreis].
[6] Rotenhain [LK Westerwaldkreis].
[7] Diez [Unterlahnkreis], HHSD V, S. 75f.
[8] Ewersbach [Dillkreis], HHSD IV, S. 116.
[9] Vgl. KAISER, Politik; JUNKELMANN, Der Du gelehrt hast; JUNKELMANN, Tilly.
[10] Herborn [Dillkreis], HHSD IV, S. 212ff.
[11] Dillenburg [Dillkreis]; HHSD IV, S. 89ff.
[12] Camberg [Kr. Limburg]; HHSD IV, S. 75f.
[13] Hadamar [Kr. Limburg]; HHSD IV, S. 194f.
[14] Koblenz; HHSD V, S. 178ff.
[15] GAIL, Krieg, S. 12f.
[16] Sontra [Kr. Rotenburg); HHSD IV, S. 417.
[17] GAIL, Krieg, S. 14.
[18] Dessau [Stadtkr. Dessau]; HHSD XI, S. 77ff.
[19] Vgl. KRÜSSMANN, Ernst von Mansfeld.
[20] ENGELBERT, Hatzfeldt, Nr. 71; Vgl. REBITSCH, Wallenstein; MORTIMER, Wallenstein (2012 auch in dt. Übersetzung).
[21] Westerwald; HHSD IV, S. 454f.
[22] Driedorf [Lahn-Dill-Kreis]; HHSD IV, S. 96.
[23] GAIL, Krieg, S. 15.
[24] GAIL, Krieg, S. 16.
[25] Vgl. BROCKMANN, Dynastie.
[26] Sinn [Lahn-Dill-Kreis].
[27] Frankfurt/M.; HHSD IV, S. 126ff.
[28] GAIL, Krieg, S. 16f.
[29] KOPPENHÖFER, Mitleidlose Gesellschaft, S. 34.
[30] ILIEN; JEGGLE, Leben, S. 85.
[31] Vgl. STADLER, Pappenheim.
[32] GAIL, Krieg, S. 18.
[33] Höhn [Westerwaldkreis].
[34] Oberfischbach, heute Ortsteil von Freudenberg [LK Siegen-Wittgenstein].
[35] Freudenberg [LK Siegen-Wittgenstein]; HHSD III, S. 234.
[36] Molsberg [Oberwesterwaldkreis]; HHSD V, S. 237f.
[37] GAIL, Krieg, S. 19.
[38] Medebach [LK Brilon]; HHSD III, S. 500f.
[39] Schmallenberg [Hochsauerlandkreis]; HHSD III, S. 672f.
[40] Olpe [LK Olpe]; HHSD III, S. 593f.
[41] Attendorn [LK Olpe]; HHSD III, S. 36ff.
[42] Grafschaft, Kloster [LK Meschede]; HHSD III, S. 263.
[43] Homburg [Gem. Nümbrecht, Oberberg. Kr.]; HHSD III, S. 337f.
[44] Züschen [LK Brilon]; HHSD III, S. 814.
[45] Berleburg [LK Wittgenstein]; HHSD III, S. 67f.
[46] CONRAD; TESKE, Sterbzeiten, S. 278f.
[47] GAIL, Krieg, S. 20.
[48] Tringenstein, heute Ortsteil von Siegbach [Lahn-Dill-Kreis].
[49] Oberrod [Westerwaldkreis].
[50] Elsoff [Westerwaldkreis].
[51] GAIL, Krieg, S. 19f.
[52] Siegen; HHSD III, S. 686ff.
[53] Augenscheinlich gab es zwei Seelbachs gleichen Namens: „Am Schlusse dieses Jahres [1632; BW] war auch der Graf Ludwig Henrich [v. Nassau-Katzenelnbogen-Dillenburg; BW] mit Errichtung seines Reiterregimentes beschäftigt; von dem Könige Gustav Adolph war er noch zum Obersten desselben ernannt worden, der dann das Commando dieses Regimentes dem Johann Conrad von Seelbach als Oberstlieutenant übertrug. Dieser machte auch im Siegen’schen eine treffliche Werbung und das Regiment kam bald in vollständigen Stand“. KELLER, Drangsale, S. 188. Nach Herrn Norbert Lorsbach war ein „Johann Konrad von Selbach saynischer Amtmann in Hachenburg. Zumindest wird er in den Akten, die zur Gegenreformation im Kirchspiel Daaden handeln (Landeshauptarchiv Koblenz, Bestand 30, Nr. 2799), als solcher bezeichnet. Von daher scheint es unlogisch, dass er Beauftragter des Freusburger Amtmannes Johann Georg von Holdinghausen war. Eher dürfte er die saynischen Interessen vertreten haben, während von Holdinghausen die kurtrierischen Interessen gewahrt haben dürfte“.
[54] Freusburg [Kr. Altenkirchen]; HHSD V, S. 105f. „Das ehemalige saynische Amt Freusburg war mit dem Urteil des Reichskammergerichtes vom 6.7.1626 an Kurtrier gelangt, dass daraufhin auf der Freusburg eine Garnison errichtete. Im Frühwinter 1628 leitete Philipp Christoph von Sötern die Gegenreformation in Freusburg ein“. Zwischen Kurtrier und Schweden wurde zu Beginn des Jahres 1632 ein Neutralitätsvertrag ausgehandelt, den Gustav II. Adolf im Mai jenes Jahres ratifizierte. Danach sollte Schweden seine Truppen aus den besetzten kurtrierischen Territorien zurückziehen, was für das Amt Freusburg aber unterblieb. In das darin gelegene Kirchspiel Gebhardshain waren im Januar 1632 Söldner des Grafen Heinrich Wilhelm zu Solms-Laubach-Sonnenwalde brandschatzend eingefallen und hatten sich dort dauerhaft in Quartier gelegt. Zu den daraus resultierenden Schäden und Kosten handelt die undatierte kurtrierische Aufstellung „Verzeichnis was das Solmische Regiment Kriegsvolck in Anno 1632 Zu Gebertzhain beneben ihrem gebürlichen Commis geschadiget unndt an Viehe genohmenn Unndt hinweg getrieben“, die sich als letztes Schriftstück in den saynischen Kriegsakten (Landeshauptarchiv Koblenz, Bestand 30, Nr. 2974, S. 455-458) findet (Laufzeit: 1620-1632). Während des Quartieres der Solms’schen Söldner im Kirchspiel Gebhardshain unternahmen die Soldaten der kurtrierischen Garnison auf der Freusburg immer wieder Raubzüge auf saynischem Territorium. wie der undatierten saynischen Akte entnommen werden kann, die den Titel hat: „Fragmentum Designatio derer widigkeiten gewaldthaten auch hostilitäten, welche da bevor auch beÿ währenden neutralitaets tractaten biß itzo von Chur Trier deßen soldaten und underthanen sowohl männiglich, als auch den armen Saÿnischen unterthanen zugefüget worden nach beschehener Ch. Trierischer occupation des ambts Freußburg“ (Landeshauptarchiv Koblenz, Bestand 30, Nr. 2973, S. 6). Darin heißt es, die kurtrierischen Soldaten der Freusburger Garnison hätten „verschiedene reuter von denen Solmischen und andern regimenten heimblich und offenlich erschoßen, ermordet umbpracht, beraubt und außgeZogen“. In der Folgezeit war es zu weiteren Gewalttätigkeiten der kurtrierischen Soldaten gekommen, indem diese in den Monaten Mai und Juni des Jahres 1632 „verschiedene einfell in das ampt Hachenburg getahn“, dabei „ein Hauß in brandt geschoßen“ und „25 pferdt weggeraubt“ hatten. Zudem hatten sie einen saynischen Untertanen „geschoßen“, und „alles so unsicher gemacht“, dass sich die Saynischen „mit weib und Kindern“ des nachts über „in Hecken und sträuchern ufhalten und salviren“ mussten (Landeshauptarchiv Koblenz, Bestand 30, Nr. 2973, S. 7). Nach freundlicher Mitteilung von Herrn Norbert Lorsbach.
[55] Andernach [Kr. Mayen]; HHSD V, S. 12f.
[56] Linz am Rhein [Kr. Neuwied]; HHSD V, S. 207f.
[57] CONRAD; TESKE, Sterbzeiten, S. 125ff.
[58] GAIL, Krieg, S. 20.
[59] Brilon [LK Brilon]; HHSD III, S. 119f.
[60] Paderborn; HHSD III, S. 601ff.
[61] Rüthen [LK Lippstadt]; HHSD III, S. 659f.
[62] BRUNS, Brilon, S. 95f. (Staatsarchiv Marburg 4 h Nr. 1137).
[63] Rheinfelden (Baden) [LK Lörrach]; HHSD VI, S. 659.
[64] GAIL, Krieg, S. 20f.
[65] Westerburg [Oberwesterwaldkreis], HHSD V, S. 401f.
[66] Weilburg [Oberlahnkr.]; HHSD IV, S. 452f.
[67] Braunfels [Kr. Wetzlar]; HHSD IV, S. 59f.
[68] Bicken [Dillkreis]; HHSD IV, S. 45f.
[69] Seelbach [Lahn-Dill-Kreis].
[70] Offenbach, heute Ortsteil von Mittenaar [Lahn-Dill-Kreis].
[71] Burbach [LK Siegen-Wittgenstein].
[72] Seelbach, heute Stadtteil von Herborn [Lahn-Dill-Kreis].
[73] Ebersbach: nicht identifiziert.
[74] Niederscheid, ehemals Ortsteil von Uckerath, heute Hennef (Sieg) [Rhein-Sieg-Kreis].
[75] Doppelhaken !
[76] Mainz; HHSD V, S. 214ff.
[77] GAIL, Krieg, S. 21ff.
[78] Hilchenbach (LK Siegen]; HHSD III, S. 322f.
[79] Bilstein [Gem. Kirchveischede, LK Olpe]; HHSD III, S. 77f.
[80] Arnsberg [LK Arnsberg]; HHSD III, S. 28ff.
[81] Hameln; HHSD II, S. 192ff. Gemeint ist wahrscheinlich die Schlacht bei Hessisch-Oldendorf.
[82] Kirchhundem [LK Olpe]; HHSD III, S. 395f.
[83] Oberveischede, heute Ortsteil von Olpe [LK Olpe].
[84] CONRAD; TESKE, Sterbzeiten, S. 341.
[85] Valbert [LK Altena]; HHSD III, S. 728f.
[86] Oedingen [LK Meschede]; HHSD III, S. 584f.
[87] CONRAD; TESKE, Sterbzeiten, S. 140.
[88] GAIL, Krieg, S. 24.
[89] Braunfels [Kr. Wetzlar]; HHSD IV, S. 59f.
[90] Montabaur [Unterwesterwaldkr.]; HHSD V, S. 239f.
[91] ENGELBERT, Hatzfeldt, Nr. 71.
[92] Vgl. HÖBELT, Ferdinand III.
[93] Die Liga existierte nicht mehr; gemeint sind kurbayerische Truppen.
[94] GAIL, Krieg, S. 25ff.
[95] Rudolstadt [Kreis Saalfeld-Rudolstadt].
[96] KRUSENSTJERN, Selbstzeugnisse, S. 118.
[97] Gemeint waren die Truppen Nassaus.
[98] Saalfeld [LK Saalfeld-Rudolstadt]; HHSD IX, S. 369ff.
[99] Blankenburg am Harz [Kr. Blankenburg/Wernigerode]; HHSD XI, S. 46f.
[100] Stadtilm [Ilm-Kreis]; HHSD IX, S. 413ff.
[101] Wüllersleben [Ilm-Kreis].
[102] Bösleben [Ilm-Kreis].
[103] Marlishausen [Ilm-Kreis].
[104] Mühlhausen [Unstrut-Hainich-Kreis]; HHSD IX, S. 286ff.
[105] Schwarzburg [Kreis Saalfeld-Rudolstadt]; HHSD IX, S. 395ff.
[106] Rudolstadt [Kreis Saalfeld-Rudolstadt]; HHSD IX, S. 360ff.
[107] Remda-Teichel [LK Saalfeld-Rudolstadt]; HHSD IX, S. 351.
[108] Dienstedt [Ilm-Kreis].
[109] Witzleben [Ilm-Kreis]; HHSD IX, S. 173.
[110] Erfurt; HHSD IX, S. 100ff.
[111] HEUBEL, Bl. 165 – 166; mdsz.thulb.uni-jena.de.
[112] GAIL, Krieg, S. 27.
[113] Pressburg [Bratislava, ungarisch Pozsony].
[114] Hanau; HHSD IV, S. 19ff.
[115] BADURA; KOČÍ, Der große Kampf, Nr. 573.
[116] ENGELBERT, Hatzfeldt, Nr. 71.
[117] Leipzig; HHSD VIII, S. 178ff.
[118] Nürnberg; HHSD VII, S. 530ff.
[119] Worms; HHSD V, S. 410ff.
[120] Vgl. HÖBELT, Ferdinand III.
[121] GAIL, Krieg, S. 27.
[122] ENGELBERT, Hatzfeldt, Nr. 71; Bielefeld; HHSD III, S. 73ff.
[123] Wismar [Kr. Wismar]; HHSD XII, S. 133ff.
[124] Oldendorf [Kreis Steinburg].
[125] Hamburg; HHSD I, S. 83ff.
[126] Bielefeld; HHSD III, S. 73ff.
[127] Lemgo [LK Lemgo]; HHSD III, S. 452ff.
[128] KELLER, Drangsale, S. 336f.
[129] Bergen-Enkheim, heute Stadtteil von Frankfurt.
[130] militärischer Weckruf.
[131] Frankfurt/M.; HHSD IV, S. 126ff.
[132] KELLER, Drangsale, S. 349f.
[133] [Bad] Homburg v. d. Höhe [Obertaunuskr.]; HHSD IV, S. 23ff.
[134] ENGELBERT, Hatzfeldt, Nr. 71; Villmar [Oberlahnkr.]; HHSD IV, S. 439.
[135] MURDOCH, SSNE ID: 3315.
[136] Zinsen.
[137] Elbing [Elblag, Stadtkr.]; HHSPr, S. 45ff.
[138] St. Andrews [Fife] ?
[139] GAIL, Krieg, S. 28f.
[140] Kaub [Loreley-Kreis]; HHSD V, S. 166f.
[141] Wetter [Kr. Marburg]; HHSD IV, S. 455ff.
[142] Marburg; HHS IV, S. 35ff.
[143] Frickhofen [Kr. Limburg]; HHSD IV, S. 144.
[144] Wahrscheinlich ist Dehrn [Kr. Limburg]; HHSD IV, S. 86, gemeint.
[145] Ellar [Kr. Limburg], HHSD IV, S. 105.
[146] Steinbach, heute Stadtteil von Hadamar [LK Limburg-Weilburg].
[147] Eibelshausen, heute Ortsteil von Eschenburg [Lahn-Dill-Kreis].
[148] GAIL, Krieg, S. 29f.
[149] Frankenberg; HHSD IV, S.124f.
[150] Blankenstein; bei Gladenbach [LK Marburg-Biedenkopf].
[151] Frankfurt/M.; HHSD IV, S. 126ff.
[152] Bielefeld; HHSD III, S. 73ff.
[153] GAIL, Krieg, S. 30.
[154] Friedberg; HHSD IV, S. 145ff.
[155] ENGELBERT, Hatzfeldt, Nr. 71; Braunfels [Kr. Wetzlar]; HHSD IV, S. 59f.
[156] GAIL, Krieg, S. 30.
[157] ENGELBERT, Hatzfeldt, Nr. 71.
[158] Vgl. FOERSTER, Kurfürst Ferdinand.
[159] ENGELBERT, Hatzfeldt, Nr. 71.
[160] ENGELBERT, Hatzfeldt, Nr. 70.
[161] Lemgo [LK Lemgo]; HHSD III, S. 452ff.
[162] ENGELBERT, Hatzfeldt, Nr. 70.
[163] Münster; HHSD III, S. 537ff.
[164] GAIL, Krieg, S. 31f.
[165] GAIL, Krieg, S. 32.
[166] 1 Ohm = 80 Maß, 1 Maß = 4 Schoppen, 1 Schoppen zu 4 Vierteln oder Mengelchen.
[167] GAIL, Krieg, S. 32.
[168] Schüttenhofen [Sušice, Bez. Klattau]; HHSBöhm, S. 558.
[169] Böhmisch Krumau [Český Krumlov]; HHSBöhm, S. 53ff.
[170] Böhmisch Budweis [České Budějovice]; HHSBöhm, S. 46ff.
[171] TOEGEL; KOČÍ, Der Kampf, Nr. 590.
[172] ENGELBERT, Hatzfeldt, Nr. 71.
[173] Hammerstein [Kr. Neuwied]; HHSD V, S. 127.
[174] Vgl. BABEL, Zwischen Habsburg und Bourbon.
[175] ENGELBERT, Hatzfeldt, Nr. 71.
[176] GAIL, Krieg, S. 33.
[177] Oberscheid, heute Stadtteil von Hennef [Rhein-Sieg-Kreis].
[178] Niederscheld, heute Ortsteil von Dillenburg [Lahn-Dill-Kreis].
[179] Nanzenbach, heute Ortsteil von Dillenburg [Lahn-Dill-Kreis].
[180] Gusternhain, heute Ortsteil von Breitscheid [Lahn-Dill-Kreis].
[181] GAIL, Krieg, S. 34.
[182] KRUSENSTJERN, Selbstzeugnisse, S. 151f.
[183] Eger [Cheb]; HHSBöhm, S. 119ff.
[184] Marktredwitz [LK Wunsiedel im Fichtelgebirge]; HHSD VII, S. 429f.
[185] Dörflas, heute Stadtteil von Marktredwitz [LK Marktredwitz i. Fichtelgebirge].
[186] BRAUN, Marktredwitz, S. 289f.
[187] Willingen (Upland) [LK Waldeck-Frankenberg].
[188] Herborn [Dillkreis], HHSD IV, S. 212ff.
[189] Bicken [Dillkreis]; HHSD IV, S. 45f.
[190] GAIL, Krieg, 34f.; Hanau; HHSD IV, S. 199ff.
[191] Heidelberg; HHSD VI, S. 302ff.
[192] Marburg; HHSD IV, S. 35ff.
[193] GAIL, Krieg, S. 35.
[194] Zusmarshausen [LK Augsburg]; HHSD VII, 849f. 17.5.1648: Die französisch-schwedischen Truppen unter Turenne und Wrangel schlagen die Kaiserlich-Kurbayerischen unter Holzappel, der dabei fällt, und Gronsfeld. Vgl. HÖFER, Ende, S. 175ff.
[195] GAIL, Krieg, S. 35.
[196] GAIL, Krieg, S. 35f. Nach SCHMIDT-BRENTANO, Kaiserliche und k. k. Generale, S. 67, am 2./12.7.1662.
Veröffentlicht unter Miniaturen
Verschlagwortet mit N
Kommentare deaktiviert für Nassau-[Katzenelnbogen]Dillenburg, Ludwig Heinrich Graf von
Stegen [Steegen, Stegken], Maximilian von [der]
Stegen [Steegen, Stegken], Maximilian von [der]; Obrist [ – ] Stegen[1] war angeblich italienischer Abstammung und stand als Obrist in kaiserlichen Diensten.
1634 war er Kommandant des von den Schwedischen und Kurbrandenburgischen belagerten Crossen.[2]
Das „Theatrum Europaeum“ berichtet unter dem Juni 1634: „In der Schlesien waren nun beyde Schwedische und Chur-Sächsische und Brandenburgische miteinander vereiniget / und die Schwedisch-Brandenburgische zwar lagen für Crossen / die Chur-Sächsische aber vor Groß-Gloggau.[3]
Crossen ist am ersten übergangen / und mit Accord erobert / und von dem Herrn Schwedischen General Major [Stålhandske; BW] und Obr. David Dramond [Drummond; BW] eingenommen / haben mit weissen Stäben[4] außziehen müssen / also sich der mehrertheil bey den Schweden untergestellt und unterhalten lassen. Die Accords-Puncten lauten / wie hierunter gesetzt:
1. Soll die Käyserl. Guarnison mit weissen Stäben von Crossen außmarchiren / unnd die Knechte bey dieser Armee Dienst nehmen / und sich unterhalten lassen.
2. Der Commendant sampt den anderen Capitäynen sollen ein jeder mit einem Wagen ihrer Pagagy außziehen / und benebenst andern Officirern / als Leutenanten / Fähnrichen und Feldwebeln in salvo convoirt werden.
3. Sollen sie sich keines Wegs unterstehen / von Stücken / Ammunition und andern Sachen / so ihnen nicht zukommen / etwas auf dem Weg zubringen oder versehren.
4. Sollen sie keinem Bürger von dem Seinigen wieder entfrembden oder mit sich nehmen / vielweniger dieselbe auff einigerley Weise gefähren.
5. Alle Gefangene / so unser Parthey angehörig / sollen sie restituiren / und ohne einige Exception auff freyen Fuß stellen.
6. Biß so lang die Convoy wieder in salvo zu unserer Armee gelangt / sollen sie zween genugsame Geysseln zurück lassen / welche hernach an sichern Orth und Stelle sollen verschafft werden.
7. Alsbald die Capitulation unterschrieben / sollen sie verpflichtet seyn / alle Aussenwerck den Unserigen einzuräumen / und die innerste StattThor mit ihrem Volck die Nacht über besetzen / und Morgens frühe außmarchiren.
Zu Urkundt und gemeinsamer Versicherung ist dieser Accord von beyden Partheyen bekräfftiget / unterschrieben und versiegelt: So geschehen im Feld-Läger vor Crossen / den 2. Junii / An. 1634.
David Dramond.
(L. S.)
Maximilianus von Stegken
(L. S.)“[5]
Stegen löste Steinheim als Kommandant von Eger[6] im Juli 1635 ab.[7]
Stegen erhielt am 24.7.1636 vom Kaiser den Befehl, seine Truppen von Hohenberg[8] wegzuführen und im Fürstentum Bayreuth fortan keine Kontributionen mehr zu erheben. Den gleichen Befehl erteilte der Sohn des Kaisers, König unter dem 26.7. von Heilbronn[9] aus. Zugleich genehmigte auch er dem Fürstentum Brandenburg/Kulmbach-Bayreuth einen Schutzbrief.
Der Chronist und Bürgermeister Georg Leopold[10] aus dem von Eger abhängigen Marktredwitz[11] erinnert sich an den September dieses Jahres: „Den 3. Septemb[er] ist der Oberste Graf Schlick mit seinem Regiment zu Roß nach Wunsiedel[12] [ge]kommen und [hat] sich doselbst(en) einquartiert. Obwohl vorher(o) der markgräfische [Ansbach-Bayreuth; BW] Kommiss[ar], He[rr] Budewels darwieder sich heftig setzete, hat doch solches nit könnet verwehret werden. Damit wir aber dieser Völker auch zu genießen hätten, bemüheten sich die Wunsiedler sehr, bis sie es dahin brachten, daß der Graf die stärksten 2 Komp[agnien] herüberschickte, die sich bei uns einquartierten und uns ziemlich plagten. Wir berichteten solches alsbald nach Eger, auf welches der Kommandant dem Grafen schrieb, er sollte ihm sein Quartier Rebitz, welches zu[r] Unterhaltung seines Regiments ihm kontribuieren müßte, unbedrängt lassen, die Reiter alsbald abführen oder aber er müßte sich des Gewalts bei dem Kaiser beschweren. Darauf nahm er sie den 5. dito von hier. [Sie] haben uns viel gekostet; der Graf selbst(en) auch. [Er] brach den 6. mit dem Regiment auf, marschierte gegen Franken und ließ ein schlechtes Lob hinter sich.“[13]
„Den 24. dito [24.9.1635; BW] ist der Kommandant zu Eger, Ober[st] Maximilian von der Stegen mit seinem Regiment zu Fuß auf[ge]brochen und mit noch einem Regiment zu Fuß – , so daselbsten an[ge]kommen, auf Waldsachsen [= Waldsassen[14]] zu marschiert. Und weil sie ihn zu Waldsassen nit einlassen und Quartier geben wollten, hat er’s ersteigen lassen und ist mit Gewalt hinein. Des andern Tags ist er daselbst[en] wieder fort und von Mitterteich[15] berüber auf Waldershof[16] und [hat] sich dort einlogiert. Das andere Regiment, welches mit ihm zog, legte sich nach Man(t)ze[n]berg,[17] Pfaffenreuth,[18] Poppenreuth[19] und nach Wolfersreuth.[20] Er schickte uns von Waldershof Salva Guardi[a] herab, hingegen mußten wir ihm hierauf Bier, Brot und Fleisch verschaffen. Sie marschierten am anderen Tag gegen Nürnberg[21] zu“.[22]
Sein Regiment, das unter dem Befehl Geleens stand, soll nur noch 250 Mann umfasst haben, als sich der Schweinfurter[23] Kommandant Kessler von Kessel weigerte, ihn in die Stadt einzulassen.[24]
[1] Vgl. die Erwähnungen bei KELLER-CATALANO, Tagebücher.
[2] Krossen oder Crossen a. d. Oder [Krosno Odrzańskie; Brandenburg, h. Polen]; HHSD X, S. 246f.
[3] Glogau [Glogów]; HHSSchl, S. 127ff.
[4] Weißer Stab: das Zeichen der Pilger u. Bettler, symbolisiert hier das Zeichen der Landflüchtigkeit, für Kriegsgefangene, Aufrührer, die Übergabe auf Gnade und Ungnade (DWB, Bd. 17, Sp. 336, 28), der Niederlegung aller Würden und den Verzicht auf allen Besitz.
[5] THEATRUM EUROPAEUM Bd. 3, S. 307.
[6] Eger [Cheb]; HHSBöhm, S. 119ff.
[7] BRAUN, Marktredwitz, S. 59.
[8] Hohenberg a. d. Eger [LK Wunsiedel i. Fichtelgebirge]; HHSD VII, S. 307f.
[9] Heilbronn [Stadtkr.]; HHSD VI, S. 315ff.
[10] KRUSENSTJERN, Selbstzeugnisse, S. 151f.
[11] Marktredwitz [LK Wunsiedel i. Fichtelgebirge]; HHSD VII, S. 429f.
[12] Wunsiedel [LK Wunsiedel i. Fichtelgebirge]; HHSD VII, S. 836f.
[13] BRAUN, Marktredwitz, S. 59. Braun datiert nach dem a. St.
[14] Waldsassen; HHSD VII, S. 785ff.
[15] Mitterteich [LK Tirschenreuth].
[16] Waldershof [LK Tirschenreuth].
[17] Manzenberg, heute Ortsteil von Marktredwitz [LK Wunsiedel i. Fichtelgebirge].
[18] Pfaffenreuth, heute Ortsteil von Marktredwitz [LK Wunsiedel i. Fichtelgebirge].
[19] Poppenreuth [seit 1978 Bestandteil der Gemeinde Waldershof].
[20] Wolfersreuth, heute Ortsteil von Waldershof [LK Tirschenreuth].
[21] Nürnberg; HHSD VII, S. 530ff.
[22] BRAUN, Marktredwitz, S. 60.
[23] Schweinfurt; HHSD VII, S. 686ff.
[24] HAHN, Chronik 3. Theil, S. 480ff.
Veröffentlicht unter Miniaturen
Verschlagwortet mit S
Kommentare deaktiviert für Stegen [Steegen, Stegken], Maximilian von [der]

