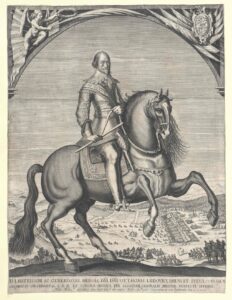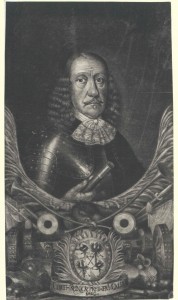Hrastowacky [Hastowasky, Hraztouachki, Hrastowasky, Hrastowatzky, Hrastowaschky, Hrastouatzky, „Trasky“, „Rasta Wascki“], Lukas [Lucatsch] [Gallo ?]; Obrist [-April 1633]
von Peter Nüchterlein und Dr. Bernd Warlich
Sein Vorgänger Peter Gál verstarb spätestens am 6.9.1626 an der Pest, wie sich aus dem Postscriptum eines Briefs Wallensteins[1] ergibt: „Der Obr. Gall Peter ist an die Pest gestorben, der De Fur [Nikolaus Des Fours; BW] begehrt seine Reiter, solches wird ihm gewiss nicht angehen, denn ich hab kein grössern Rauber als ihn und wegen der Rauberei hette ers gern, wollte Gott, dass ich den De Fur nie gesehen hette, denn er macht mir viel Unordnungen“.[2] Hrastowacky hatte nach dem Tod Peter Gáls dessen Ungarn übernommen und wird meistens als „Obrist Lucas“ oder „Lucatsch“ erwähnt“.[3]
Im Tagebuch des Wernigerode[4] Kantors und Sechsmanns[5] Thomas Schmidt wird das perfide System der Erpressung und Nötigung einer Stadt durch Hrastowacky ausführlich beschrieben: „Den 11. deß. [21.12.1627; BW] (hora 4 pomerd)[6] ist der Kroaten Oberste Hrastowasy mit 15 Reitern in Kaltenbrunns Haus ankommen. Den 12.[22.12.1627] (hora 3 pomerid.)[7] sind 2 Kornet[8] des Oberst Hrastowasky in die Stadt gezogen, denen Billette[9] gegeben, auf jeden Bürger ein Pferd. Den 15. [25.12.1627; BW] hat der Oberste mit E. E. Rath[10] accordiren wollen, hat aber so hoch angeschlagen, dass man’s ad referendum[11] nehmen müssen. Denn er zu seiner Küche wöchentlich 200 Thlr. forderte, ohne sein und der Offiziere Deputat, welches sich auch auf 500 aufs wenigste erstreckte; käme der Stab wöchentlich auf 800 Thlr., und die Reiter gleichwohl zu unterhalten – Den 16. [26.12.1627; BW] ist des Obersten Bagage, als 3 Wagen hereingebracht, wobei ein Kapitänleutnant[12] gewesen. Den 17. [27.12.1627; BW] der Oberst, wie auch U. g. H. Graf Heinrich Ernst[13] gen Halberstadt[14] zum Oberst Becker,[15] demselben zu verstehen gegeben, die sehr hohe Forderung des Obersten, darauf doch wenig erfolgt. – Den 19. [29.12.1627; BW] ist E. E. Rath für sich zu accordiren vorhabens, sich durch den kleinen Quartiermeister an ihre Thüren ‚salvam gardiam’ schreiben lassen. Nachmittag hat der Oberst in alle Ratsherrn Häuser Soldaten einlegen lassen, welche über die Maaß dominirt[16] und Muthwillen getrieben, darum (sagend) dass E. E. Rath mit dem Oberst nicht accordiren und in seine gethane Vorschläge verwilligen wollen. Es sind aber dem Obersten etzliche Bürger aufgesetzt, die wöchentlich in ihrer Kontribution 100 Thlr. aufbringen, die Unterhaltung seiner Küche übergeben.
Den 20. [30.12.1627; BW] ist der Fähnrich, so den 14. Okt. [24.10.1627; BW] hierkommen, mit seinen Musketiren abgezogen, und in Horenburg[17] sein Quartier bekommen.[18] Die Sechsm. und Ausschuß[19] und etliche Bürger zu Rathhause gefordert worden, do ihnen angezeigt, wie daß der Oberst eine hohe Summe Geldes zu seinem Unterhalt und Deputat haben wollte, denn er forderte wöchentlich 1500 Thlr. und 3 ½ Wispel[20] Hafern, so sollten die Bürger mehr nicht, denn nur Quartier, Holz, Salz und Licht[21] ihnen geben, derowegen zu deliberiren,[22] wie solches auszuschlagen, denn um dieser willen, daß E. E. Rath nicht einwilligen wollen, auf seine Vorschläge, sei ihnen so viel Reiter in ihre Häuser gelegt, und allerlei Schmach angethan worden.
– – Auf der Bürger Begehren zur Antwort gaben: dass die Bürgerschaft Bedenken trüge ihnen alsobald zu willfahren, ob sie schon beleget, denn die Herren unterweilen den Bürgern, wenn sie etwas zu suchen, so höhnischen Bescheid gaben, daß mancher mit Ungeduld abtrete. Jedoch aber zu verhüten größer Unheil könnte E. E. Rath alle Rotte[23] zu Rathhaus fordern, in Beisein des Herrn Obersten aber dessen Gevollmächtigten die Bürger an Eidespflichten fragen, was und wie viel eine jeder darzureichen vermöchte, so bliebe E. E. Rath außer Gefahr. – Den 22. [1.1.1628; BW] Auf Begehren des Hern. Obersten Lucas Gallo Hrastowasky hat E. E. Rath alle Rotte zu Rathause fordern lassen, da ein jeder in Gegenwart des Hern. Quartiermeisters und des Adjudanten bei seinem Gewissen aussagen sollte, wie viel er wöchentlich zur Kontribution dem Hrn. Obersten (weil dieser sich erklärte, wenn er wöchentlich 1000 Thlr. und 350 Scheffel Hafern[24] bekäme, wollte er 1 ½ Kornet abführen) einbringen könnte; es sollten die Bürger ihre Commercia und Handthierung ungehindert treiben hin und wieder. Es ist an diesem Tage nur die Hälfte der Rotten absolvirt worden, worinnen sich nur 200 Thlr. gefunden; haben es auch lassen anstehen. (Die Bürger sich zum höchsten beschwert, daß Konsul Posewitz[25] sie und die Stadt in jetzo hochbedrängten Zeiten, so gar verließe, das Hasenpannir aufgeworfen[26] und flüchtig worden wäre, was man hieraus mehr machen sollte ? ob man nicht mit ihm zu procediren[27] wie in den andern und großen Städten, da man nach Urtheil und Recht schickte, und sich darnach richteten, was solchermeineidige[28] Konsul[29] mitbrächte ? – die Merodischen [Johann II. v. Mérode-Waroux; BW] auf ihn gelauert – ). Den 23. [2.1.1628; BW] (mancherlei Unterhandlung, der Oberst ließ bis auf 900 Thlr. und 300 Scheffel Hafer herunter, und wollte alsdann ein Kornet abführen, und das andere selbst unterhalten, oder aber der Rath sollte dies unterhalten und ihm 500 Thlr. geben. Der Rath, Sechsm. und Ausschuß stellte die Unmöglichkeit vor, da sandten die Offiziere nach den Steckenknechten,[30] uns zu erklären, wo nicht ? ab carcerem.[31] Der Rath sagte auf eine Woche, zum Versuch, 900 Thlr. zu, aber den Hafer könnten sie nicht schaffen.) Darauf haben die Offiziere mit uns zum Karcer[32] gewollt, wir aber gebeten keine Gewalt an uns zu üben; aber nichts helfen wollen. Die Offiziere sind vor uns her, die Steckenknechte hinter uns nachgegangen und nach dem Thurm[33] hinter den Mauern (gegen den Ritterhöfen, jetzt zu dem Stall vermiethet) geführet, da man die Uebelthäter pfleget zu verwahren, und in den selben Thurm einlegen lassen, als (die) Konsule Henn., Schmiden, Valtin Eischen, Christoph Schaper, (die Rathmänner) Konrad Barden, Esaias Robran, Heinrich Wedde, Henn. Losen, Michael Müller und der Stadtschreiber Julius Petri. Ich aber (und 4 andere) uns ausgewickelt,[34] mit Vorgeben, daß wir keine Rathsherren wären. Hierauf wir andern, die wir los davonkommen, uns aufs äusserste bemühet allerlei Mittel vor die Hand zu nehmen, auch alsobald an den Oberst Becker gegen Halberstadt[35] notifizirt.[36] Die Stadtthore sind alle verschlossen zugehalten worden, daß keiner aus- oder einkommen können.
Den 24. [3.1.1628] hat der Oberst alle Passzettel, worauf verzeichnet gewesen, wie viel ein jeder Bürger zur Kontribution einbringen soll, wiederum von den Rottmeistern[37] abgefordert, (der Betrag aller 32 Reise[38] war doppelt 1034 Thlr. 6 Gr., es wurde dem Obersten aber nur einfach übergeben. Hiernächst die Sechsmänner den Obersten gebeten, daß er den Rath aus dem Thurm und Staut (?)[39] in eine warme Stube, es sei aufm Rathhause oder wo es I. Gn. belieben würde, wollte eingehen lassen, denn es wären alte verlebte Personen, und wären kalt, damit ihnen kein ferner Unheil zukommen möchte. Antwort, Sie sollten nicht ausgelassen werden, sie verhießen dann die geforderte Kontribution. Es könnte ihnen aber Essen hinein gereicht werden, und etwas Feuer und Kohlen, welches auch also bald geschehen. Horn [Hora; BW] 12 pomerid[40] ist auf vielfältiges Anhalten der Sechsm. und daß die Bürgerschaft nichts schließen könnte, wofern der Stadtschreiber nicht auf freien Fuß gelassen, der ab und zu gehen könnte, (der Stadtschreiber[41]) wieder aus dem Thurm gelassen worden. A meridie[42] hat der Oberst durch den Adjudanten befehlen lassen, daß ein jeder Rottmeister seinen Zettel wieder zu sich nehmen sollte, und von jedem, wie viel ihm gesetzet, einfordern soll; wer sich hierin verweigern würde, dem wolle er sein Haus voll Reiter legen lassen. Welches (Einfordern) auch ins Werk gerichtet worden. Item an U. g. H.[43] geschrieben. Abends. Die Sechsm. abermals angehalten beim Hrn. Obersten, um Auslassung des E. Raths, wie auch deroselben Weiber, die ihn zu unterschiedlichen Malen überlaufen;[44] aber er hat uns alle abschlägige Antwort gegeben, weil mit Vermelden, wo sie nicht willigen wollten, sollten sie sitzen, wenn sie auch gleich als solches saßen. In dieser Nacht die gleich alda waren und auf die ellection des Bischofs[45] warteten, abgesandt, eins an Kais. Majestät,[46] das andere an den General,[47] darin verzeichnet, den Prozeß, den der Hr. Oberste mit E. E. Rath gehalten und warum. Die natali[48] 1628 stütze[49] beim Hrn. Obersten wieder angesucht, um Erlassung E. E. Raths aus der Haft, desgleichen die Weiber; aber nichts erhalten können. Mittags sind die Pastores anzuhalten vermogt worden, denen zur Antwort worden; sie sollten wieder anhalten, sed nil impetratum.[50] Den 26. Dez. [5.1.1628; BW] ist aber ein Schreiben nach Halberstadt dieserwegen abgegangen. Um 6 Uhr Abends sind die Herren des Raths wieder aus dem Thurm gelassen worden, jedoch mit dem Bedinge, daß ein jeder stipulatu manu[51] dageloben müssen, einen Accord einzugehen, auf ein Genanntes, was und wie viel wöchentlich dem Herrn Obersten darzureichen und dazu sollten sie Zeit haben bis Morgen 2 Uhr Nachmittag; würden sie aber solches nicht thun, sollten sie wieder incarcerirt werden. Solches haben sie versprochen, jedoch quoad posible[52] und weiteres nicht.
Den 27. Dez. [6.1.1628; BW] sind die Sechsm., die vom Ausschuß, und alle Rottmeister, dazu aus allen Rotten zwei oder drei Bürger, aufs Rathhaus gefordert worden, do ihnen angezeigt, wie dass der Oberste, für die abgewichenen 14 Tage haben wollte 900 Thlr. und zwei Wispel Hafer[53] und dann wöchentlich ein Genanntes, wozu ihr Bedenken sie eröffnen sollten, ob sie solches verwilligen könnten, oder nicht. – (Die 900 Thlr. für die 14 Tage wurden bewilligt, hinführo 300 Thlr. etc.)
Der Bote ist mit einem Schreiben von U. g. H. wiederkommen, welches durch den Notarium[54] – – dem Hrn. Obersten insinuirt worden, neben den beiden Salvagardien vom General Wallenstein und Graf Kolloredo[55] gegeben. Do dieser alles insinuirt, hat der Oberste wissen wollen, wer solches geschrieben ? hat der Notarius geantwortet, das wüßte er nicht, es wäre von Stolberg[56] von U. g. H. herunter geschickt worden. Ist aber nichts weiter darauf erfolgt. Um 2 Uhr ist der Kapitainleutnant, ein Rittmeister und Adjudant aufs Rathhaus kommen) zum Accord (forderte für die 14 Tage 1000 Thlr. und 300 Scheffel Hafern, und künftig wöchentlich 900 Thlr.) darauf ihnen von dem Stadtschreiber 600 Thlr. geboten, mit Vorwenden, es wäre ja die Soldateska von den Bürgern unterhalten worden, denen viel drauf gangen, zu dem so wären sie in der Rathsherrn Häuser gefallen und darin mit Fressen und Saufen viel verschlemmet und Uepigkeit getrieben. (Nach vielem hin und her Bieten, bewilligte man endlich 900 Thlr. für die 14 Tage in zwei Terminen, und wöchentlich für die Zukunft 450 Thlr. auf 14 Tage zu versuchen, falls es dann von der Bürgerschaft weiter nicht aufgebracht werden kann, soll dieser Accord erloschen sein. Die Reiter und Pferde, so in der Stadt verbleiben, sollen von solcher wöchentlichen Kontribution unterhalten und in besondere Häuser, davon nicht kontribuiret wird, verlegt, und die Thore eröffnet werden und die aus der Vorstadt anderweit abgelöst werden (6. Jan. neuen Stils)
(Nach langer Unterbrechung seit dem 5. Stück, ist es vielleicht nicht überflüssig wieder in Erinnerung zu bringen, daß seit dem 11. Dec. 1627 hier der wilde und ungenügsame Oberst, Hrastowasky mit seinen Kroaten lag, der durch die Einkerkerung der standhaften Vorsteher der Stadt hinlänglich gezeigt hatte, daß er das Quälen verstehe. Es waren über das wöchentlich dem Obersten zu Liefernde noch Unterhaltungen.)
Den 27. Dez. [6.1.1628; BW] (Der Oberst verlangte wöchentlich 900 Thlr. endlich 800 und 300 Scheffel Hafern.) Indeme kam U. g. H. Graf Heinrich Ernst, welcher ebenermaßen für uns arme Unterthanen bat; die Offiziere aber sprachen, wenn I. G. beim Obersten was erhalten könnten, welches vielleicht geschehe, wenn er zu ihm käme, wäre am Besten; könnte Morgen zum Obristen kommen u. s. w. Die Bürgerschaft auf Morgenfrüh wieder zu Rathhause beschieden. Der Rath aber ist aufm Rathhause diese Nacht, als (noch) im Arrest, verblieben, ist aber ein Bothe mit Schreiben gen Stolberg an U. g. H. abgeschickt worden, unsern Zustand zu vermelden. – den 28. Dez. [7. Jan.) ist I. Gn. wieder aufs Rathhaus zu kommen gebeten, wie auch die Bürgerschaft gleichergestalt wieder erschienen, do dann I. G. zum Obersten gefordert, den Accord zu vollziehen, allda sich bald die Offiziere auch hinzu fanden. – – I. G. haben mit dem Obersten gehandelt, dass er für das Vergangene 900 Thlr. in zwei Terminen und künftig 850 Thlr. eins für alles, für seinen und seiner Offiziere Unterhalt und Hafern zugleich zu sagen thäte, Heu und Streu wollte er von den Dörfern hereinschaffen, welches auch beiderseits eingegangen, und der Oberst I. Gn. zum Mittagsmahl bei sich behalten, hat der Oberst gegen U. g. H. sich verlauten lassen, daß er die Merodischen [Johann II. v. Mérode-Waroux; BW] Reiter in Nöschenrode[57] nicht abzuschaffen vermögte, denn der Graf von Merode wäre sowohl ein Oberster als er, und diente auch der Kaiserl. Majestät, zu dem wären die Reiter allbereit hier gewesen, ehe er hierkommen, er hoffe aber sie sollten und müßten bald ausziehen. (Der Accord wurde darauf niedergeschrieben und die Condition angehängt: daß, wenn solche Summe an baarem Gelde nicht eingbracht werden kann, alsdann die Bürgerschaft zu verstatten, daß sie ihr Vieh, Hausgeräth und dergleichen, ohne Behinderung in benachbarte Städte verführen, distrahiren,[58] verkaufen und dazu um ein billig mäßiges convoi gegeben[59] werde. Dazu die Reiter und Pferde, so in der Stadt verbleiben, sollen von solcher wöchentlichen Kontribution unterhalten, und in besondere Häuser, damit die Bürgerschaft aller fernern Molestien[60] überhoben sein möge, verlegt, und denselben von der Bürgerschaft mehr nicht als Licht, Holz, Salz und etwas Heu und Stroh – – gereichet – die Thore eröffnet werden, der Accord zum Versuch auf 14 Tage gelten.) – Nachmittags wurde dem Oberst der Accord mit den ersten 450 Thlrn. überbracht. Morgen frühe sollten die Reiter ausgelegt[61] werden, und soll E. E. Rath bedacht sein auf etliche Quartiere nahe bei einander am Burgthor, da man 50 Reiter einlogieren könnte, wie auch nahe am Rimkethore, da auch 50 Reiter Platz und Logis haben könnten, zu verhüten allerlei Unfall und Einfall der Merodischen Reiter. Der Oberst aber wollte denselben ihren Unterhalt schaffen von 450 Thlr., daß sie Essen und Trinken, wie auch Futter kaufen; allein der Rath solle dahin sehen, daß sie für ihr Geld auch so viel kaufen könnten, wie die Bürger, nämlich, daß das Bier im selben Kauf, wie auch das Brodt und Fleisch in solchem Werth wie es jetzo ginge, gelassen würde, und den Soldaten nicht theurer angeschlagen würde, als den Bürgern, im widrigen soll ihnen solches genommen werden. Die andern Reiter wollte er anderweit abführen. – Den 29. [8.1.1628] ist der Kapitain-Leutnant auf Rathhaus kommen; angezeigt, daß der Oberst 4 Quartiere für seine Pferdehaben wollen, die ihnen Heu und Stroh geben sollten, desgleichen er, der Kapit.-Leut., 2 Quartiere. Item der Leutnant, und der Adjudant 2 Quartiere. Solches, obs wohl wider den Accord, haben sie es doch verwilligen und die Hülfsquartier geben müssen. Nachmittags ist die Kontribution (weil viele Bürger sich beschwert, daß es ungleich gesetzt.) corrigirt worden, worüber den die Korrigirten nicht zufrieden, ist also bei dem vorigen verblieben. Den 30. [9.1.1628; BW] ist eine Kompagnie (8o Pferde) hinaus auf die Dörfer,[62] zu dieser Grafschaft gehörig, geführt worden. Die Bauersleute haben dieselbe mit Quartier und Futter für ihre Pferde unterhalten müssen.
Jahr 1628
Am Tage Christi Beschneidung[63] hat der Oberst etlich viel Fuder[64] Heu, über 100 Fuder, vom Hof Schmatzfeld (damals im Besitz der von Veltheim[65]) durch die Bauern lassen in sein Quartier fahren, wie denn andere Offiziere auch was holen lassen. – Den 2. [12.; BW] Jan. hat der Oberst etliche Bürger aufgesetzt, so ihm über ihre zu Rathhause gesetzte Kontribution wöchentlich in seine Küche schaffen sollen, wie folgt: Speck, Kohl, Braunkohl,[66] Petersilie, Zwiebeln, Essig, Rüben, Meerrettig, Salz, Hering, Stockfisch,[67] Schollen,[68] Gewürz. (5 Bürger hat er dazu benannt.) Diese aber kontribuiren wöchentlich zu Rathhause 38 Thaler. Weil solches aber dem Accord ganz zuwider, diejenigen auch so abgesetzte Stücke und was noch mehr wohl dürfte gefordert werden, in die Küche darreichen sollen, ihre Kontribution vollkommlich einzureichen sich beschweren. – (so übergab man ein Memorial um Abstellung dieser und ähnlicher Plackereien, worauf nichts erfolgte) hat auch der Leutnant und Kapitain-Leutnant etliche Bürger vom Rathe zur Küchel, Item Heu und Streu, Licht und anders u. s. w. zu Hülfe begehret, so ihnen auch gegeben, von des Obersten Kontribuenten. (Der als Wachtmeister ins Westernthor beorderte Bürger (denn das Burg- und Rimkethor wurde von den Kroaten besetzt) legte die Schlüssel ins Fenster und ging in die Kirche, da fanden sie die Soldaten; der Oberst legte nun selbst Soldaten auch in dies Thor,) solches, wenn Holzfuhren oder sonsten etwas davon kommen, zu eröffnen, denen dann auch Trinkgeld[69] gegeben worden.
(Zwangsmaßregelung gegen die säumigen Kontributionspflichtigen, die Brauer Verlust der Braugerechtigkeit,[70] Kothsitzer[71] des Bürgerrechts[72]). – Den 19. [29.1.1628; BW] hat der Oberst dem Rath anmelden lassen, daß sie zum (Oberst) Becker etliche absenden sollten, damit ihm die Quartiere erweitert würden, darauf U. g. H. Graf Heinrich Ernst mit dem Stadtschreiber hinüber geritten, aber nichts ausgerichte. – Den 2. Sonntag nach Epipan.[73] Ist Ordonnanz vom Grafen von Merode kommen an Rittmeister Nicolaus Brummer und Hermanstein, dass sie alsbald aufziehen sollten. Hat der Adjudant seine Zehrungskosten (bei 90 Thlr.) vom Rath bezahlt haben wollen, und sie zogen, ohne ihren Zweck zu erreichen, ab). Den 23. Jan. [2.2.1628; BW] den Sechsmann, Ausschuß und allen Rottmeistern zu Rathhause in Gegenwart U. g. H. Graf Heinrich Ernst angezeigt, dass Ihr Gn. und der Stadtschreiber beim Becker nichts ausgerichtet, und der Oberst noch diese Woche die 850 Thlr. vor voll haben will, und I. Gn., wie auch der Probst[74] zu Wasserleer,[75] Herr Heinrich Metternicht (ein eingedrungener Katholik) gebeten, ein Collect[76] beim Hrn. Obersten um Linderung einzulegen, im Fall aber, wenn nichts zu erlangen, ob die Bürger die Kontribution einbringen könnten ? Antwort, sie wollten diese Woche noch geben so viel sie könnten, jedoch daß die Kontribution gelindert würde, und die Reiter beim Burgthor und Rimkethor mögten hinausgelegt werden. (Der Oberst wollte aber jetzt nicht bloß die 850 Thlr. für diese Woche, sondern auch 100 von voriger und 450 Thlr. welche er auf 1 Monat gestundet, in Summe 1400 Thlr. jetzt gleich haben, und künftig alle Woche 850 Thlr.) wofern solches nicht geschehen sollte, wollte er den Rath wieder in die gefängliche Haft legen, wollte auch aus der Rathsherrn Häuser sich bezahlt machen, wenn er so viel nicht darin finden würde, wollte er’s aus andern Bürgerhäusern nehmen lassen, und die Kompagnien wieder hereinbringen. Folgendes Tages wurden alle Rottmeister wieder zu Rathhause gefordert und ihnen des Obristen Meinung vorgehalten, worauf von den meisten dieser Bericht einkam, daß es uns möglich, so viel aufzubringen und wenn es schon einmal geschehe, und könnte hiernächst nicht folgen, so wäre es ja so neu; derwegen kommen die Reiter wieder herein, das mögte er thun, wenn’s alle wäre, so müssten sie aufhören. Welche Antwort Vielen, auch U. g. H. mißfiele. Darauf I. G. Graf Heinrich Ernst und der Propst zu Wasserleer, Herr Heinrich Metternicht gebeten worden, zum Herrn Oberst zu gehen, und um Linderung und darum zu bitten, daß den ordentlichen Bezahlern der Kontribution keine Reiter einlogirt würden. Sie sind hingegangen, aber nicht vorkommen können. Darauf der Oberst sie fordern lassen, ist der Stadtschreiber und Posewitz[77] hingangen, haben diese Antwort wiederbracht, daß er 1. keine Linderung geben könnte, es würden ihm denn seine Quartiere erweitert; 2. wollte er mit den 1400 Thlr. bis Ende Februar gegen eine Obligation[78] zufrieden sein; 3. wegen der Reiter willigte er ein. Darauf die Sechsmann Ausschuß, Rottmeister, 2 oder 3 Bürger aus jedem Rott, zu Rathhause fordern lassen: ob sie weiter kontribuiren wollten, oder aber die Reiter und andere Ungelegenheit, womit der Oberst drohet, gewärtig sein wollten. Denn [Denen ?; BW] die nicht kontribuiren wollten, denen sollten Reiter einlogirt werden. Worauf sie antworteten, sie wollten zwar lieber geben, jedoch so viel ihr Vermögen wäre. Ist den Rottmeistern anbefohlen worden, anzuzeigen, wer ferner kontribuliren, der sollte zu Rathhause erscheinen und, weil der Oberst 500 Thlr. wöchentlich fordert, sich einschreiben lassen, auch ihre Kontribution mitbringen. Sind auch alsobald Kontribution mitbringen. Sind auch alsobald Schatzherrn[79] verordnet, selbige aufzunehmen. G. Heinrich Ernst schrieb abermals an den Oberst David Becker, Freiherr von der Ehr. – Den 3. Sonntag nach Epiphan. Ist eine Kompagnie Reuter von den Dörfern in die Stadt wiederkommen, denen Billette auf diejenigen Bürger gegeben, so dem Obersten nicht kontribuiren wollen, oder die schuldig sind. (Aber es gab Verwirrung,) denn viele so bis der [bis her ? BW] richtig kontribuiret etliche Reiter bekommen. Diejenige aber, so sich haben einschreiben lassen, zur Kontribution der 500 Thlr. wöchentlich den Herrn Obersten, dieselben sind ausgenommen worden. –
Den 28. Jan. [7.2.1628; BW] ist vom Oberst Becker ein Fähnrich an den Oberst Hrastowasky geschickt, welcher Ordonnanz soll gebracht haben, etliche Reiter zu den erweiterten Quartieren abzuführen. – Den 29. [8.2.1628; BW] ist ein Leutnant mit einer Kompagnie Reiter gen Altenhausen[80] in die erweiterten Quartiere gerückt, ist der Oberst mitgefahren, (den 5. Febr. [15.2.1628; BW] zurück kommen.) – Den 7. Febr. [17.2.1628; BW] sind aber über 50 Reiter mit zwei um die Stangen gewickelte Kornette in die Stadt kommen, denen der Rath auf des Obersten Befehl haben Billette geben müssen. Weil aber die besten Quartiere dem Obersten zu seiner wöchentlichen Kontribution vorher ausgesetzt, und der Oberst sich im Geringsten nichts kürzen lassen, noch deren einen davon entbehren wollen, haben sie müssen dieselben in die noch übrigen armen Leute Häuser inlogiren, wodurch ein viel lamentiren worden, nichts desto weniger sie unterhalten müssen. – Den 11. [21.2.1628; BW] ist ein Kroat an den Galgen,[81] so auf dem Markt steht, gehängt worden; desgleichen sind 3 Soldaten-Jungen[82] um den Galgen gestreicht[83] worden, den einen aber das linke Ohr abgeschnitten.[84] Ingleichen soll einem Kroaten der Kopf abgehauen werden,[85] welcher einen Amtsschreiber im Fürstenthum Anhalt, soll erschossen haben, welcher aber um Gnade gebeten, und sich auf den Fürsten von Anhalt,[86] dessen Gnade er hoffte, berufen – – – ist wieder zum Profos[87] gebracht. – Den 26. Febr. [8.3.1628; BW] hat der Oberste in allen Rotten die Bürger, so ihm kontribuiren, zu Rathhause fordern lassen, und anzeigen, daß er keinen Hafer mehr hätte, seine Stuten auch bereits 4 Tage eitel Heu fressen müssen, derowegen wollte er von einem Kontributionen wöchentlich, über ihre Kontribution, 4 Mispel Hafern haben. Da ist ihnen (ihm) zu Gemüth geführt, daß ihm wöchentlich die schwere Kontribution geben, davon er Hafern kaufen könnte, und daß es den Bürgern viel zu schwer fallen würde. Antwort: das wenige Geld als 500 Thlr. wäre dem Obersten viel zu wenig,[88] sintemal er davon seine Küche halten müßte, und daß die Bürger sich beschwerten, hätten keinen Hafern; so wollte der Oberst umschauen lassen, und wo er Hafern finden würde, den wollte er wegnehmen lassen. – – Der Bürgermeister so zu Halberstadt wäre (Posewitz) hätte 15 oder 20 Wispel Hafer liegen. Er wollte durchaus Habern haben – – – endlich zufrieden, daß jeder Kontribuent ihm einen Scheffel über seine Kontribution bringen sollte. (119 Scheffel) Weil nun kein ander Mittel vorhandenen, wofern man ihm nicht wollen schauen lassen, alles was ein jeder noch hätte, boten wir ihm 100 Scheffel 8 Tage lang zu versuchen, womit der Oberst entlich content. (So viel Thaler einer Kontribution gebe, so viel Bierfaß[89] soll er bringen, oder Geld, den Scheffel zu 12 Mariengr.[90] Der Oberst hatte versprochen noch 4 Reiter auf jedes Dorf zu legen, aber bald zog er zurück) er könnte kein Dorf mit Reitern mehr und sehr beschweren, sintemal die Dörfer ihm wöchentlich an Kälbern und allen andern Sachen, was er von Nöthen, hereinschaffen müßten, neben ihrer gesetzten Kontribution.
Die Nacht vom 21 bis 22. Febr. [1.-2.3.1628; BW] sind 3 Pferde, so von den Sommerschenburg[91] hier dem Obersten zu Kauf gebracht, gestohlen worden, und durch die eingefallene Stadtmauer beim Rimkethor, so mit großen Blochen[92] wieder ergänzt, hindurch gezogen, indem die Bloche losgetrickelt.[93] Es ist der Schaalmeister[94] in der Neustadt die Nacht ausgetreten[95] mit seinen Kühen. Daher der Oberst den Rath des Nachmittags 3 Uhr aufm Rathhause in Arrest legen lassen, und sollen ihnen die Pferde wieder schaffen oder für jedes 100 Thlr. erlegen. Den 23. [3.3.1628; BW] ist U. g. H. Graf Heinrich Ernst zum Hrn. Oberst gegangen und ihnen sehr vorweißlich gehalten, daß er den Rath wegen der gestohlenen Pferde handfest gemacht[96] und arretiren lassen, ob denn eine Obrigkeit büßen sollte, was etwa ein Unterthan verbrochen hätte ? der Oberst aber sich daran nicht kehren wollen, sondern gesagt: der Rath hätte sollen die Stadt besser verwahren und er wollte die Pferde bezahlt haben. Derwegen I. G. ein Schreiben von General Friedland hervorgezogen, dasselbe dem Obersten aufm Tisch gelegt zu verreisen, (d. d. Prag 25. Jan. [4.2.; BW], dass er sich nur an den Grafen Wolf von Mansfeld[97] wenden mögte, der das Kommando hätte) und gesagt, daß derselbe von Mansfeld sein Blutsfreund wäre und wollte hin zu ihm und solche und dergleichen Insolentien ihm zu verstehen geben. Worauf der Oberst und Kapitain-Leutn. lauter[98] still geschwiegen. (Gegen Abend fanden sich die Pferde im Holz über Darlingerode.[99] Der Rath kam aber selbst den folgenden Tag (24. Sonntag [4.3.1628; BW] noch nicht los. Der Oberst Hrastowasky mit seinen Offizieren, so er alle herein fordern lassen, stark Fastelabend[100] gehalten bei 3 und 4 Tage lang. Der Oberst dem Rath andeuten lassen, daß sie des Arrests noch nicht loskommen könnten, weil sie ihm aber die Schlüssel zu dem einen Thor, als Westernthor, vorbehalten und und nicht alsbald überliefert hätten; desgleichen, daß sie die Stadtmauern nicht besser gebauet und verwahrt hätten, damit man nicht über oder durch hätte kommen können. Den 28. [8.3.1628; BW] ist der Rath ihres Arrests wieder vom Obersten entlassen worden und ihnen weiter nichts gesagt.
Den 5. März [15.3.; BW] zu Rathhause den Sechsmännern und andern sämmtlichen des Obersten Kontribuenten angezeigt, daß der Oberste durch den Quartiermeister begehrt, zu seiner Küche wöchentlich an Speck, Fleisch, Butter und Käse, Kohl, Hühner und Eier, hierin aber die Kontribuenten nicht willigen wollen, und weil der Quartierm. nicht wieder erschienen, wie er zugesagt, unterdessen aber zwei Intercessionalien,[101] sowohl von U. g. H. Graf Wolf Georgen,[102] als Graf Heinrich Ernsten an den Obersten abgangen, hat man die Gedanken gehabt, als hätten solche etwas effektuiret. Den folgenden Tag der Quartierm. wieder gesagt, daß der Oberst gewiß haben wollte von seinen von seinen Kontribuenten was er gefordert. Ja er wollte alles haben, was ihm zur Küche von Nöthen neben der Kontribution, ausgenommen den Wein. Der Oberst hat seine Kutscher und Fuhrknechte in etliche Bürgerhäuser gelegt, die dieselben speisen müssen, den Hafern aber der Oberst gegeben, denn etliche auch seine Pferde bekommen haben. Den 8. März [18.3.1628; BW] sind abermahl des Obersten Kontributionen zu Rathhause gefordert worden, do ihnen denn vorgelesen ist, dieses nachfolgende Memorial, so der Quartierm. des Obersten zu Rathhause gebracht:
Memorial was die Bürger wöchentlich kontribuiren und auf des Herrn Obersten Küchel schaffen sollen.
2 Rinder; 2 Kälber; 16 Hühner; 18 Lämmer; 1 Schwein, 4 indianische Hühner;[103] etliche Vogel; von allerlei Fisch; Weitz- und Rockenmehl; um ein Thaler Essig; 120 Eier; 100 Pf. Butter; 4 Pfd. Reis; 6 Pf. Pflaumen; 2 Pf. Pfeffer, 2 Pf. Ingwer; 2 Pfund Näglein;[104] (Nelken) ½ Pf. Muskatblumen; ¼ Pf. Saffran,[105] 174 gestossenen Zimmt; 2 Pf. kleine und große Rosinen; 24 eingemachte Citronen, 2 Pf. Honig; ½ Thlr. Zwiebeln; ½ Thlr. Petersilie; ½ Thlr. Meerrettig, ½ Thlr. Rettigrüben; ½ Schefl. Salz; 12 Pf. Stockfisch; 1 Schock Plastießen (Plateiße, Schollen);[106] 120 Heringe; 2 Pf. Kapern; 2 Pf. Oliven; 4 Pf. Baumöhl;[107] Saurenkohl; 2 Hut Zucker; 4 Pf. Hirschbrun (Horn ?);[108] ein Fäßlein Neunaugen;[109] 2 Seiten Speck; 4 Faß Bier; 14 Thlr. weiß und schwarz Brodt; 6 Schinken; allerlei Konfekt, jedes 3 Pf.; ein Käse.
Do diese Specification den Kontribution [Kontribuenten; BW.] vorgelesen, so auch ohne das darzureichen unmöglich, ist geschlossen worden, eine Supplication[110] an den Herrn Obersten abgehen zu lassen, in Latein vertiert[111] und ist dieselbe den 11. März [21.3.1628; BW] übergeben von mir, u. s. w. (Unter andern wird darin gesagt: Ob nun zwarten wie [wir ? BW] allerwegen zu Kaiserlichen Diensten alles dasjenige gerne gethan, und verrichtet, was von uns begehret, so können wir aber nicht verhalten, weß maßen wir arme Leute nunmehr durch das beschwerliche Kriegswesen, so nunmehr ins dritte Jahr gewähret und uns kontinuirlich auf dem Halse gelegen, ganz erschöpfet, ausgezehrt und ausgemergelt, also daß ein gut Theil Bürger von wegen Grämniß[112] verstorben, theils aber, so fast mehr nicht, als das zeitliche Leben übrig, ganz an den Bettelstab gerathen, von Haus und Hof mit Weib und Kindern sich wegbegeben, und des Bettelns ernähren müssen. Wir übrigen, bevorab diejenigen, I. G. kontribuiren, befinden das unsrige auch, daß wir hin und wieder geborget haben, und nichts mehr zu Borge bekommen können, sintemahl unser Credit, weil wir nicht haben zahlen können, verloschen, auch alles dasjenige, so wir an Butter und Käse von unserm Vieh, so noch übrig, und unsere Lebens Aufenthalt sein soll, zu Gelde machen und was uns sonst lieb und viel gekostet, als Kleider, Hausgeräth und dergleichen, um ein Liederliches hingeben müssen, damit die Kontribution wöchentlich eingebracht werden könne. – – So befinden sich auch eine ziemliche Inäqualität,[113] indem auf dem Lande von stattlichen freien und adelichen Rittergütern kaum bei 1, 2, 3, oder weniger Thaler gegeben werden. Hingegen sollen und müssen wir arme Leute, so allbreit alles das Unsrige zu- und eingebüßt, bei 6, 7 und mehr Thaler wöchentlich abstatten – – Bitten derhalben in Unterthänigkeit und um Gotteswillen; I. G. wollen diesen unser sehr elenden, betrübten Zustand gnädiglich ponderiren,[114] ein mitleidendes Herz mit uns haben und tragen, so wird Gott solches wieder belohnen, wie denn der Herr Christus selber saget Matth. 5, V. 7: Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen, und Sprüche 19, V. 17. Wer sich des Armen erbarmet, der leihet dem Herrn, der wird ihm wieder Gutes vergelten. Nun aber haben wir gehöret, dass I. G. ein sonderlicher Patron[115] der Armen und Bedrängten sein solle und denselben viel Gutthat beweisen; Ei so zweifeln wir auch nicht, I. G. werden solches an uns hochbedrängten armen Leuten auch wahr machen – – – und thun E. G. samt der ganzen Soldatesca zum allem glücklichen Succeß[116] der Obacht Gottes, uns aber derselbigen beharrlichen Favor[117] und Gnaden getreulich empfehlen.) Darauf diese lateinisch übergebene Supplication beim Herrn Obersten um Antwort – angehalten worden, daneben berichtet, daß dieselben Bürger, lange aufgewartet[118] und geharret, und nun, weil I. G. sich zur Ruhe niedergelegt, wieder weggegangen wären, hat er zur Antwort geben: Laß sie harren. Den 10. [20.3.1628; BW] ist der Bothe, so mit U. g. H. Schreiben an den jetzo nunmehr deputirten[119] General Obersten[120] Graf Wolfen von Mansfeld den 27. Febr. [7.3.1628; BW] abgefertigt, worinnen gebeten: unser hieliegenden Obersten abmarschieren zu lassen, wiederkommen, berichtet, daß jenseits Schweinfurt,[121] da er nach Ulm[122] zu laufen vorhabens, sintemal die Mansfelder daselbst gewesen, er von des Leopoldt[123] Reitern angestrengt[124] worden, den Brief genommen, eröffnet und gelesen, und da sie den Inhalt vernommen, in Stücken gerissen, und den Bothen stranguliren wollen, welcher aber sein Leben noch endlich erbeten hat. Den 11. [21.3.1628; BW] U. g. H. Graf Heinrich Ernst mit dem Stadtschreiber nach dem Grafen Schlicken[125] als Kaiserl. Kommissarien und Oberst. Feldmarschall wie auch den Grafen Altringer, so beisammen sein sollen zu Magdeburg,[126] sich verfüget. Wie man vernommen, so soll I. G. nichts ausgerichtet haben, denn der Graf Schlick noch nicht angelanget, zu dem der Oberst Altringer[127] gen Gröningen[128] gezogen, daselbst U. g. H. sich auch hinbegeben, weil er keine bequeme Herberge (wie es heißt) haben können, sich wieder nach Halberstadt verfüget. Den andern Tag ist unser Oberst auch dahin zum Altringer gefordert, I. G. aber zu spät kommen, do also fort ein Bothe dem Oberst Altringer nachgesandt worden, welcher Bothe neben I. G. Schreiben, auch zugleich Briefe von der Clerisel[129] allhier und derselben vom General mitgetheilten Salvagarden, wie auch unsern Obersten übergebene Spezifikation zur Küchel, wie obstehet, im Orig. dem Oberst Altringer überbracht hat, in welcher Clerisei Supplication ausdrücklich gesetzt, daß der Oberst Hrastowasky von den Priestern allhie eins für alles 100 Thlr. fordert und haben wolle zur Unterhaltung des Paters,[130] wo nicht, so soll ein jeder 3 Pferde und Soldaten auf ihren Pfarren unterhalten. Unterm 25. März [4.4.1628; BW] antwortete Altringer von Kalbe[131] aus: daß sich sobald eine Occassion präsentiren würde, dass alsdann die Stadt Wernigerode des bisher getragenen Lasts entledigt werden solle, der Oberhauptmann Becker habe es versprochen, an diesen solle man sich nur wenden: ‚Was des Oberst Hrastowasky so wohl von Geist- als weltlichen beschwerliche Prätension[132] anbelangt, ihm, Hern. Oberst, deswegen die Nothdurft zuzuschrieben, verhoffe, er werde dergleichen hinführo unterwegens lassen etc’.
Den 21. [31.3.; BW] dem Oberst 350 Thlr., auf bis 700 Thlr., so die Bürgerschaft ihm restirt,[133] abgegeben und überbracht, daneben eine lateinische Supplikation übergeben, desgleichen E. E. Rath die Klageschreiben und Intercessionales U. g. H. an den Altringer abgangen, ein Original mit dem Gelde in den Korb gelegt (wahrscheinlich, es ist sonst kein Zusammenhang in der Sache, hatte Altringer sein eben erwähntes Schreiben dem Magistrat zur Selbstbestellung mitgetheilt, und diesen die sämmtlichen Beschwerden in Original beigeschlossen), do sie der Oberst sahe, er sehr ungehalten ward, schalt und schmähete zugleich auf U. g. H. und den Rath, die Priester hieß er seductores (Hintergeher) weil ihre Supplikation dabei lag und sagt: sie sollten gleich wohl geben, oder Pferde unterhalten; desgleichen, so sollten wir auch reichen, was zur Küche auszeichnet, und solches gedoppelt; ingleichen für die 100 Schefl. Hafern sollten wir wöchentlich 6 Wispel liefern auch von der Zeit her, do er herkommen wäre; (dafür) daß man supplicirt die Reiter anderweit abzuführen, wollte und weil der Stadtschreiber I. G. Intercessionales mit seiner eigenen Hand geschrieben, hat er sich hören lassen, denselben auf Ungrisch zu prügeln.[134]
Auf diese übergebene Supplikation (weil, wie obstehet, die Klageschreiben sind mit überbracht worden) ist keine Erklärung erfolgt, auch nichts erhalten können, ob er schon dieselbe zu zweien und mahlen wieder in die Hand genommen und gesetzt hat. Den 28. März [7.3.1628; BW] hat der Quartiermeister auf Befehl des Obersten etlichen Kroaten Billette gegeben auf die Priester Häuser, daß sie dieselben mit ihren Pferden unterhalten sollen, weil aber der Herr Kaplan[135] die Thür nicht öffnen und sie einnehmen wollen, haben sie ihm die Thür mit Gewalt aufgelaufen.[136] Weil aber gegen den Obristen die Priester sich sehr beklagt haben, als haben sie sich erboten, mit dem Pater zu accordiren und demselben 30 Thlr. eins für alles zugesagt und gegeben. Damit sind die Priester losgesprochen worden. (Ein Brief des General-Feldmarschall Heinrich Schlick Graf zu Passau[137] d. d. Mühlingen[138] 9. April. versprach alle Unterstützung – nur müsse er sogleich nach Prag zum Kaiser.)“.[139]
Ein Teil seiner Kroaten war zu dieser Zeit auch im Herzogtum Braunschweig aufgetaucht. Schöningen,[140] der Witwensitz der Clara von Braunschweig-Lüneburg-Celle,[141] hatte 1628 auf Befehl Friedrich Ulrichs von Braunschweig-Lüneburg 350 Rt. aufbringen müssen, um sich von der Einquartierung der Kroaten Hrastowackys freizukaufen. 14 Tage lang blockierten sie Schöningen bis zum 10.4.1628, bis sie auf Befehl Johanns II. von Mérode-Waroux wieder abziehen mussten.[142]
„Den 8. April [18.4.1628; BW] haben wir – – diese lateinische Supplikation selber den Obersten insinuirt. Do wir (sie) dem Herrn Obersten übergaben in seine Hände fragte er, was dieß wäre ? Antwort: Es wäre ein Supplikation-Schreiben. Fragt er weiter, was wir denn supplicirten ? Erleichterung der schweren Kontribution. Er weiter: Was vor neue Kontribution ? die wir armen Bürger und verlaßenen Wittwen I. G. wöchentlich geben müßten, als 500 Thlr.; antwortete er: es wären nur 400 Thlr., die wir geben. Wir aber sagten, daß wir 500 Thlr. geben, welche er aber nicht gestehen wollte. Solange er weiter; was wir denn vermeinten und bäten ? Wir bitten Erlassung der schweren Kontribution, die uns also ferner aufzubringen unmöglich, alldieweil wir fast alle das Unsrige auf Kaiserliche Armee verwendet haben. Darauf gab er zur Antwort: Was gebt ihr mir denn ? Ihr gebt mir kein Brodt, kein Bier, keinen Wein auch nichts zur Küchel, ihr sollt mir noch mehr geben, ging damit in die Stube. Ob ich ihm nun zwar wohl wohl nachfolgete in die Stuben, und anhielte um Linderung der Kontribution, war doch nichts bei ihm zu erhalten und kamen unterdessen seine Offiziere, daß sie das Mittagsmahl mit ihm halten wollten, mit denen er Gespräch hielt und hatten wir also unsern Bescheid. – (Hier scheint mehrers nicht bemerkt zu sein.) Den 16. Mai der Oberst um den Rest von 350 Thlr. und den hinterstelligen Hafern angehalten, damit, wenn er heute oder Morgen Ordonannz bekame, ihm nicht Ursache geben würde, sich bezahlt zu machen an dem was er finden würde. (Es sei kein Geld zu erhalten, wie denn noch jetzo Rathspersonen nach Quedlinburg[143] dieserwegen ablegiert;[144] als wird gesagt: Wie und auf was Weise das Gelde aufzubringen ? es kam aber zu keinem Resultat.)
[Am 31.5.1628 wurden 3 Kompanien Hrastowackys in Saalfeld[145] einquartiert;[146] BW]
Den 23. Mai [2.6.1628; BW] eine Supplikation um Erleichterung der Kontribution dem Herrn Oberst übergeben wollen, aber nicht vorkommen können. Sonntag Exaudi[147] dem Herrn Obersten 187 Rthlr. an Dukaten,[148] Rosenobeln[149] und Reichsthalern auf den Rest der 350 Thlr. abgegeben, das geblieben 163 Thlr., weil er die Cruciaten[150] für 36 Ggr. Item eine Supplikation daneben überbracht, darin um Erleichterung der Kontribution gebeten. Darauf er zur Antwort geben lassen, er könnte nicht alle 8 Tage 100 Thlr. erlassen, er würde sonst zuletzt nichts behalten. Item der Oberst wollte keine Pfennige in der Kontribution mehr annehmen, besondern eitel Gold, Reichsthaler und Silbergeld. Den 6. Jun. [16.6.1628; BW] ist dem Rath proponirt[151] worden beim Obersten um Erleichterung der Kontribution anzuhalten, denn es der Bürgerschaft bei solcher Kontinuirung viel zu schwer wäre, wenn. Antwort: daß U. g. H. Graf Heinrich Ernst vom Oberst etliche mal wäre ersucht worden, es wolle I. G. herein zu ihm kommen, und Kundschaft mit ihm halten; als hätte ihr Gnaden geschrieben, als Morgen hereinzukommen, so könnte wohl eine Supplikation übergeben werden. Den 7. deß. [17.6.1628; BW] ist der Wachtmeister – – wieder aus Kroatenland[152] kommen und neugeworbenem Volk (bei anderthalb hundert wie es heißt) mitgebracht, wie denn ein Kaiserl. Kommissarius aus Prag, so ihnen ist adjungiret[153] worden, mitkommen. Graf Heinrich Ernst habe nicht zum Obersten gehen wollen, darum, dass etliche Offiziere wegen des neuankommenden Volkes beim Obersten gewesen, da es denn auf ein Saufen auslaufen würde, sondern ist wieder hinausgeritten.
Den 13. Junius [23.6.1628; BW]. Den hereinkommenen Propst von Wasserleer Heinrich von Metternicht um Rath gebeten, der für rathsam erklärt, man sollte eine Supplikation an den Herrn Obersten übergeben; welches auch also geschehen. Do der Oberste diese gelesen, hat er den Propst zur Antwort gegeben, er wollte auf Mittel bedacht sein, wie die Kontribution könnte gelindert werden. Den 14. deß. [24.6.1628; BW] ist der Oberst mit seinen Offizieren nach Sommerschenburg, daselbst er auch sein Quartier hat, und ihm kontribuiren müssen, gereiset, und ist der Kaiserl. Kommissarius, so mit dem neugeworbenen Volk von Prag hierkommen, mit weggezogen, und also fort nach Prag. Item ist keine Verehrung[154] gegeben, ohne[155] 2 Ries[156] Papiere, so er nit mitgenommen, weil er die begehrten Pferde nicht bekommen, worüber er denn sehr ungeduldig worden. Den 21. [1.7.1628; BW] deß. bei dem Oberst (weil er gestern Abend wieder von der Sommerschenburg angelangt) – – um Erleichterung der Kontribution angehalten. Gab er und [uns ? BW] diese mündliche Antwort: er könnte von der Kontribution (welche sich nur auf 300 Thlr. erstreckte) nichts finden lassen, denn er müßte alles davon kaufen, was er zu seinem Unterhalt von Nöthen, ging damit nach dem Hofe und ließ uns stehen, denn er uns mit rauen Worten anfuhr, und nicht weiter hören wollte, denn wir ihm geantwortet hatten, daß wir wöchentlich 400 Thaler geben müssten. (Aber bei 80 Thlr. soll er hiervorn seinen Offizieren reichen.) – Den 23. deß. [3.7.1628; BW] ist der Korporal[157] allhie aufm Schlosse in der Garnison liegend durch Ordonnanz vom Oberst Becker gen Halberstadt gefordert worden, und ein Gefreiter[158] neben 3 Knechten[159] in der Garnison verblieben. (Man wollte den Obersten Becker um Rath fragen, wie mans machen sollte.) denn die Bürgerschaft könnte solche schwere Kontribution länger nicht mehr aufbringen, daher ein Bürger nach dem andern beginnt auszutreten, seine Behausung stehen ließe, und davon ginge. (Ein Marketender[160] wollte anfangen zu brauen.) Den 28. [8.7.1628; BW] sind 600 Musketier aus Halberstadt durch den Oberst Becker geführt worden, so nach Stralsund[161] – – der Ob. Becker ist aber wieder gen Halberstadt kommen. Den 7. Julius [17.7.1628; BW] ist des Ob. Becker Quartiermeister hiekommen, dem Oberst vom General Ordonnanz überschickt, daß er ausziehen sollte mit seinen Kroaten, wenn der Oberst Isolan dieser Oerter marschiren würde.
[Am 22.7.1628 hatte Wallenstein aus Stralsund Hrastowacky das Ausreiten seiner Kroaten untersagt.[162]
Den 8. Juli. [28.7.1628; BW] Ist der Quartiermeister aufs Rathhaus kommen, ihnen wegen des Oberst Hrastowasky angezeigt, daß er Ordonnanz bekommen hätte und marschiren sollte, derwegen begehrt der Oberst 1. seinen Rest 163 Thlr.; 2. eine doppelt Kontribution, denn sie in acht Tagen aufbrechen würden und solches wäre Kriegsgebrauch; 3. so wollte er 50 Wagen und Pferde davor, als gehörten, haben darauf er sein Getraide an Hafern und andern fortbringen könnte; 4. begehrt er Salz, Essig, Speck, Waitzenmehl, Butter, so viel ihm zum Marsch von Nöthen; so wäre 5. zu Harsrode[163] eine Mahlmühle, so nichts kontribuirt hätte, dafür gebührt ihm billig[164] etwas; 6. es wären etliche aus ihren Häusern gelaufen, so unter des Obersten Kontribution wären, und nichts abgeben, dasselbe sollten die Herren (der Rath) erlegen; 7. so würde je und allwege der Gebrauch gehalten, wenn ein Marsch durch ordentliche ordonnanz einem Rathe angekündigt würde, so gebührt ihm ein Trinkgeld, welches er sich zu den Herren auch versehen thäte. (200 Pferde wären jetzt in der Grafschaft nicht zu finden. ) – Den 9. Jul. [19.7.1628; BW] Ist der Oberst Isolan mit etlichen Kornetten in Sillstedt,[165] Minsleben,[166] Langeln,[167] und Wasserleer kommen, und Nachtlager genommen. (Ein Pater Jodocus zu Halberstadt, der beim Oberst wohl gelitten, sollte Erlaß an den eben bemerkten Forderungen verschaffen, wogegen man ihm Dielen[168] versprach, – aber er richtete nichts aus.)
Den 12. Juli. [22.7.1628; BW] Der Oberst blieb bei schleuniger Bezahlung des Restes (den er auf 200 Thlr. angab), einer doppelten Kontribution, weil’s Kriegsbrauch beharren, oder wollte dieselbe von den Reitern verzehren lassen. So wollte er auch einen Revers[169] haben, daß er dasjenige, so der Quartiermeister zu I. G. Küchel gefordert, und (dessen Specification Herrn Altringer überschickt, nicht benommen hätte. (Die Exekution[170] folgte auf der Stelle.) Nachmittags um 5 Uhr sind 2 Kornett Reiter unter unsers Obersten Kommando in die Stadt unter I. G. Kontribuenten einquartiert worden, welche so einen groben Muthwillen, Ueppigkeit und Verprassen getrieben, daß es nicht zu sagen. Sintemal man ihnen nur hat geben und schaffen müssen, was sie begehrt und haben wollen, und wenn mans im Vermögen nicht gehabt, haben sie die Bürger, sowohl auch die Wittwen zu schlagen, und auch wohl auszujagt und hat Niemand klagen dürfen, alldieweil keine Errettung vorhanden, sintemahlen der Oberst nicht hören wollen, weil er fort gemusst und gerne länger allhie verbleiben wollen, wenn er nur gedurft. Denn er in dieser Woche mehr als 3 Ordonnanzen bekommen, daß ihm ander Quartier assignirt[171] worden, denoch nicht fort gewollt. Unterdessen die Soldaten tapfer dominirt[172] bis auf den 14. Jul., da sich der Oberst zum Aufbruch gerüstet und um 10 Uhr Morgens anspannen lassen vor seine Bagagewagen.[173] Weil ihm aber zur Abführung seines vielen Hafern Säcke gemangelt, ist von jedem Brauhause Weil ihm aber zur Abführung seines vielen Hafern Säcke gemangelt, ist von jedem Brauhause ein Sack gesammelt worden. Da ihm noch Pferde gemangelt, hat er noch 12 Pferde haben wollen, da aber dieselbe nicht vorhanden, denn die Bürger ihre Pferde aus der Stadt gebracht, und nit bekommen können, hat er lassen wieder ausspannen, und jeden Soldaten lassen wieder in sein Quartier reiten, da sie dann ihre Wirthe über die Maaße zu spendiren getrieben. (Der Bürgermeister Posewitz hatte 10 Pferde wollte aber auch nicht eins, selbst gegen Bezahlung hergeben, sondern brachte sie erst auf das Vorwerk[174] und von da weiter.) Die Bürger haben in diesen höchsten ihren Nöthen so viel Pferde aufgespührt, daß der Oberst hat können damit fortkommen, auch der Rath einen Revers von sich geben müssen, darauf der Oberst Reiter zu Pferde blasen und wieder anspannen lassen, und nach 3 Uhren Nachmittags ausgezogen nach Seeburg[175] (im Mansfeldischen) daselbst er wieder Quartier bekommen, ohne 2 Kornetts so in Blankenburg sollen einquartirt[176] blieben sein“.[177]
Am 7.8. lag er in Hohnstedt,[178] am 17.8. mit 4 Kompanien in Bernburg.[179] An diesem Tag brach er mit 6 Kompanien wieder auf.[180]
„Den 8. Dez. [18.12.1628; BW] Der Oberst Hrastowasky schrieb an die Stadt um ein Testimonium,[181] daß er bei seinem Abzug den Vorspann erbeten, keine Pferde gewaltthätiger Weise genommen, noch solche zu entführen geboten habe; (der Ob. Becker hatte ihn deshalb beim Altringer verklagt.) Der Magistrat ließ sich aber nicht darauf ein, sondern erwiderte er habe schon an den Ob. Becker berichten müssen. Dies geschah aber erst in dem nämlichen Augenblick mit einem früher datierten Schreiben, worin der Magistrat das Ungemach während Hrastowaskys Anwesenheit schildert, dessen Inhalt als Nachtrag hier stehen mag. Die Summe, welche diese der Stadt gekostet, macht 29729 Thlr. 17 Gr., (darunter war: über dies sind auf die übrigen Bürger bei 150 Billette gegeben worden, so die Reiterei mit Essen und Trinken auch die Pferde mit Hafern, Heu und Streu unterhalten müssen, welches leichthin wöchentlich 500 Thlr. mag gekostet haben, thut in 24 Wochen 12000 Thlr.) ist doch nicht in Anschlag gebracht, was den Bürgern, bevorab aus dem Rath, des Obersten Gesinde zu unterhalten gekostet; Item, was durch die Reiter in unsern Häusern, als wir im Thurm gelegen, verzehrt, (worin sie weidlich bankettirt, hat von unsern Weibern nicht allein an Essen und Trinken alles vollauf hergegeben werden müssen, besondern auch aus der Apotheke Zucker und Konfekt, dazu an lieblicher Musik nicht ermangeln dürfen); und was auf die Offiziere, wenn sie zu vielen Mahlen in die Stadt kommen, und unsere Häuser einlogirt, verwendet: Item was sonst wöchentlich zur Küchen verschafft werden müssen; abermals ungerechnet, was das ganze Regiment, do es etzliche Tage (vor dem Aufbruch) ganz in der Stadt gelegen, gekostet. In Summa, wir sind bei solcher Einquartierung sämmtlich in armen Leuten geworden. Denn es hat ein jeglicher, was er auch unter 100 Schlösser gehabt, hergeben, Mancher seine Kleinodien, Trauringe, darnach kupferne, zinnerne, letztlich auch hölzerne Geräthe zu Gelde machen und kontribuiren müssen. Wir haben uns hin und wieder bei Städten um Geld beworben und geliehen – – wissen fast nunmehr kein Mittel, wodurch wir solche Summe wiederbezahlen können, daher wir dann – – glaublos werden und in große Verachtung gerathen. – – Unserer und unsrer Bürgerschaft Vorrath ganz aufgegangen, also daß nunmehr der halbe Theil der Brauer nicht mehr brauen, bei 300 Bürger nicht mehr kontribuiren, dazu an elende betrübte Wittwen und Waisen, mehr als bei 200 Personen vorhanden, und also ein geringer Rest übrig, von welchen die annoch kontinuirende Kontribution erpresst werden muß. – Der Obr. Becker verlangte auch die Berechnung, was die Dörfer auf den Ob. Hrastowsky und dessen Regiment gewendet, es betrug in Golde 6161 Thlr. und an Hafer 57 Wispel (686 Thlr.) mithin 6847 Thlr., mit den Summen der Stadt zusammen 36576 Thlr. 17 Ggr“.[182]
Am 22.7.1631 wurde das Regiment mit 1000 Reitern in Schlesien neu errichtet. Angeblich wurde er wegen seiner Vergehen des Kommandos entsetzt.[183] Er fiel 1633. Nach dem Tod Hrastowackys wurde sein Regiment am 30.4.1633 Jan Karel Přichovský z Přichovic übertragen.[184]
Sein Regiment wurde 1634 auf Empfehlung Aldringens von dem Obristleutnant des Regiments Isolano, Ludovico Pervast, genannt „Ludwig“, übernommen.[185]
Um weitere Hinweise unter Bernd.Warlich@gmx.de wird gebeten !
[1] Vgl. REBITSCH, Wallenstein; MORTIMER, Wallenstein; SCHUBERTH; REICHEL, Die blut’ge Affair’.
[2] TADRA, Briefe 2. Teil, S. 435.
[3] Vgl. BALLAGÍ, Wallenstein’s kroatische Arkebusiere, S. 18. Freundlicher Hinweis von Herrn Uwe Volz.
[4] Wernigerode [LK Harz]; HHSD XI, S. 493ff.
[5] Beisitzer der Ratsherren. Als Kontrollorgan war die Einrichtung der „Sechsmänner“ in Wernigerode ins Leben gerufen worden. Sie waren ein Zugeständnis an die Forderungen der städtischen Mittel- und Unterschichten, der Unmäßigkeit des Patriziats einen Riegel vorzuschieben.
[6] 4. Stunde nachmittags.
[7] 3. Stunde nachmittags.
[8] Kornett: kleinste Einheit der Reiterei mit eigenen Feldzeichen, entspricht der Kompanie; 1 berittene Kompanie hatte bei den Sachsen ca. 125 Pferde, 1 schwedische Reiterkompanie umfasste in der Regel 80 Mann.
[9] Billett: meist in Übereinkunft mit Stadtbeauftragten ausgestellter Einquartierungszettel, der genau festhielt, was der „Wirt“ je nach Vermögen an Unterkunft, Verpflegung (oder ersatzweise Geldleistungen) und gegebenenfalls Viehfutter zur Verfügung stellen musste, was stets Anlass zu Beschwerden gab. Ausgenommen waren in der Regel Kleriker, Apotheker, Ärzte, Gastwirte.
[10] Ein Ehrbarer Rat.
[11] ad referendum: zum Vortrag, zum Bericht.
[12] Kapitänleutnant: Der Kapitänleutnant war der Stellvertreter des Kapitäns. Der Rang entsprach dem Hauptmann der kaiserlichen Armee. Hauptmann war der vom Obristen eingesetzte Oberbefehlshaber eines Fähnleins der Infanterie. (Nach der Umbenennung des Fähnleins in Kompanie wurde er als Kapitän bezeichnet.) Der Hauptmann war verantwortlich für Werbung und Soldzahlung, für Disziplin, Ausrüstung und Verpflegung sowie für die Ernennung der untergebenen Führer. Oft war er in erster Linie für die materielle Versorgung der Truppe zuständig und die eigentlichen militärischen Aufgaben wurden von seinem Stellvertreter, dem Kapitänleutnant übernommen. Der Hauptmann marschierte an der Spitze des Fähnleins, im Zug abwechselnd an der Spitze bzw. am Ende. Bei Eilmärschen hatte er zusammen mit einem Leutnant am Ende zu marschieren, um die Soldaten nachzutreiben und auch Desertionen zu verhindern. Er kontrollierte auch die Feldscher und die Feldapotheke. Er besaß Rechenschafts- und Meldepflicht gegenüber dem Obristen, dem Obristlieutenant und dem Major. Dem Hauptmann der Infanterie entsprach der Rittmeister der Kavallerie. Junge Adlige traten oft als Hauptleute in die Armee ein.
[13] Heinrich Ernst zu Stolberg, Graf [20.7.1593 – 4.4.1672] Stifter des älteren Hauptlinie des gräflichen Hauses Stolberg und ältester Sohn des Grafen Christoph zu Stolberg. Seit 1639 war er gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder Johann Martin zu Stolberg regierender Graf über die stolbergischen Besitzungen. Am 31. Mai 1645 teilten beide den Besitz. Heinrich Ernst erhielt die Grafschaft Wernigerode und den Hohnsteiner Forst. Er verlegte die Residenz von Wernigerode nach Ilsenburg. Am 2.5.1649 Heirat mit Gräfin Anna Elisabeth [getauft 6.8.1624-17.10.1668], die Tochter des Grafen Heinrich Volrad zu Stolberg, mit der er die beiden Söhne Ernst und Ludwig Christian hatte, die ihm nach seinem Tod auf Grund fehlender Primogeniturordnung in der Regierung folgten. ZEITFUCHS, Stolberg, S. 99.
[14] Halberstadt [LK Harz]; HHSD XI, S. 169ff.
[15] NÜCHTERLEIN, Wernigerode, S. 73ff. Der Hg. dankt Herrn Peter Nüchterlein für die Erlaubnis zum Abdruck der Textteile.
[16] dominieren: herrschen, beherrschen, Ausschreitungen begehen.
[17] Hornburg [LK Mansfeld-Südharz].
[18] aufsetzen: bestimmen, zuordnen, zuteilen.
[19] Ausschuss: gewählte Vertreter der Bürgerschaft.
[20] 1 Wispel Hafer = 24 Scheffel = 1320 kg.
[21] Eigentlich durfte nur der übliche Servis gefordert werden: die dem oder den einquartierten Soldaten zu gewährende Unterkunft und Verpflegung, festgelegt in den jeweiligen Verpflegungsordnungen. „Servis“ definiert sich als die Abgaben des Hauswirts an den/die einquartierten Soldaten an Holz, Licht und Liegestatt (Heu und Streu), oft kam noch Salz dazu; Kleidung, Ausrüstung etc., wurden verbotenerweise verlangt; Essen und Trinken fielen auch nicht darunter, wurden aber trotzdem eingefordert. Stattdessen konnte auch die sogenannte „Lehnung“ gegeben werden. Alle zehn Tage war diese Lehnung für die schwedischen Truppen zu entrichten, bei den unteren Chargen für Kapitän 12 Rt., Leutnant und Fähnrich 10 Rt., Sergeanten, Fourier, Führer, Musterschreiber und Rüstmeister zusammen 12 Rt., Trommelschläger, Pfeifer zusammen 6 Rt., Korporal 2 Rt., sowie den untersten Dienstchargen gestaffelte Beträge in Groschen. Im Oktober 1623 hatte Tillys Verpflegungsordnung für die Reiterei festgelegt: Rittmeister 4 Maß Wein, 20 Pfund Brot, 20 Maß Bier, 12 Pfund Fleisch, 2 Hennen und ein halbes Schaf. Ein reformierter Leutnant, Kornett oder Quartiermeister sollten 8 Maß Bier, 8 Pfund Brot und 4 Pfund Fleisch sowie ein Viertel von einem Schaf oder Kalb erhalten. Einem Jungen oder einem Weib standen 1 Pfund Fleisch, 2 Pfund Brot und 1 Maß Bier zu. BARNEKAMP, Sie hausen uebell, S. 42. Dazu kamen für den gemeinen Soldaten in der Regel täglich 2 Pfund Brot (zu 8 Pfennig), 1 Pfund Fleisch (zu 16 Pfennig) und 1 Kanne Einfachbier (2, 02 Liter zu 8 Pfennig). Statt Fleisch konnten auch Fisch, Butter oder Käse gegeben werden. Zwei Heringe entsprachen 1 Pfund Fleisch, eine Henne ersetzte 1, 5 Pfund Fleisch. Selbst diese Rationen wurden oft von den Offizieren noch unterschlagen. Der Erfurter Rat hält am 16.11.1641 die Klagen dreier gefangener Reiter des Regiments Hatzfeldt fest: „[Sie] berichteten [sie] wehren 5 tage von ihrem Regimente gewesen, undt nach einem Stücke brodts geritten, sie bekömen [sic] gantz nichts, wenn ihnen auch gleich Commiß[brot] zugesendet wehre, bekömen sie doch nichts: sondern die officirer behieltten solches alles vohr sich allein, [Sie] wussten auch nicht wo sie hin soltten, sie hetten deswegen von ihren officirern gantz nichts gehöret“. Zitiert bei BERG, Regulating war, S. 15; vgl. auch KUPER, S. 104. So der kaiserliche Feldmarschall Melchior von Hatzfeldt 1642: „Denn arm und hungrig zu sein, macht schlechte Curagi – wo nit anderes, davor uns der liebe Gott behüte“. ENGELBERT, Hessenkrieg II, S. 43. Die Verpflegung erforderte dennoch riesige Mengen an Schlachtvieh, zumal die Soldaten nur schieres Fleisch verlangten, keine Innereien oder Füße wollten, und der genießbare Fleischanteil z. B. bei Ochsen zwischen 25 u. 55 % je nach Fütterung lag. Von Oktober bis Dezember sollen kaiserliche Truppen im kaisertreuen Hessen-Darmstadt neben 30 000 Pferden 100.000 Kühe und 600.000 Schafe erbeutet haben; PARKER, Dreißigjähriger Krieg, S. 250. In Tillys Verpflegungsordnung von 1627 wie auch in den anderen Ordnungen dieser Art war dagegen der umsichtige Umgang mit Einwohnern ausdrücklich festgelegt. KLOPP, Tilly, S. 546. Zweimal täglich ein Gericht mit zwölf Gängen für einen Obristen war üblich. Vgl. die kaiserliche Einquartierungsordnung Melchior von Hatzfeldts für Westfalen (1636 III 09): „Wirt ebenmeßigh geklagtt, daß nicht allein die officierer, sondern auch die soldat(en) mitt ubermeßigem banquitier(en), sonderlich mitt verschwendungh vieler weins und geträncks den armen mahn gentzlich außlaugen, derenthalb(en) ein jeder und alle hiemit erinnert, das, was sie dergestalt uppich verzehr(en), ihnen an der contribution abgehe“. SCHÜTTE, Dreißigjähriger Krieg, S. 127. Nach der schwedischen Kammerordnung, 1635 X 04 (Geheimes Staatsarchiv Berlin-Dahlem I – 34 -179 b) hatte Oxenstierna den Anspruch pro Monat und gemeinen Reiter auf 4 ½ Rt., 60 Pfd. Brot und 60 Feldmaß Bier festgelegt. Zu den ständig steigenden Preisen KROENER, Soldaten, S. 288.
[22] deliberieren: überlegen.
[23] In Kriegszeiten wurden die Bürger einer Stadt in Rotten eingeteilt (als „Rottgesellen“). Der Rat bestimmte zu jeder Rotte einen Rottmeister als Aufsicht. Er war zuständig für das Meldewesen und die Feuerwehr, hatte aber auch seine Rottgesellen bei Musterungen und „Aufwartungen“ ihrem Fähnlein geschlossen zuzuführen. Nach der Osnabrücker Wehrverfassung (1580) bildeten 13-18 Bürger eine Rotte, 4-6 Rotten eine Fahne, d. h. eine Fahne bestand aus 52-108 Mann.
[24] 1 Scheffel Hafer = 55 kg, hier insgesamt 19250 kg Hafer !
[25] Posewitz, Wilhelm; Bürger und Bürgermeister in Wernigerode [ – ].
[26] Hasenbanner aufgeworfen: das Banner, das der Hase trägt; der Schwanz, den er beim Fliehen in die Höhe reckt.
[27] procedieren: verfahren.
[28] Meineid: „das Delikt wird je nach Schwere mit Verstümmelungsstrafen von meist spiegelndem Charakter (Verlust bzw. Verletzung von Schwurhand, Schwurfinger oder Zunge) bestraft, aber auch Gefängnis oder Verbannung, meist einhergehend mit Ehrverlust, eingeschränkter Amts-, Zeugnis- und auch Verfügungsfähigkeit, und sogar die Todesstrafe können verhängt werden; der Meineidige wird häufig zur Wiedergutmachung des angerichteten Schadens verpflichtet“. [nach DRW, online verfügbar unter: drw-www.adw.uni-heidelberg.de/drw]
[29] Konsul: Bürgermeister.
[30] Steckenknecht: Gerichtsdiener, Büttel. Die verachteten Steckenknechte beim Militär waren dem Profos untergeordnet; sie überwachten und verhafteten verdächtige Söldner, sorgten zudem mit den Trossweibern für die Latrinenreinigung. Aus dem Kreis der Steckenknechte wurde der „Stockmeister“ gewählt, der die Gefangenen verwahrte. Teilweise wurden 13- bis 14jährige als Steckenknechte angenommen; Straffällig gewordene Soldaten wurden zu Steckenknechten degradiert. Schwerverbrecher konnten begnadigt werden, wenn sie als Steckenknechte dienten. Üblich waren beim Stab 12 Rt. Sold im Monat (GALLETTI, Geschichte, S. 301), was etwa einem Einkommen von 9 Monatslöhnen eines bäuerlichen Dienstboten entsprach. Vgl. auch DANCKERT, Unehrliche Leute, S. 26ff.
[31] ad carcerem: ins Gefängnis, in Haft.
[32] Karzer: Gefängnis, mit geändertem Geschlecht nach lat. carcer neben Kerker im Gebrauch besonders des Schul- und Universitätslebens.
[33] Gemeint ist der Dullenturm, 1967 als Verkehrshindernis abgerissen. Im Westerntorturm befand sich der so genannte „Bürgergehorsam“, eine zweifenstrige Arreststube, in der Bürger wegen leichter Vergehen ihre Strafe absaßen. [hausgeschichte-wernigerode.de]
[34] auswickeln: aus dem Netz, der Schlinge lösen.
[35] Halberstadt [LK Harz]; HHSD XI, S. 169ff. Vgl. BOETTCHER, Halberstadt im 30jährigen Kriege, S. 81-103, 161-196.
[36] notifizieren: mitteilen.
[37] Rottmeister: Anführer einer Rotte: In Kriegszeiten wurden die Bürger einer Stadt in Rotten eingeteilt (als „Rottgesellen“). Der Rat bestimmte zu jeder Rotte einen Rottmeister als Aufsicht. Er war zuständig für das Meldewesen und die Feuerwehr, hatte aber auch seine Rottgesellen bei Musterungen und „Aufwartungen“ ihrem Fähnlein geschlossen zuzuführen. Nach der Osnabrücker Wehrverfassung (1580) z. B. bildeten 13-18 Bürger eine Rotte, 4-6 Rotten eine Fahne, d. h. eine Fahne bestand aus 52-108 Mann.
[38] Reise: anderer Begriff für Rotte ?
[39] Wahrscheinlich Druckfehler: Staub im Sinne von Schmutz, vermoderter Unrat.
[40] 12 Uhr mittags.
[41] Petri, Julius [ – ] Stadtschreiber in Wernigerode: Die Akten des Stadtrates führender Amtsträger, der die gesamten Schreibgeschäfte des Stadtrats besorgte, z. T. der einzige rechtskundige Beamte, der manchmal auch die Funktion eines Amtsschreibers übernahm. Er verdiente je nach Ausbildung und Stadt bis zu 200 fl. pro Jahr.
[42] ante meridiem: vormittags.
[43] Christoph II. von Stolberg-Wernigerode; Graf [1.12.1567 – 21.11.1638] verheiratet mit Hedwig von Reinstein und Blankenburg [20.11.1572-20.11.1634]. 1593 wurde der Titel „Graf von Stolberg, Königstein, Rochefort, Wernigerode und Honstein, Herr zu Eppstein, Münzenberg, Breuberg, Agimont, Lohra und Klettenberg“ vom Kaiser bestätigt. 1631 erlischt bereits in der dritten Gene-ration die Harzlinie wieder. Christoph II. aus der Rheinlinie vereinigt daher fast die gesamten Besitzungen wieder in einer Hand. 1645/57: Erneute Teilung der Besitzungen unter den beiden Söhnen des Grafen Christoph II.: Heinrich Ernst begründet die ältere Hauptlinie und übernimmt Wernigerode, Gedern und Schwarza. Johann Martin stiftet die Jüngere Hauptlinie mit den Besitzungen in der Grafschaft Stolberg und Herrschaft Ortenberg. Vgl. BRÜCKNER, Grafen zu Stolberg; ZEITFUCHS, Stolberg, S. 95ff.
[44] überlaufen: belästigen, bedrängen.
[45] Wahl des Erzherzogs Leopold Wilhelm zum Bischof v. Halberstadt. Vgl. OPEL, Die Wahl des Erzherzogs Leopold Wilhelm; SCHRADER, Der Katholizismus im Bistum Halberstadt, S. 267-301, hier S. 282-301.
[46] Vgl. BROCKMANN, Dynastie.
[47] Vgl. REBITSCH, Wallenstein; MORTIMER, Wallenstein; SCHUBERTH; REICHEL, Die blut’ge Affair’.
[48] die natali: Geburtstag (des Herrn).
[49] Stütze: Beistand, Hilfe, Unterstützung.
[50] sed nil impetratum: aber es wurde nichts erreicht.
[51] stipulatu manu: mit Handgelöbnis, Schwur, Eid.
[52] quoad possibile: inwieweit möglich.
[53] 1 Wispel Hafer = 24 Scheffel = 1320 kg.
[54] Notar: Urkundner, kein ausschließlicher Beruf, d. h. zum Teil als Nebentätigkeit ausgeübt, (öffentlicher) Beamter zur Beglaubigung von Urkunden.
[55] Colloredo-Waldsee, Rudolf Graf, Feldmarschall [2.11.1585 – 24.2.1657].
[56] Stolberg [LK Harz]; HHSD XI, S. 453ff.
[57] Nöschenrode, heute Ortsteil von Wernigerode (Eingemeindung: 1929).
[58] distrahieren: verkaufen.
[59] convoi gegeben: begleiten, (durch Begleitzug) schützen.
[60] Molestien: Beschwerungen, Belästigungen.
[61] auslegen: umquartieren.
[62] Wasserleben, Langeln, Drübeck, Minsleben, Silstedt, Nöschenrode, Altenrode, Darlingerode, Ilsenburg und Veckenstedt.
[63] Christi Beschneidung: 1. Januar.
[64] Fuder: entsprach etwa 1,9 Kubikmeter.
[65] Veltheim: „Die Familie von Veltheim war ein edelfreies, vermutlich aus Schwaben stammendes Geschlecht, welches im Herzogtum Sachsen ansässig war und zwischen 1157 und 1238 als Grafen von Osterburg und Altenhausen in Erscheinung trat. Daneben gab es das 1141 erstmals genannte uradlige Ministerialengeschlecht von Veltheim, das vermutlich nicht von den Edelherren und Grafen von Veltheim beziehungsweise Osterburg abstammte, heute jedoch noch in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt ansässig ist“. [Weitere Informationen unter wikipedia: „Veltheim (Adelsgeschlecht)“]
[66] Braunkohl: besser bekannt als Grünkohl.
[67] Stockfisch: durch Trocknung haltbar gemachter Fisch, vor allem Kabeljau (Dorsch), auch Seelachs, Schellfisch, Plötze und Leng. Stockfisch war eine beliebte Fastenspeise und diente der massenhaften Versorgung von Soldatenheeren.
[68] Scholle: Die Scholle oder der Goldbutt (Pleuronectes platessa) gehört zur Ordnung der Plattfische (Pleuronectiformes) und zur Familie der Schollen. Der Name wurde erst im 16. Jahrhundert geprägt, im Gegensatz zu Scholle (Grund), gefangen im Ostsee- und Nordseebereich.
[69] Der Begriff „Trinkgeld“ ist irreführend, teilweise wurden hier je nach Ladung 1-2 Rt. erpresst.
[70] Braugerechtigkeit: Seit dem 13. Jahrhundert ging das Braurecht großenteils an die Städte über. Das Braurecht war an ein Grundstück oder ein Haus, den Bierhof, gekoppelt. „Das bedeutet, die Berechtigung Bier zu brauen war nicht an eine Person son-dern an ein Grundstück gebunden, sogenanntes Realrecht. Dadurch bekam das Grundstück einen hohen Wert. Die Zahl der Bierhöfe war in den meisten Städten begrenzt, so dass ihren Inhabern das Bierbrauen sichere und nicht selten hohe Einkünfte bescherte. Dafür sorgten auch die städtischen Bierordnungen, die eine gegenseitige Konkurrenz des Bierhöfe untereinander weitgehend ausschlossen. Dort war nämlich für das ganze Jahr festgelegt, welcher Bierhof wann wie viele Biere brauen durfte. Ein Bier bedeutete dabei eine größere Menge, in der Regel mehrere große Fässer. Häufig lagen auf den Bierhöfen einer Stadt unterschiedliche Braurechte, das heißt es gab welche mit vier, acht, zwölf oder mehr Bieren. Die Bierhöfe waren zumeist nicht die eigentliche Braustätte. Viele Kommunen hatten gemeinschaftliche Sud- und Malzhäuser, sogenannte Kommunbrauhäuser. Auch die in der Anschaffung teure Braupfanne gehörte der Stadt. In vielen Städten gehörten die Besitzer der Bierhöfe zu den städtischen Oberschichten. Immer waren sie voll berechtigte Bürger, nicht selten gehörten sie sogar zu den ratsfähigen Geschlechtern“. [nach wikipedia: „Bierhof“] Vgl. auch TITZ-MATUSZAK, Mobilität der Armut, S. 63ff., für Goslar.
[71] Kotsitzer: auch Brinkkötter/Brinksitzer, Kossät, Besitzer einer Kate (Viertelbauer), Dorfbewohner mit in älterer Zeit geringem unverhuften Landbesitz, Natural-Abgaben und Hand-Diensten für den Grundherren
[72] Bürgerrecht: Privileg, das nur bestimmten Einwohnern der Stadt zuteil wurde. Die Verleihung der Bürgerrechte erfolgte durch Aufnahme in die Bürgerrolle und die Erteilung des Bürgerbriefes. Grundlage hierfür war zumeist ein Antrag auf Aufnahme, sowie der Nachweis bestimmter Voraussetzungen (bestimmtes Einkommen oder Vermögen, Leumund, Bürgereid u. a.).
[73] Epiphaniae Domini: Erscheinung des Herrn, der ursprüngliche und heute noch meist gebrauchte Name des am 6. Januar, dem historischen Weihnachtsdatum, begangenen christlichen Festes. Im Volksmund und in vielen Kalendern ist es auch als Dreikönigsfest, Dreikönigstag oder Theophanie, früher auch als „Groß-Neujahr“ oder „Hoch-Neujahr“ bekannt.
[74] Metternich, Heinrich von, Propst [ – 19.4.1658] Benediktiner, Prof. von Werden, ca. 1617-1625 in Ammensleben, 1631 in Werden, 1638 erneuter Versuch in Wasserleben, 1644 Propst in St. Agnes in der Magdeburger Vorstadt. STÜWER, Die Reichsabtei Werden, S. 453.
[75] Wasserleben [LK Harz]. Erste urkundliche Erwähnung des Ortes im Jahre 964 als Lere oder Lieren. Daraus entwickelte sich im Laufe der Jahrhunderte Waterlieren, Waterlere, ab dem 18. Jahrhundert Wasserleben. Bereits 1018 hatte sich der Ort Lere zu einem stark befestigten Ort mit einer Kirche entwickelt. Im Mittelalter hatte Wasserleben eine Burg südwestlich vom Dorf, vor dem Tore, und am Nordende ein zweites Tor, das Schauentor. Ab etwa 1300 ist ein Frauenkloster der Zisterzienserinnen belegt. [wikipedia]. Als erstes Zisterzienserinnenkloster wurde Tart nahe dem Stammkloster Citeaux in Burgund bereits 1125 gegründet. In der Folge entstanden in Frankreich und Deutschland zahlreiche weitere Niederlassungen, die vom Adel sehr gefördert wurden. Im Gegensatz zu den Männerklöstern befanden sich schon die frühen Nonnenklöster des Ordens in großen Ortschaften oder Städten. Die rechtliche Stellung der Frauenklöster war anfangs schwankend. Seit dem 13. Jahrhundert zählen sie definitiv zum Orden. Um 1600 wandten sich die Nonnen wieder dem katholischen Glauben zu, so dass hier im Zuge gegenreformatorischer Maßnahmen ein katholischer Propst installiert wurde.
[76] Collect: Versammlung oder Sammlung ?
[77] Posewitz, Wilhelm [ – ] Bürgermeister in Wernigerode.
[78] Obligation: Schuldverschreibung.
[79] Schatzherr: „eine obrigkeitliche Person, deren Pflicht es ist, gewisse Waaren und Lebensmittel zu besichtigen und den Preis derselben zu bestimmen; der Schätzmeister, und wenn es ein Glied des Rathes ist, in einigen Gegenden der Schätzherr, im Oberdeutschen der Schatzherr. Der Waarenschätzer, das heißt, der kaufmannische Waaren schätzt, der Fleischschätzer, Brodschätzer etc. Schätzer der Kaufmanns=Waaren auf dem Packhofe“ [nach KRÜNITZ, Encyklopädie, online verfügbar unter: kruenitz1.uni-trier.de].
[80] Altenhausen [LK Börde].
[81] Galgen: Ein Galgen (von althochd. Galgo „Baumast“) ist eine Vorrichtung zur Vollziehung der Todesstrafe durch den Henker. Er besteht aus zwei aufrecht stehenden Pfosten und einem Querholz darüber, bisweilen auch aus drei Pfosten mit Querhölzern oder aus einem Pfosten, in den ein Querholz rechtwinkelig eingelassen ist. Hier unterscheidet man zwischen Kniegalgen, Schnell-galgen, Soldatengalgen und Wippgalgen. Die Galgen befanden sich früher meist außerhalb der bewohnten Orte auf hohen Punkten (Galgenberg). Personen, die mit der Errichtung oder Ausbesserung eines Galgens beauftragt waren, galten ob dieser Tätigkeit als anrüchig. Deshalb versammelten sich vielerorts alle beteiligten Zünfte jenes Distrikts, für den der Galgen errichtet werden sollte. Der Richter reichte dann den ersten Stein für den Unterbau und behaute das zum Galgen bestimmte Holz, worauf alle Gewerke zusammen die Arbeit vollendeten. Manchmal wurden auch einzelne Personen durch das Los bestimmt. Galgen, die mit einer kreisförmigen Untermauerung versehen waren, auf der die Pfeiler mit den Querbalken standen, hießen Hochgericht. Sie galten zugleich als das Wahrzeichen der „hochnotpeinlichen Gerichtsbarkeit“ des betreffenden Gerichtsherrn. Die Exekution wurde so vollzogen, dass der Verurteilte mit dem Henker auf einer Leiter zu einem der Querhölzer emporsteigen musste, um an letzterem aufgeknüpft, dann aber durch Wegziehen der Leiter getötet zu werden. [wikipedia]
[82] Trossbuben (oder Trossjungen) wurden als Bedienung der unteren militärischen Chargen sowie zur Versorgung der Pferde und für die Beaufsichtigung der Viehherden eingesetzt. Sie stammten häufig aus den Soldatenfamilien, die den Heereszug im Tross begleiteten. Sie wurden oft misshandelt und von ihren Herrn sogar getötet, ohne dass Anklage erhoben wurde. Teilweise wurden sie auch aus Überlebensgründen von den Eltern Soldaten mitgegeben. Da die Trossbuben ökonomisch vollkommen abhängig und zudem schlecht versorgt waren, lassen sie sich häufig als Diebe nachweisen. Vielfach gerieten die 13 bis 15 Jahre alten Jungen als Trommlerbuben und Pferdejungen ins unmittelbare Kriegsgeschehen. Soweit sie eine Muskete bedienen konnten, konnten sie, falls erforderlich, auch im Kampf eingesetzt werden, was häufig bei spanischen Einheiten der Fall war. Trossbuben, die von ihren Herren schon bei der geringsten Verfehlung totgeschlagen werden konnten (NEBE, Drangsale, S. 134), waren teilweise nur sechs oder sieben Jahre alt, wenn sie zum Militär kamen oder von ihren Eltern dem Militär übergeben wurden, damit sie dort überleben konnten. Die Älteren wurden bei der Reformation der Bagage auch als Knechte in die Feldartillerie gesteckt, wenn sie dazu brauchbar erschienen (DAMBOER, Söldnerkapitalismus, S. 259). Sie wurden als Kindersoldaten und Soldatenjungen missbraucht, die teilweise unter elendsten Umständen umkamen, von erbitterten Bauern erschlagen wurden oder von ihren Herren zurückgelassen wurden. Vgl. die Pfarrchronik von Vach (10./20.10.1632), GROßNER; HALLER, Zu kurzem Bericht, S. 27: „Ein Soldatenjung [Offiziersbursche] aus Holland, hat vom Pfarrhof nicht gewollt. Wird ohne Zweifel mit seinem Herrn sein Quartier im Pfarrhof gehabt haben, hab ihm Brot und frisches Wasser gereicht, denn er sonsten nichts trinken wollen, auch nichts zu bekommen gewesen; stirbt auf der Miststatt“. Vgl. auch die Erlebnisse des 16jährigen Curd Kästener, der sich mit 12 Jahren hatte der kaiserlichen Armee anschließen müssen und am 25.11.1641 der Hungersnot in seinem Regiment nach Erfurt entfloh. BERG, Regulating war, S. 15f.; HAHN, Kriegserfahrungen, S. 9-14. Sie unterlagen dem harten Militärstrafrecht.
[83] mit Ruten streichen: Auspeitschen als Züchtigungsstrafe bei erstem leichtem Diebstahl nach Art. 158 der „Constitutio Criminalis Carolina“ [CCC, S. 44], auch bei Hurerei, zusammen mit Prangerstehen und Landesverweisung.
[84] Ohr abschneiden: Im Mittelalter war das Ohrenabschneiden häufig mit der Verweisung verbunden gewesen. Bei Diebstahl, Gotteslästerung und Tragen verbotener Waffen wurde meist ein Ohr abgeschnitten und an den Galgen genagelt. Das Abschneiden eines Ohres galt als Strafe und Warnung zugleich, in Zukunft ein ordentliches Leben zu führen.
[85] Köpfen: Die Enthauptung im Gegensatz zum Erhängen am Galgen nicht als ehrenrührige Todesstrafe. Standespersonen war die Hinrichtung in aufrecht kniender Haltung mit dem Schwert vorbehalten, während niedere Ränge auf einem hölzernen Richtblock mit dem Beil enthauptet wurden. Das Hinrichtungsritual als „Theater des Schreckens“ mit Schwert (=> Richtschwert), Galgen (=> Galgen) und Rad (=> rädern) galt als gesellschaftliches Reinigungsritual und als vom Rat inszeniertes Abschreckungsmittel bei Eigentumsdelikten, Raub, Totschlag, Vergewaltigung, Religionsdelikten und Hexerei. Die Todesurteile wurden in Ausnahmefällen etwa in Fällen politischer Justiz in der Stadt vollstreckt. Der Delinquent/die Delinquentin sollte in angemessener Kleidung ruhig und gefasst in den Tod gehen. Erwünscht war eine Mahnung an die Menge sowie ein Gebet für das Seelenheil. Wichtig war der Unterschied zwischen einer ehrenhaften Leibesstrafe – und damit einem anschließenden ehrlichen Begräbnis – und einer unehrenhaften Leibesstrafe. Auch der Scharfrichter hatte seine Rolle bei diesem Ritual. Missrichtungen führten dagegen zu Tumulten und einer massiven Bedrohung des Scharfrichters, weil hier das vorzuführende moralische Exempel gescheitert war. Außerdem sah man in Missrichtungen (=> Missrichtung) ein Gottesurteil, der Delinquent wurde in der Regel begnadigt. Zu den Missrichtungen vgl. IRSIGLER; LASSOTTA, Bettler und Gaukler, S. 249f. Teilweise wurde der Delinquent auch begnadigt, wenn eine Frau Fürsprache einlegte und ihn heiratete. Vgl. die Erinnerungen des Pfarrers Klingsporn; NÜCHTERLEIN, Wernigerode, S. 229, 81..
[86] Ludwig I., Fürst von Anhalt-Köthen [17.6.1579 Dessau – 7.1.1650 Köthen].
[87] Profos: Militärischer, vielfach gefürchteter Offiziant, der die Einhaltung der Kriegsbestimmungen und Befehle, der Lager- und Marschordnung überwachte. Der Profos zeigte die Zuwiderhandelnden beim Befehlshaber an, nahm sie fest, stellte sie vor Gericht und vollstreckte das vom Kriegsrichter (dem => Auditeur) gesprochene Urteil. Er ersetzte dadurch den Scharfrichter, der nicht immer beim Regiment vorhanden war. Dabei unterstützten ihn Knechte und Gehilfen wie der => Profoslieutenant. Es gab einen Profos für jedes einzelne Regiment und einen => Generalprofos (auch „Generalgewaltiger“ genannt) für die gesamte Armee. Der Profos hatte ferner die Aufgabe, hereingebrachte Lebensmittel vor den Obristleutnant zu bringen, der die Preise für die Marketender festlegte. Er überwachte gegen eine Abgabe der Händler oder Marketender den Lagermarkt. Zudem oblagen ihm die Einrichtung der Latrinen, die Reinigung des Feldlagers von Mist und die Entfernung toter Tiere. Einmal pro Woche wenigstens sollten die Quartiere durch die Huren und Trossbuben gereinigt werden, zur Aufsicht wurde auch der Hurenwebel (aufsichtsführender Organisator des umfangreichen Trosses) herangezogen. Mitglieder des Trosses, der immer wieder Gesindel aller Art anlockte, konnten zudem zu den kräftezehrenden und verachteten Schanzarbeiten und anderen Hilfsarbeiten herangezogen werden. Hier hatte der ihm unterstellte Hurenwebel die Aufsicht. Diese wichtige Funktion war für einfache Soldaten die wohl einzige militärische Aufstiegsmöglichkeit. Der Hurenwebel besaß einen eigenen Leutnant als Stellvertreter und wurde zudem vom Rumormeister unterstützt. Der Profos und dessen Leutnant sollten zudem beim Verlassen der Quartiere die Huren und die Trossbuben aus den Quartieren vertreiben und dafür sorgen, dass alle Feuer gelöscht waren. Seine Aufgabe war es auch, die Gefangenen hinter dem Regiment herzuführen. Er war auf Grund seiner Funktion außerordentlich unbeliebt und den Angriffen der Soldaten ausgesetzt; RUDERT, Kämpfe um Leipzig, S. 64. Der Profos erhielt monatlich 30 fl. (Kavallerie) bzw. 60 fl. (Fußtruppen). LAHRKAMP, Kölnisches Kriegsvolk; Schwedisches Kriegs-Recht; BERG, Administering justice, S. 6.
[88] Obrist: I. Regimentskommandeur oder Regimentschef mit legislativer und exekutiver Gewalt, „Bandenführer unter besonderem Rechtstitel“ (ROECK, Als wollt die Welt, S. 265), der für Bewaffnung und Bezahlung seiner Soldaten und deren Disziplin sorgte, mit oberster Rechtsprechung und Befehlsgewalt über Leben und Tod. Dieses Vertragsverhältnis mit dem obersten Kriegsherrn wurde nach dem Krieg durch die Verstaatlichung der Armee in ein Dienstverhältnis umgewandelt. Voraussetzungen für die Beförderung waren (zumindest in der kurbayerischen Armee) richtige Religionszugehörigkeit (oder die Konversion), Kompetenz (Anciennität und Leistung), finanzielle Mittel (die Aufstellung eines Fußregiments verschlang 1631 in der Anlaufphase ca. 135.000 fl.) und Herkunft bzw. verwandtschaftliche Beziehungen (Protektion). Der Obrist ernannte die Offiziere. Als Chef eines Regiments übte er nicht nur das Straf- und Begnadigungsrecht über seine Regimentsangehörigen aus, sondern er war auch Inhaber einer besonderen Leibkompanie, die ein Kapitänleutnant als sein Stellvertreter führte. Ein Obrist erhielt in der Regel einen Monatssold von 500-800 fl. je nach Truppengattung. Daneben bezog er Einkünfte aus der Vergabe von Offiziersstellen. Weitere Einnahmen kamen aus der Ausstellung von Heiratsbewilligungen, aus Ranzionsgeldern – 1/10 davon dürfte er als Kommandeur erhalten haben – , Verpflegungsgeldern, Kontributionen, Ausstellung von Salvagardia-Briefen – die er auch in gedruckter Form gegen entsprechende Gebühr ausstellen ließ – und auch aus den Summen, die dem jeweiligen Regiment für Instandhaltung und Beschaffung von Waffen, Bekleidung und Werbegeldern ausgezahlt wurden. Da der Sold teilweise über die Kommandeure ausbezahlt werden sollten, behielten diese einen Teil für sich selbst oder führten „Blinde“ oder Stellen auf, die aber nicht besetzt waren. Auch ersetzten sie zum Teil den gelieferten Sold durch eine schlechtere Münze. Zudem wurde der Sold unter dem Vorwand, Ausrüstung beschaffen zu müssen, gekürzt oder die Kontribution unterschlagen. Vgl. BELLINCKHAUSEN; TEGEDER; KREIENBRINK, S. 277: „Wir burger mußen alle wochen unse contribution zahlen, die obristen nehmmens geldt zu sich, und die gemeinen soldaten mußen hunger leyden“. Der Austausch altgedienter Soldaten durch neugeworbene diente dazu, ausstehende Soldansprüche in die eigene Tasche zu stecken. Zu diesen „Einkünften“ kamen noch die üblichen „Verehrungen“, die mit dem Rang stiegen und nicht anderes als eine Form von Erpressung darstellten, und die Zuwendungen für abgeführte oder nicht eingelegte Regimenter („Handsalben“) und nicht in Anspruch genommene Musterplätze; abzüglich allerdings der monatlichen „schwarzen“ Abgabe, die jeder Regimentskommandeur unter der Hand an den Generalleutnant oder Feldmarschall abzuführen hatte; Praktiken, die die obersten Kriegsherrn durchschauten. Zudem erbte er den Nachlass eines ohne Erben und Testament verstorbenen Offiziers. Häufig stellte der Obrist das Regiment in Klientelbeziehung zu seinem Oberkommandierenden auf, der seinerseits für diese Aufstellung vom Kriegsherrn das Patent erhalten hatte. Der Obrist war der militärische ‚Unternehmer‘, die eigentlich militärischen Dienste wurden vom Major geführt. Das einträgliche Amt – auch wenn er manchmal „Gläubiger“-Obrist seines Kriegsherrn wurde – führte dazu, dass begüterte Obristen mehrere Regimenter zu errichten versuchten (so verfügte Werth zeitweise sogar über 3 Regimenter), was Maximilian I. von Bayern nur selten zuließ oder die Investition eigener Geldmittel von seiner Genehmigung abhängig machte. Im April 1634 erging die kaiserliche Verfügung, dass kein Obrist mehr als ein Regiment innehaben dürfe; ALLMAYER-BECK; LESSING, Kaiserliche Kriegsvölker, S. 72. Die Möglichkeiten des Obristenamts führten des Öfteren zu Misshelligkeiten und offenkundigen Spannungen zwischen den Obristen, ihren karrierewilligen Obristleutnanten (die z. T. für minderjährige Regimentsinhaber das Kommando führten; KELLER, Drangsale, S.388) und den intertenierten Obristen, die auf Zeit in Wartegeld gehalten wurden und auf ein neues Kommando warteten. Zumindest im schwedischen Armeekorps war die Nobilitierung mit dem Aufstieg zum Obristen sicher. Zur finanziell bedrängten Situation mancher Obristen vgl. dagegen OMPTEDA, Die von Cronberg, S. 555. Da der Obrist auch militärischer Unternehmer war, war ein Wechsel in die besser bezahlten Dienste des Kaisers oder des Gegners relativ häufig. Der Regimentsinhaber besaß meist noch eine eigene Kompanie, so dass er Obrist und Hauptmann war. Auf der Hauptmannsstelle ließ er sich durch einen anderen Offizier vertreten. Ein Teil des Haupt-mannssoldes floss in seine eigenen Taschen. Ertragreich waren auch Spekulationen mit Grundbesitz oder der Handel mit (ge-stohlenem) Wein (vgl. BENTELE, Protokolle, S. 195), Holz, Fleisch oder Getreide. II. Manchmal meint die Bezeichnung „Obrist“ in den Zeugnissen nicht den faktischen militärischen Rang, sondern wird als Synonym für „Befehlshaber“ verwandt. Vgl. KAPSER, Heeresorganisation, S. 101ff.; REDLICH, German military enterpriser; DAMBOER, Krise; WINKELBAUER, Österreichische Geschichte Bd. 1, S. 413ff.
[89] Fass Bier: 50 Liter (Wernigerode).
[90] Mariengroschen: 2 Kreuzer = 8 Pfennige.
[91] Sommerschenburg, heute Ortsteil der Gemeinde Sommersdorf [LK Börde].
[92] Bloch: Stein.
[93] losgetrickelt: losgelöst.
[94] Schaalmeister: Schaafmeister ?
[95] austreten: verschwinden.
[96] handfest machen: gefänglich einziehen.
[97] Mansfeld-Vorderort zu Bornstädt, Wolfgang III. von; Graf, Feldmarschall [1575 – 15.5.1638] Kaiserlicher Feldmarschall und Statthalter in Magdeburg. Vermutlich wollte er das Magdeburger Burggrafenamt, das dem Kurfürsten von Sachsen zustand, in seiner Familie erblich machen. Von Mansfeld-Vorderort war aus kursächsischen Diensten in kaiserliche übergetreten. Obwohl er erst 1627 in Prag zum Katholizismus konvertierte, wurde er doch sogleich zum Geheimen Rat ernannt. Er war ein erklärter Gegner Wallensteins. ADB 20, Leipzig 1884, S. 212ff.; DITTMAR, Beiträge, S. 233.
[98] lauter: ganz.
[99] Darlingerode [LK Harz]. Während des Dreißigjährigen Krieges lagen ab 1625 mehrfach zuerst kaiserliche Truppen im Dorf, sowohl Wallensteinsche als auch Teile von Tillys ligistischem Heer, später zogen die Schweden durch. Kontributionen und Brandschatzungen ließen die Bevölkerung verarmen; die Dörfler flohen mehrere Male beim Anrücken von Truppen in die nahen Wälder. Die Harzschützen, die sich gegen die plündernde Soldaten zur Wehr setzten, waren in der Nordharzer Gegend sehr aktiv; eine Teilnahme von Darlingerödern ist zwar nicht verbürgt, wohl aber auffällige tage-, wochen- bis monatelange Abwesenheiten einiger Einwohner, so dass Kontakte mit den Harzschützen sehr wahrscheinlich sind. [wikipedia: Darlingerode] FLOHR, Ein Dorf im Spiegel der Jahrhunderte, S. 61-75.
[100] Fastelabend: Fassnachtdienstag. Die Fassnacht war im damaligen Verständnis die letzte entsprechend genossene Fresszeit vor dem Beginn der Fastenzeit.
[101] Intercessionalien: Fürsprachen, Vermittlungen.
[102] Wolfgang Georg zu Stolberg-Stolberg, Graf [20.12.1582 – 11.9.1631] Regierte von 1612-1631, verheiratet seit 1.10.1613 mit Barbara Maria Gräfin von Stolberg [1596 – 1636]. Mit ihm erlischt die Rheinlinie. Vgl. ZEITFUCHS, Stolberg, S. 55.
[103] indianische Hühner: Truthähne.
[104] Nagel, Näglein: Gewürznelke.
[105] Safran: Die Safranpflanze („crocus sativus“) ist ein Schwertliliengewächs, im Mittelalter und der Frühen Neuzeit als Gewürz zusammen mit Ingwer und Pfeffer sehr beliebt, wenn auch das teuerste Gewürz überhaupt und damit eine lukrative Handelsware. Im 15. Jahrhundert war das Fälschen von Safran so verbreitet, dass sogar die Todesstrafe darauf stand. 1551 erließ sich der Reichstag zu Augsburg ein Gesetz gegen „geschmierten“, d. h. gefälschten Safran. Safran wurde auch als Heilmittel eingesetzt, da er als verdauungsfördernd gilt. Zudem wurde er gegen Haut- und Augenkrankheiten, gegen die Pest und zur verbotenen Empfängnisverhütung verwendet.
[106] Scholle: Die Scholle oder der Goldbutt (Pleuronectes platessa) gehört zur Ordnung der Plattfische (Pleuronectiformes) und zur Familie der Schollen. Der Name wurde erst im 16. Jahrhundert geprägt, im Gegensatz zu Scholle (Grund), gefangen im Ostsee- und Nordseebereich.
[107] Hutzucker: Zucker in Form eines Hutes. Das waren große Stücke Kristallzucker in Kegelform, die nach dem Erkalten der Zuckermasse steinhart waren. Ein Zuckerhut kam in Größen bis zu 1,50 m Höhe auf den Markt und war teuer.
[108] textlog.de/medizin-hirschhorn.html: „Hirschhorn, geraspeltes, Cornu cervi. Die Gallerte davon (Gelatina cornu cervi raspati) wird so bereitet, dass man drei Lot Hirschhorn mit drei Pfund Wasser bis auf zwei oder anderthalb Pfund einkocht und Zitronensaft und Zucker zusetzt. Sie ist ein gutes Nährmittel bei Abzehrungen. (S. Mittel, eiweißartige.) Der Hirschhornspiritus (Spiritus cornu cervi rectificatus), so wie das stinkende Hirschhornöl (Oleum animale foetidum s. Cornu cervi foetidum) wendet unser Landmann äußerlich zum Einreiben in alte Gichtknoten und gegen die Gelenksteifheit an. Der Dunst des Öls, täglich eingeatmet, verbessert den Auswurf und mäßigt den Husten schwindsüchtiger Personen“.
[109] Neunauge: Fischähnliche Wirbeltiere mit aalartigem, langgestrecktem Körper, der mit einem flossenartigen Rücken- und Schwanzsaum besetzt ist. Neunaugen wurden in der Küche als Lampreten ähnlich wie Aal zubereitet. „Neunauge“ geht auf eine falsche historische Beschreibung zurück, weil man neben dem eigentlichen Auge auch die Nasenöffnung und die sieben seitlichen Kiemenspalten als Augen ansah.
[110] Supplikation: Bitte (Supplik), Bittschrift. Diese Bittschriften wurden zumeist, wenn überhaupt, dann nur mit großen Vorbehalten sowohl von den Kriegsparteien als auch von den Landesherren angenommen, da die Schadensmeldungen in der Regel überhöht waren. Riksarkivet Stockholm Skr C G Wrangel E 8267 (Entwurf): Erklärung, 1648 X 22 (n. St.):Wrangel übte darin Skepsis gegenüber den ständig einlaufenden Schadensmeldungen: „Solchem kann man allerdings nicht glauben geben, sintemahlen wißende, da ein huhn oder dergleichen was geringers etwan durch den soldaten weggenommen wirdt, der einwohner bald daraus einen ochsen oder kuhe, oder sonsten etwas großes machen thut“. Zur Bedeutung des Supplizierens vgl. BLICKLE, Laufen gen Hof; KLEINHAGENBROCK, Einquartierung, S.182f. der Schmalkaldener Chronist Pforr; WAGNER, Pforr, S. 148: „Obbemelte beyde commissarien, Wechmar und D. Kolb, haben in wehrenter zeit bey die 400 thlr verzehrt, so die armen bürger und bauren bezahlen müßen, auch, so lang sie hier geweßen, etliche hundert supplicationes von den unterthanen angenommen, die gebühr darvon in beutel gesteckt […], aber niemand geholffen“.
[111] vertiert: übertragen.
[112] Gemeint ist hier Melancholie: „Im Mittelalter wurde die Melancholie als Mönchskrankheit bekannt. Sie wird auf Lateinisch als Acedia bezeichnet und ist ein häufiges Thema in der theologischen Literatur, zum Beispiel bei Thomas von Aquin in der Summa Theologica (vgl. II/II, qu. 35). Die früheste Beschreibung des Acedia-Phänomens stammt vermutlich von Evagrius Ponticus, der als frühchristlicher Anachoret in Ägypten lebte. Beschrieben wird unter anderem die Heimsuchung durch den Dämon des Mittags. Johannes Cassian übernimmt Evagrius‘ Ansätze und gibt diese an Thomas von Aquin weiter. Sie galt gleichzeitig als eine der sieben Todsünden. Im Protestantismus des 16. Jahrhunderts erfuhr die Melancholie dann eine gewisse Umdeutung: Sie galt nicht mehr in erster Linie als zu vermeidende Sünde, sondern als eine Versuchung des Teufels, die der Gläubige wie eine Prüfung bestehen müsse. Gerade das zeitweise Versinken in Verzweiflungszuständen erschien vor diesem Hintergrund als eine Bestätigung der Ernsthaftigkeit des eigenen Glaubens. Auf der anderen Seite erkannte man auch die zerstörerische Kraft der Melancholie und empfahl als Therapie geistliche Mittel wie Gebete oder geistliche Lieder und weltliche Zerstreuung durch Musik (nach dem biblischen Vorbild von David und Saul) und heitere Gesellschaft. Dabei spielte auch die persönliche Erfahrung Luthers, der häufig von Schwermut überfallen wurde, eine stilbildende Rolle. Luther und seine Nachfolger aus der protestantischen Orthodoxie des 16. Jahrhunderts haben sich in zahlreichen Trostschriften mit der Melancholie auseinandergesetzt. In der ab der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts einsetzenden Propaganda der Gegenreformation wurde die Melancholie deswegen häufig als typische Krankheit der Protestanten bezeichnet“. [wikipedia] Hippokrates erklärte die Melancholie als Überschuss an schwarzer, verbrannter oder schwarzer Galle (in der Milz und in den Hoden produziert), der sich ins Blut ergießt. Die Melancholie war nach seiner Auffassung, die bis ins 17. Jahrhundert dominierend bleib, eines der vier Temperamente des Menschen. Die „Schwermuth“ galt als einziger Grund für ein kirchliches Begräbnis von Selbstmördern, die in den Zeugnissen erwähnt werden, z. B. HAPPE I 453 r.
[113] Inäqualität: Ungleichheit.
[114] ponderieren: erwägen.
[115] Patron: (Schutz-)Herr, Beschützer, Verteidiger.
[116] Success: Glück, Erfolg.
[117] Favor: Gunst, Glück, Gefallen.
[118] aufwarten: einen Besuch abstatten.
[119] deputiert: abgeordnet.
[120] Generaloberst: gemeint ist hier Feldmarschall: Stellvertreter des obersten Befehlshabers mit richterlichen Befugnissen und Zuständigkeit für Ordnung und Disziplin auf dem Marsch und im Lager. Dazu gehörte auch die Organisation der Seelsorge im Heer. Die nächsten Rangstufen waren Generalleutnant bzw. Generalissimus bei der kaiserlichen Armee. Der Feldmarschall war zudem oberster Quartier- und Proviantmeister. In der bayerischen Armee erhielt er 1.500 fl. pro Monat, in der kaiserlichen 2.000 fl., die umfangreichen Nebeneinkünfte nicht mitgerechnet, war er doch an allen Einkünften wie Ranzionsgeldern, den Abgaben seiner Offiziere bis hin zu seinem Anteil an den Einkünften der Stabsmarketender beteiligt.
[121] Schweinfurt; HHSD VII, S. 686ff.
[122] Ulm; HHSD VI, S. 808ff.
[123] Leopold V. von Österreich, Erzherzog [9.10.1586-13.9.1632] Bruder Kaiser Ferdinands II., Bischof von Passau und Straßburg (bis 1625), Statthalter von Tirol und Vorderösterreich.
[124] anstrengen: angreifen.
[125] Schlick zu Passaun und Weißkirchen, Heinrich; Graf, Feldmarschall [1580 – 5.1.1650] kaiserlicher Obrist, Geheimer Rat und Feldmarschall.
[126] Magdeburg; HHSD XI, S. 288ff.
[127] HALLWICH, Gestalten aus Wallenstein’s Lager II. Johann Aldringen; DUCH, Aldringen, S. 188-190. Online verfügbar unter: mdz10.bib-bvb.de.
[128] Gröningen [LK Börde].
[129] Clerisei: (mittellat. clericia) Kleriker, Angehörige des geistlichen Standes.
[130] Feldprediger, Feldkaplan: Im Codex Iuris Canonici (c. 564-572 CIC) bezeichnet der Begriff Kaplan einen Geistlichen mit einem extraterritorialen Seelsorgebereich für einen Sonderbereich, hier der Armee. Maximilian I. von Bayern hat für seinen Generalvikar Benedikt Rauh am 5.4.1642 eine ausführliche Instruktion erlassen; FRISCH, Rauh, S. 156f.: „Insbesondere sorge der von uns bestellte Generalvicar, dass die Feldcapellane, sowohl bei Infanterie als Reiterei, ein exemplarisches Leben führen. Wenn sie scandalös sich aufführen oder zur Verwaltung der Sacramente weniger tauglich erfunden werden, soll er sie verbessern, strafen, oder nach Fund der Sache vom Heere entfernen. Er soll drei oder vier Verkündiger des Wortes Gottes mit sich zum Heere bringen; sorgen, dass morgens und abends die Gebetsstunden eingehalten werden, zu welchen mit Trompeten etc. ein Zeichen gegeben wird; dan an Sonn- und Feiertagen bei jeder Legion öffentlich Messe gelesen und von den Capellanen Predigten gehalten werden, namentlich dass zur österlichen Zeit die Soldaten ihre Sünden bekennen, und zur heil. Communion gehen, wenn auch ihre Officiere andersgläubig sein sollten. Anstalten soll er treffen, dass kein Soldat, der tödtlich verwundet oder sonst gefährlich darniederliegt, der heil. Wegzehrung beraubt werde. Hauptsächlich soll er darauf sehen, dass die Officiere und Soldaten der Legionen die Concubinen und gemeinen Dirnen von sich entfernen oder zur Ehe nehmen; wenn sie mit guten Worten nicht gehen wollen, soll er sie öffentlich hinauswerfen lassen. Dann soll er dafür sorgen, dass er die schrecklichen Gotteslästerungen und Schwüre sowohl bei Officieren als Soldaten ausrotte, sowie die lasciven Worte. Zu diesem Zwecke soll er durch seine Feldcapellane alle und jeden in Glaubenssachen unterrichten und ihre Kinder im Katechismus belehren lassen. Wenn hierin der Capellan nichts ausrichte, soll er es dem Führer der Legion berichten, wenn dieser nichts zu Stande bringe, soll der Generalvicar es dem Obersten melden und wenn auch dieses nichts fruchte, die Hilfe des Generals in Anspruch nehmen. Nicht weniger bemühe er sich, dass die Feindschaften sowohl unter Hohen als Gemeinen auf jede Art und Weise beigelegt werden. Er selbst soll an Sonn- und Feiertagen vor dem Generalstab predigen. Damit dieses Alles besser vollzogen werde, soll er alle 8 oder wenigstens 14 Tage seine Capellane berufen und einem nach dem andern ausfragen und hören, was für Laster in dieser oder jener Legion grassieren, damit sie in Zukunft geheilt werden können. Endlich soll der General-Vicar so viel als möglich darauf sehen, dass die Kranken und tödtlich Verwundeten zur Reue, Beichte, Communion und wenn es nothwendig zur letzten Oelung disponirt werden; sollten Viele oder Wenige dem Heer nicht folgen können, soll er Geistliche zurücklassen, welche ihnen in ihren letzten Nöthen beistehen“. Eine ähnliche Funktion dürften auch die Feldprediger in schwedischen Armee gehabt haben, die die einzelnen Regimenter begleiteten. Vgl. dazu auch BRENDLE; SCHINDLING, Geistlichkeit.
[131] Calbe/Saale [Salzlandkr.]; HHSD XI, S. 65ff.
[132] Prätension: Beschönigung.
[133] restiert: schuldet.
[134] ungarisch prügeln: heftig prügeln; gemeint war hier wahrscheinlich die sogenannte Bastonade oder Bastinado, eine uralte Prügelstrafe, insbesondere in nahöstlichen und fernöstlichen Ländern. Geschlagen wird, meist mit einer Rute oder einem Stock, auf die nackten Fußsohlen des Opfers, dessen Füße an einen Balken geschnürt und mit ihm emporgehoben werden.
[135] Kaplan: katholischer Priester in den ersten Jahren nach seiner Weihe, in denen er in der Regel einem Pfarrer unterstellt ist und noch keine Alleinverantwortung für eine Pfarrei trägt.
[136] auflaufen: gewaltsam öffnen.
[137] Korrekt wäre Passaun.
[138] Mühlingen, Teil der Grafschaft Barby-Mühlingen. => Großmühlingen, heute Ortsteil von Bördeland [Salzlandkreis].
[139] NÜCHTERLEIN, Wernigerode, S. 73ff. (eine wichtige Quellensammlung zur Geschichte Wernigerodes und seiner Umgebung, die Informationen über Militärs enthält, die sonst nicht zu finden sind). Der Hg. dankt Herrn Peter Nüchterlein für die Erlaubnis zum Abdruck dieses Textteils.
[140] Schöningen [Kr. Helmstedt]; HHSD II, S. 419f.
[141] Clara von Braunschweig-Lüneburg-Celle [16.1.1571 – 18.7.1658] Seit 1593 zweite Ehefrau von Wilhelm I., Graf von Schwarzburg-Frankenhausen [4.10.1534 − 30.9.1598], Tochter Herzog Wilhelms von Braunschweig-Lüneburg, Schwester Herzog Georgs von Braunschweig-Lüneburg und „Fürstin von Heringen“. Vgl. KUHLBRODT, Clara von Heringen; sowie die Erwähnungen bei HAPPE; mdsz.thulb.uni-jena.de.
[142] CUNO, Memorabilia Schenengensia, S. 105.
[143] Quedlinburg [Kr. Quedlinburg]; HHSD XI, S. 374f.
[144] ablegieren: abordnen.
[145] Saalfeld [LK Saalfeld-Rudolstadt]; HHSD IX, S. 369ff.
[146] BLÖTHNER, Apocalyptica, S. 44.
[147] Exaudi: 6. Sonntag nach Ostern.
[148] Golddukat: 2 Reichstaler = 48 Groschen.
[149] Rosenobel: Englische Goldmünze, auf deren Kehrseite eine Rose geprägt ist. Ab der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts entspricht 1 Rosenobel 7 Talern.
[150] 2 gute Groschen = 12 Pfennige.
[151] proponieren: vorgestellt, vorgeschlagen.
[152] Kroatenland: Wahrscheinlich bezieht sich dieser Begriff auf das Gebiet des heutigen Slowenien. => Kroaten.
[153] adjungieren: beiordnen.
[154] Schenkung: Derartige „Schenkungen“ oder auch „Discretionen“ waren von Anfang des Dreißigjährigen Krieges an zumeist erzwungene oder von vornherein erwartete Leistungen in Geld- oder Sachwerten an die Offiziere einer Einheit, die den Stadt- oder Gemeindehaushalt je nach Umständen erheblich belasten konnten. Diese mehr oder minder freiwilligen „Verehrungen“ waren zur Abwendung von Einquartierungen oder zur Durchführung rascher Durchzüge gedacht. Sie waren je nach Rang des zuständigen Offiziers gestaffelt und wurden von diesen als fester Bestandteil ihres Einkommens betrachtet, zumal Soldzahlungen nicht selten ausblieben. Vgl. ORTEL, Blut Angst Threnen Geld, der diese Euphemismen für Erpressungen, erwartete oder erzwungene „Verehrungen“ etc. auflistet.
[155] ohne: außer.
[156] Ries: 20 Buch Papier. Ein Buch Schreibpapier hat 24 Bogen, ein Buch Druckpapier 25 Bogen, je nach Qualität eine doch recht teuere „Verehrung“ an einquartierte oder durchziehende Offiziere.
[157] Korporal: Unteroffiziersdienstgrad. Der Corporal hatte die regelmäßige Aufsicht über einen Teil der Compagnie (die Korporalschaft, den Zug). Er führte eine Ausbildungsgruppe von Soldaten und war zuständig für die Verhinderung von Desertionen, die Anleitung und Kontrolle der Wachposten und die exakte Ausführung der Befehle im Gefecht. In Friedenszeiten fungierte er zudem als Werber. Sein Sold betrug monatlich 12 fl., das entsprach dem Jahreslohn eines Bauernknechts bei ausreichendem Arbeitskräfteangebot. SCHLÖGL, Bauern, S. 157.
[158] Gefreiter: Der Gefreite war ursprünglich ein erfahrener und zuverlässiger Söldner, der von den niederen und schweren Diensten (wie etwa der gewöhnlichen Schildwache) ‚befreit‘ war. Die Gefreiten waren für die Aufstellung der Wachen zuständig. Ihnen oblag die Aufsicht über Arrestanten, sie übermittelten militärische Verfügungen und Befehle und mussten im Gefecht die am meisten gefährdeten Stellungen beziehen. Er erhielt 7 fl. 30 kr. Monatssold.
[159] Knecht: dienstgradloser einfacher Soldat. Er hatte 1630 monatlich Anspruch auf 6 fl. 40 kr. Ein Bauernknecht im bayerischen Raum wurde mit etwa 12 fl. pro Jahr (bei Arbeitskräftemangel, etwa 1645, wurden auch 18 bis 24 fl. verlangt) entlohnt. Doch schon 1625 wurde festgehalten; NEUWÖHNER, Im Zeichen des Mars, S. 92: „Ihme folgete der obrist Blanckhardt, welcher mit seinem gantzen regiment von 3000 fueßknechte sechß wochen lang still gelegen, da dann die stath demselben reichlich besolden muste, wovon aber der gemeine knecht nicht einen pfennig bekommen hatt“.
[160] Marketender: Dem Heer nachziehende Händlerin oder Händler, der oder die vom Obristen befugt war, den Soldaten Lebensmittel zu verkaufen. Dafür hatten sie ihm z. B. von jedem Eimer Wein oder Bier 2 Maß für die Küche abzugeben und zumeist 10 Prozent ihrer Einkünfte. Sie waren auch zum Kranken- und Munitionstransport verpflichtet, falls die üblichen Rüstwagen nicht ausreichten. Marketender und Marketenderinnen handelten auch mit Beutegut, wobei das Beutegut weit unter Wert angenommen wurde. Die Frauen unter ihnen waren nicht nur Händlerinnen, sondern auch Helferinnen, Partnerinnen, Krankenschwestern, häufig Prostituierte. Bei einem im April 1634 in Dinkelsbühl einquartierten Regiment fanden sich bei 950 Soldaten 11 Marketender, aber 26 Marketenderinnen; HEILMANN, Kriegsgeschichte Bd. 2, S. 465 Anm. Obwohl bekannt war, dass kein Heer ohne Marketender existieren konnte, standen diese – wie die übrigen Trosser – in schlechtem Ansehen: Sie traten als Geldverleiher auf, und so mancher Söldner war bei ihnen verschuldet. Sie standen zudem in dem Ruf, für die materielle Not vieler Söldner verantwortlich zu sein, indem sie bei Nahrungsmittelknappheit und Ausbleiben der Soldzahlungen das Heer verließen und ihre Fahne in den Wind besserer Märkte hängten. Gewalttätige Übergriffe auf die Marketender durch Bauern, Bürger und eigene Soldaten waren vielfach die Folge, zumal diese z. T. zum 15fachen Preis Waren an die Bürger verkauften, die von diesen auf den Druck einquartierter Soldaten hin erstanden werden mussten (BRAUN, Markredwitz, S. 45). Vgl. KLUGE, Hofer Chronik, S. 163: „Das rauben und plündern war um diese zeit [April 1640] sehr arg, wie dann die kayßerlichen ihre eigenen marquetener, so zu Culmbach wein und vieh erhandelt und erkauft, ganz ausgeplündert, auch zugleich ein 800 thaler darzu an geld abgenommen“. Häufig wurden sie als Spione verdächtigt. Auch Juden wurden als Marketender geduldet; LOTZE, Geschichte, S. 80f. Die Aussicht auf großen Gewinn ließ Zivilisten oder Amtsträger (vgl. PFEILSTICKER, Tagebuch) häufig für einige Zeit zu Marketendern werden. REDLICH, Marketender; Continuatio Der Siegreichen Victorien, S. 4f.
[161] Stralsund [Kr. Stralsund]; HHSD XII, S. 292ff.
[162] KRAUSE, Urkunden Bd. 1, S. 319.
[163] Hasserode, Ortsteil von Wernigerode (Eingemeindung: 1907).
[164] billig: hier gerecht.
[165] Silstedt, Ortsteil von Wernigerode (Eingemeindung: 1994).
[166] Minsleben, Ortsteil von Wernigerode (Eingemeindung: 1994).
[167] Langeln [LK Harz]; HHSD XI, S. 254.
[168] Diele: unbekannter Begriff. Wahrscheinlich Taler ?
[169] Revers: Erklärung, schriftliche Verpflichtung.
[170] Exekution: (notfalls gewaltsame) Umsetzung von Bestimmungen und Auflagen; Zwangsvollstreckung, Zwangseintreibung von Kontributionen. Das Militär setzte dafür gern die allseits gefürchteten Kroaten ein; LEHMANN, Kriegschronik, S. 68f., 70. Die Bürger hatten den zwangsweise bei ihnen einquartierten Soldaten Wohnung, Holz, Licht, Salz und Lager zu gewähren und für jeden Tag und Mann z. B. ein Kopfstück zu zahlen, bei halben Tagen dementprechend ein halbes Kopfstück und bei einzelnen Stunden im Verhältnis weniger, bis die fragliche Summe aufgebracht war.
[171] assignieren: zuteilen, zuweisen.
[172] dominieren: herrschen, beherrschen, hier: hausen.
[173] Bagage: Gepäck; Tross. „Bagage“ war die Bezeichnung für den Gepäcktrain des Heeres, mit dem die Soldaten wie Offiziere neben dem Hausrat auch ihre gesamte Beute abtransportierten, so dass die Bagage während oder nach der Schlacht gern vom Feind oder von der eigenen Mannschaft geplündert wurde. Auch war man deshalb darauf aus, dass in den Bedingungen bei der freiwilligen Übergabe einer Stadt oder Festung die gesamte Bagage ungehindert abziehen durfte. Manchmal wurde „Bagage“ jedoch auch abwertend für den Tross überhaupt verwendet, die Begleitmannschaft des Heeres oder Heeresteils, die allerdings keinen Anspruch auf Verpflegungsrationen hatte; etwa 1, 5 mal (im Anfang des Krieges) bis 3-4mal (am Ende des Krieges) so stark wie die kämpfende Truppe: Soldatenfrauen, Kinder, Prostituierte 1.-4. Klasse („Mätresse“, „Concubine“, „Metze“, „Hure“), Trossjungen, Gefangene, zum Dienst bei der Artillerie verurteilte Straftäter, Feldprediger, Zigeuner als Kundschafter und Heilkundige, Feldchirurg, Feldscherer, Handwerker, Sudelköche, Krämer, Marketender, -innen, Juden als Marketender, Soldatenwitwen, invalide Soldaten, mitlaufende Zivilisten aus den Hungergebieten, ehemalige Studenten, Bauern und Bauernknechte, die während der schlechten Jahreszeit zum Heer gingen, im Frühjahr aber wieder entliefen, Glücksspieler, vor der Strafverfolgung durch Behörden Davongelaufene, Kriegswaisen etc. KROENER, „ … und ist der jammer nit zu beschreiben“; LANGER, Hortus, S. 96ff.
[174] Vorwerk: Wirtschaftshof eines Rittergutes oder landesherrlichen Amtes oder Schlosses.
[175] Seeburg [LK Mansfeld-Südharz]; HHSD XI, S. 433f.
[176] Blankenburg [LK Harz].
[177] NÜCHTERLEIN, Wernigerode, S. 87ff.
[178] KRAUSE, Urkunden Bd. 1, S. 321. Hohnstedt, heute Ortsteil von Northeim [LK Northeim].
[179] KRAUSE, Urkunden Bd. 1, S. S. 331. Bernburg [Kr. Bernburg]; HHSD XI, S. 37ff.
[180] KRAUSE, Urkunden Bd. 1, S. 332.
[181] Testimonium: Zeugnis.
[182] NÜCHTERLEIN, Wernigerode, S. 93f.
[183] REDLICH, Military Enterpriser I, S. 436.
[184] KONZE, Stärke, S. 33.
[185] Thanks to Virginia DeMarce for her contribution.
Veröffentlicht unter Miniaturen
|
Verschlagwortet mit H
|
Kayn [Kayn(a), Kain, Kayne, Kaina] von Predel auf Wolkenstein, Melchior Graf von; Obrist [ – ] Kayn[a] von Predel[1] auf Wolkenstein,[2] das Geschlecht soll aus Kaina[3] gestammt haben, stand erst als Obrist in kurpfälzischen Diensten. Verheiratet war er mit Rosina Freifrau von Saurau. In der Schlacht am Weißen Berg hatte er 8 Kompanien mährische Reiter geführt.[4] Danach wechselte er ins kaiserliche Lager und warb 500 Arkebusier-Reiter an.[5]
„Im Dezember 1622 erfolgte in Schleiz[6] der erste Durchmarsch von Truppen. Sie gehörten zu den in Mähren angeworbenen kaiserlichen Regimentern, die Herzog Friedrich von Sachsen-Altenburg, über Hof[7] nach Gera[8] weiterführte. Heinrich Posthumus[9] war selbst nach Schleiz bereist, um nach dem Rechten zu sehen. Auch später waren er und seine Söhne wiederholt in Schleiz, wenn Durchzüge und Einquartierungen stattfanden, um die fremden Offiziere auf dem hiesigen Schlosse zu bewirten und Ermäßigung ihrer Forderungen zu erlangen. Der Oberst des damals durchziehenden Regiments hieß von Kain und lag bei Johann Oberländer in Quartier. In der Stadt waren 170 Pferde untergebracht. Schleiz berechnete sich die Kosten dieser Einquartierung auf 380 Gulden 5 Groschen 4 Pfennige. Darunter waren 4 Gulden 6 Groschen für drei Eimer[10] Bier, welche der Rat der Bürgerschaft ‚im Defensionswerk für 8 Tage Aufwartung’ verehrt’ hatte. Die gehabten Unkosten wurden der Stadt und den Bürgern aus der allgemeinen Landeskriegskasse zurückvergütet“.[11]
Der Erzgebirgschronist Christian Lehmann [11.11.1611-11.12.1688][12] erwähnt ihn unter 1623: „Der Obrist Melchior von kayn hatte den Herzog Friederich [Friedrich v. Sachsen-Altenburg;[13] BW] zue gutt 1000 Pferde in Nied.-Saxen geworben, die eine weile umb Erfurt[14] gelegen wahren, weil aber des herzogs (?) nicht fortgegangen, führete er solche in anfang des jahrs den keyßer zue durch diß gebirg in Böhmen. Den 26. Januar marchirte er mit seinen Volck und 60 Wägen Zwicka[15] vorbey, und ubernachteten in der Schonburgischen herschaft zue Hartenstein[16] und zue Tzschocken;[17] da sie aufbrachen, brande der Hern von Schönburg fuhrwerck ab nahe am Stadlein mit allen Vorrath, 200 schafen und 10 Pferden zum gratial. Den 27. Januar marchirten Sie durch Zwenitz,[18] Elterlein,[19] durch den Pas, logirten am Weinberg[20] und uff der Presnitz;[21] was sie untterwegens ergriffen und mit fortbringen (kunten), vergaßen Sie nicht, und damit wurden alle straßen unsicher“.[22]
Am 31.12.1636 wurde er, in diesem Jahr auch zum Reichshofrat ernannt, in den Grafenstand erhoben.
[1] Predel, früher Ortsteil von Reuden (Elsteraue) [Burgenlandkreis].
[2] Wolkenstein [Erzgebirgskreis]; HHSD VIII, S. 364f.
[3] Kaina, heute Ortsteil von Zeitz [Burgenlandkreis]
[4] KREBS, Schlacht, S. 86.
[5] HALLWICH, 5 Bücher Bd. 1, S. 52.
[6] Schleiz [Saale-Orla-Kr.]; HHSD IX, S. 380ff.
[7] Hof; HHSD VII, S. 302f.
[8] Gera; HHSD IX, S. 134ff.
[9] Heinrich I. Posthumus Reuß , Herr zu Gera, Plauen, Schleitz, Lobenstein und Kranichfeld. [10.6.1572 – 3.12.1635] Verheiratet mit Magdalene, Gräfin von Schwarzburg-Rudolstadt [12.4.1580 – 22.4.1652], Schwester von Ludwig Günther I., Graf von Schwarzburg-Rudolstadt. Der Förderer des Komponisten Heinrich Schütz und strenge Lutheraner siedelte in der Residenzstadt Gera, das sich während seiner Herrschaft zum kulturellen Zentrum der reußischen Territorien entwickelte, calvinistische Exulanten aus Flandern an, die neue Techniken der Wollzeugfabrikation mitbrachten und dem Land damit eine wirtschaftliche Blüte bescheren sollten. Für die Trauerfeierlichkeiten komponierte Schütz auf Wunsch der Witwe die „Musikalischen Exequien“ SWV, S. 279 – 281. Vgl. mdsz.thulb.uni.jena.de.: Happe I 244 v, Happe I 432 r.
[10] 1 Eimer = 72 Kannenm = 61, 83 Liter.
[11] SCHMIDT, Geschichte der Stadt Schleiz, S. 39.
[12] Vgl. SCHMIDT-BRÜCKEN; RICHTER, Der Erzgebirgschronist Christian Lehmann
[13] Vgl. auch die Erwähnungen mdsz.thulb.uni.jena.de.
[14] Erfurt; HHSD IX, S. 100ff. Vgl. die Erwähnungen bei HAPPE, HEUBEL und KRAFFT; mdsz.thulb.uni-jena.de.
[15] Zwickau; HHSD VIII, S. 380ff.
[16] Hartenstein [Kr. Zwickau]; HHSD VIII, S. 142f.
[17] Zschocken [Kr. Zwickau]; HHSD VIII, S. 378.
[18] Zwönitz [Kr. Aue]; HHSD VIII, S. 385f.
[19] Elterlein [Kr. Annaberg]; HHSD VIII, S. 89.
[20] Weipert [Vejperty, Bez. Komotau]; HHSBöhm, S. 650.
[21] Pressnitzer Pass: Der Pressnitzer Pass stellt eine der ältesten Pfadanlagen dar, die aus dem Zentrum Mitteldeutschlands über den dichten Grenzwald nach Böhmen führte. Sein ursprünglicher Verlauf ging von Halle (Saale) kommend über Altenburg, Zwickau, Hartenstein, Grünhain und Zwönitz nach Schlettau. Hier wurde die obere Zschopau gequert. Anschließend führte der Weg über Kühberg am Blechhammer vorbei nach Weipert (Vejprty) und erreichte dann östlich schwenkend über Pleil (Černý Potok) mit Pressnitz (Přísečnice) die älteste Bergstadt des Erzgebirges. Von hier aus verlief der sogenannte Böhmische Steig vermutlich über Kaaden (Kadaň) und bis nach Saaz (Žatec). Die Passhöhe selbst befand sich auf böhmischer Seite nahe Pleil (Černý Potok) auf ca. 800 m ü. NN. Damit war der Pressnitzer Pass deutlich niedriger als die sich nach Westen hin anschließenden Pässe über Wiesenthal, Rittersgrün, Platten, Hirschenstand und Frühbuß. Dies war einer der Gründe für seine häufige Benutzung während des Dreißigjährigen Krieges [WIKIPEDIA]
[22] LEHMANN, Kriegschronik, S. 26. Lehmann datiert nach dem alten Stil.
Veröffentlicht unter Miniaturen
|
Verschlagwortet mit K
|
Salm in Kirburg, Mörchingen und Tronecken, Otto Ludwig, Wild- und Rheingraf von; General [13.10.1597-16.10.1634 Speyer]
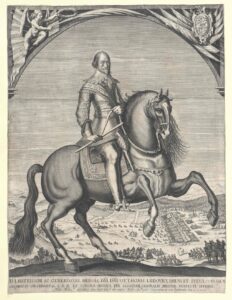
Otto Ludwig,[1] Wild- und Rheingraf von Salm in Kirburg,[2] Mörchingen[3] und Tronecken,[4] wurde am 13.10.1597 als Sohn des Rheingrafen Johann IX. geboren. Er begann seine militärische Laufbahn schon sehr jung unter Christian IV. von Dänemark.[5] Um 1625 die militärische Initiative wieder an sich zu reißen, beabsichtigte Christian IV. einen Vorstoß in das südliche Niedersachsen. Zuerst beorderte er Otto Ludwig nach Calenberg,[6] um die feste wieder einzunehmen und so Teile des Tilly’schen[7] Invasionskorps zu binden. Nachdem Otto Ludwig Steuerwald[8] hatte einnehmen können, begann er mit der Belagerung von Calenberg. Tilly entsandte daraufhin [Jakob Ludwig v.; BW] Fürstenberg zum Entsatz. Unterwegs erfolgte die Vereinigung mit kaiserlichen Truppen unter Nikolaus Des Fours. Da sich jedoch die Lage im Braunschweigischen durch den Entsatz unter Des Fours zum Vorteil der Ligisten verändert hatte, marschierte Fürstenberg auf Calenberg zu. An der Spitze seiner Musketiere half der Zeitzeuge Jost Maximilian von Gronsfeld den mehrfachen Angriff der Dänen abzuwehren, wie er noch in Wassenbergs[9] 1647 erneut aufgelegtem „Florus“ voller Stolz hervorhob: „Was ich auch bey diser ganzen occasion mit Rath und That gethan / solches kan mit Ihrer Churf. Durchl. in Beyern gnädigsten Danckschreiben / darinnen des Graffen von Fürstenberg gethane relation, meine person belangend recapitulirt wurde / erwiesen werden“.[10] Er berichtet weiter, dass in dem Treffen auch der schottische, in dänischen Diensten stehende Obrist Sir John Hepburn gefangen wurde, während der Obrist Freitag[11] samt anderen hohen Offizieren fiel. Insgesamt sollen die dänischen Truppen,[12] die nach Wallensteins[13] Einschätzung den Kaiserlich-Ligistischen an Kampfkraft überlegen waren, 5.000 Mann verloren haben, was nach Aussage des Chronisten Wendt aus Osterode[14] sicherlich übertrieben ist: „Der König Von Dennemarck hatte einen Anschlag auff Calenberg, ward aber von dem Graffen von Fürstenberg davon abgetrieben mit Verlust Vieles Volckes. Der Obrister Leo freytag ward samb 600 Reutern erlegt, Conrad Nelle verwundet, Viele gefangen, 6 Cornet und 15 stangen, davon die Fähnlein, gewißen erobert“.[15] Doch war Tillys Auftrag, die welfischen Herzogtümer Grubenhagen und Calenberg zu besetzen, erfüllt.
Otto Ludwig hatte in der Schlacht bei Lutter[16] 1626 den Oberbefehl über das dritte Treffen.
Der Schweriner[17] Dompropst und Ratzeburger[18] Domherr, Otto von Estorf [1566 – 29.7.1637], berichtet in seinem „Diarium belli Bohemici et aliarum memorabilium“ irrtümlich Otto Ludwigs Tod: „17. Aug ist zwischen dem König zue Dänemark und Graf Tilli eine Schlacht gehalten im Lande zu Braunsweig bei Lutter am Bahrenberge, darin Tilli das Feld behalten, weil des Königs Reuter nicht fechten wollen, sondern davon geritten. Sind viel vornehme Officiere geblieben. Auf der Wahlstadt sind todt gefunden: Wersebe,[19] Nortproth,[20] Landgraf Philipp zu Hessen,[21] Graf zu Solms,[22] der Rheingraf so Catlenburg[23] abgebrannt, General-Commissarius Sivert Powisch,[24] nebst vielen anderen hohen Officieren vnd Befehlshabern. Gefangen sind: der Obriste Lochhauschen,[25] ein Graf von Stolberg,[26] Obriste Twachting,[27] Berent Gos,[28] Courville[29] Französischer Obrister, Gunternach,[30] Königl. Hofmarschal N.,[30a] General-Commiss. Rantzow[31] hart verwundet vnd viele Andere“.[32]
Die Niederlage des dänischen Heeres in der Schlacht bei Lutter führte zur Besetzung Jütlands durch kaiserliche Truppen. Das war das vorläufige Ende der militärischen Karriere Otto Ludwigs. Im Sommer 1626 kämpfte er gemeinsam mit Bernhard von Sachsen-Weimar[33] gegen Wallenstein. Nach ihrer Niederlage gegen ihn mussten sie mit dem Schiff von Flensburg[34] auf die Insel Fünen[35] fliehen.
Bei der Reorganisation der schottischen Truppenteile, so Monro, „erhielt ich von S. M. die Weisung, meine Befehle von Generalmajor von Schlammersdorff entgegenzunehmen, der damals in Odense[36] sein Hauptquartier hatte. Unmittelbar nachdem die Offiziere abgereist waren, befahl er mir, mein Quartier nach Assens[37] zu verlegen, wo wir auch Wache hielten, weil er jenen Teil des Landes durch die Operationen des Feindes für sehr gefährdet hielt. Dort geriet ich bald in Streit mit dem Major des Reiterregiments des Rheingrafen [Otto Ludwig v. Salm; BW], dem angeblich in der Garnison die Befehlsgewalt zukam. Dies hatte Reibereien zwischen unseren Soldaten und den Reitern zur Folge, so daß es in mehreren Zusammenstößen, zu denen es in der Garnison gekommen war, auf jeder Seite drei oder vier Tote gab. Um diese Querelen abzustellen, kam der Generalmajor mit einigen weiteren Offizieren nach Assens und hielt einen Kriegsrat, in dem die Angelegenheit verhandelt wurde. Der Major der Reiterei wurde daraufhin in eine andere Garnison versetzt, und Rittmeister Cratzenstein kam dafür mit seinen Leuten nach Assens, wo das Kommando in der Garnison mir übertragen worden war. Trotz allem hielt die Feindschaft zwischen uns und den Reitern noch lange an, bis der Rheingraf selbst seinen Offizieren befahl, jene frechen Reiter exemplarisch zu bestrafen, die sich nicht mit dem ganzen Schottenregiment kameradschaftlich vertrügen. Von diesem Zeitpunkt an brach das Eis, und wir lebten etwas ruhiger, solange ich dort war, was aber nicht lange dauerte“.[38]
Im August 1628 kam es bei Wolgast[39] zur Schlacht zwischen den Truppen Christians IV. und Wallensteins.
Monro erinnert sich: „Unmittelbar nachdem S. M. von Dänemark den Schutz der Stadt Stralsund[40] an S. M. von Schweden übergeben hatte, schiffte der König in Dänemark Infanterie und Reiterei ein und landete in Wolgast in Pommern [14.9.1628; BW], in der Absicht, das Herzogtum Pommern gegen den Kaiser zu schützen. Und nachdem der König in Wolgast angekommen war, rief er das, was von unserem Regiment übriggeblieben war, von Stralsund ab. Unser Regiment war bei seinem Abzug nicht einmal 400 Mann stark, nachdem es in sechs Wochen beinahe 600 gute Soldaten verloren hatte, die Offiziere nicht gerechnet. Es wurde damals von Hauptmann Mackenyee geführt, da die höheren Vorgesetzten abwesend waren. Er führte Marsch nach Wolgast durch, wo sich unsere Truppe mit der Armee S. M. vereinigte.
Kaum waren sie angekommen, wurden sie unverzüglich ins Gefecht geworfen. Der Feind griff S. M. heftig an und hatte 14 Ordonanzstücke aufgefahren. Er feuerte damit auf die Schlachtaufstellung des Königs, bis dieser die Gefahr erkannte, und da er nicht in der Lage war, dem Feind Widerstand zu leisten, zog er sich, völlig aus der Fassung gebracht, in großer Eile nach Wolgast zurück. Der König hatte, ohne gekämpft zu haben, den größten Teil seiner Armee verloren, wobei unser Regiment und die Überreste von Spynies Regiment abgeschnitten worden wären, hätte nicht Rittmeister Hoome mit einigen seiner Kameraden vom Reiterregiment des Rheingrafen [Otto Ludwig v. Salm; BW] den Feind dreimal attackiert und ihn solange aufgehalten, bis der größte Teil unserer Landsleute sich in Sicherheit gebracht hatte. Dann erst wurden sie vom Feind gezwungen, sich selbst in großer Eile zurückzuziehen, nachdem sie ihre eigene Sicherheit für ihre Kameraden aufs Spiel gesetzt hatten.
Als S. M. sah, daß der Feind heftig nachrückte, fürchtete er sehr, überrascht oder gefangen zu werden. Deshalb gab er Hauptmann Mackenyee den Befehl, das Kommando über alle anwesenden Schotten und über verschiedene andere Truppenteile zu übernehmen und mit dem Feind vor den Toren solange zu scharmützeln, bis sich S. M. zurückgezogen hätte. Dann sollte er sich über die Brücke absetzen und sie in Brand stecken, was der Hauptmann ordnungsgemäß ausführte. So leistete er dem König den besten Dienst, der ihm während des ganzen Krieges geleistet worden war, nicht ohne große Gefahr für den Hauptmann und die, die bei ihm waren. Als die Brücke erst einmal brannte, war er der glücklichste Mann und wurde auch zuerst eingeschifft. Fähnrich Lindsay, Bruder von Bainsho, wurde von einer Kanonenkugel in die Schulter getroffen und dennoch durchgebracht und wunderbarerweise geheilt. Nachdem das Regiment so eingeschifft war, traf es mit dem Oberst zusammen, der mit den Rekruten aus Schottland gekommen war. Mit dem König fuhren sie nach Dänemark zurück, wo sie gemustert wurden“.[41] Nach dem Lübecker Frieden kehrte Mackenyee nach Schottland zurück.[42]
Die Flucht Christians nach Kopenhagen veranlasste Otto Ludwig, die dänischen Dienste zu quittieren und unter schwedischen Fahnen weiterzukämpfen. Gustav Adolf scheint wegen dessen Eigensinn und Übermut keine besonders hohe Meinung von einem „solchen Gesellen und Großhans“ gehabt zu haben. Er wollte Otto Ludwig sogar wegen der Disziplinlosigkeit der ihm unterstellten Truppen aburteilen lassen.
Der Konflikt zwischen Christian IV. und dem Kaiser[43] wurde durch den Frieden von Lübeck (1629) beigelegt.
Gustav II. Adolf befand sich zu dieser Zeit im Krieg mit Polen. Der Krieg zwischen Polen und Schweden hatte seine Wurzeln in gegenseitigen Ansprüchen beider Könige auf die jeweils andere Krone. Der Auslöser für diesen Krieg war erschreckend banal: Seit dem Jahre 1625 konkurrierten Gustav II. Adolf und Christian IV. um den Oberbefehl bei einem von Frankreich und England unterstützten Angriff auf das Reich. Da sich der Führungsanspruch des Schwedenkönigs nicht durchsetzen ließ, zog sich Gustav II. Adolf zurück und begann nach Jahren des Waffenstillstandes im Juli 1625 einen neuen Angriff gegen Sigismund von Polen.
Allerdings hatte Gustav II. Adolf den falschen Zeitpunkt für einen Angriff auf Polen gewählt: Der Polenkönig war mit den Habsburgern verschwägert und die Habsburger standen auf dem Höhepunkt ihrer Macht. Sigismund III. bekam spanisches Geld und Soldaten aus Brandenburg. Auch Wallenstein stellte ihm nach dem Frieden von Lübeck Soldaten zur Verfügung. Der Brandenburger Kurfürst wurde unter Drohungen vom Kaiser gezwungen, mit seiner Armee nicht seinen Schwager Gustav Adolf zu unterstützen, sondern seinen Verpflichtungen als Vasall Sigismunds nachzukommen. Gustav II. Adolf hatte plötzlich alle Hände voll zu tun, um nicht das Gesicht und sein Heer zu verlieren. Seinen Plan, sich die Ostsee als Binnenmeer Schwedens einzuverleiben, musste er zunächst aufgeben. Ein erneuter, durch Richelieu vermittelter Waffenstillstand zwischen Polen und Schweden verhinderte das Schlimmste.
Otto Ludwig fand in diesem Krieg in Wrangel, Baudissin, Max Teuffel, Ramsay und Axel Lillie die besten Lehrmeister einer neuen Militärtaktik, nachdem der Schwede technische Verbesserungen und taktische Reformen in seinem Heer eingeführt hatte. So befreite er sowohl seine Reiterei wie auch seine Fußtruppen von den schweren und schwerfälligen Panzerungen, die damals noch üblich waren. Statt der sonst gebräuchlichen schweren Geschütze, zu deren Fortbewegung 16, 20, ja oft 30 Pferde notwendig waren, setzte er eine leichte Artillerie ein, die außer sonstigen Vorzügen auch den der größeren Feuergeschwindigkeit besaß. Das verstärkte ganz erheblich die Kampfkraft seiner Truppenteile. Entscheidend war jedoch, dass Gustav Adolf seinen Truppen größere Beweglichkeit dadurch verliehen hatte, dass er sie nicht nach der als Standard geltenden spanischen Taktik antreten ließ. Die bisher praktizierte Taktik sah die Reiterei in sechs Reihen, Knie an Knie massiert antreten und angreifen. Gustav Adolf ordnete sie in kleinen viereckigen Abteilungen in vier Reihen an, zwischen denen jeder Reiter nach allen Seiten seinen Bewegungsraum hatte. Zwischen diesen Reiterabteilungen standen kleine Musketierabteilungen. Diese Musketierabteilungen waren in sechs Reihen gestaffelt und so trainiert, dass die vorderste Reihe kniend und die folgende stehend schießen konnte. Nach dem Feuer begaben sich die Schützen in die hintersten Reihen, konnten nachladen, während die nächsten beiden Reihen schossen. Durch die Schachbrettaufstellung war es unerheblich, woher der gegnerische Angriff vorgetragen wurde: Das Fußvolk und auch die Reiterei konnten in kürzester Zeit ihre Verteidigungsrichtung ändern. Der Drill der schwedischen Truppen war so vollendet, dass sie nicht nur dreimal schneller schossen, sondern auch dreimal wirksamer waren. Diese neue Formation des schwedischen Heeres führte nicht nur dazu, dass die Front größer wurde, sondern hatte zugleich den Vorteil, dass die feindlichen Geschütze in den nun dünneren Kolonnen keine allzu großen Verluste anrichten konnten.
Dass die militärische Ausbildung Otto Ludwigs noch nicht abgeschlossen war, musste er bei einem Rückzugsgefecht gegen die vorrückenden vereinten Heere der Polen und des (damals) kaiserlichen Feldherrn Arnim erfahren: Entgegen dem ausdrücklichen Befehl Gustav II. Adolfs ließ sich Otto Ludwig bei der Besetzung eines Passes in ein Gefecht mit dem Gegner ein. Er kam sofort in Schwierigkeiten und Gustav Adolf musste ihn persönlich unterstützen, um seinen Truppenteil vor der Vernichtung zu retten. Dabei kam auch der Schwedenkönig unvermittelt zwischen die feindlichen Linien und nur durch Aufopferung eines seiner Offiziere konnte sich Gustav Adolf vor der Gefangennahme retten.
Solange Wallenstein militärisch und diplomatisch aktiv war, ließen sich Gustav II. Adolfs imperiale Pläne einer Annexion weiterer Ostseeanrainerstaaten nicht verwirklichen. Nachdem Wallenstein 1630 auf Drängen der deutschen Fürsten seinen Oberbefehl niederlegen musste, sah Gustav II. Adolf seine Stunde gekommen. Er griff unter dem Vorwand, die „protestantische Sache“ in Deutschland zu retten und sie vor der Gegenreformation der Habsburger zu schützen, direkt in die Interessenkonflikte der protestantischen deutschen Fürsten mit Ferdinand II. ein. Otto Ludwig, der sich anscheinend wieder mit Gustav II. Adolf ausgesöhnt hatte, nahm an dem Feldzug teil.
Obwohl die eingeschlossenen kaiserlichen Truppen die Stadt Frankfurt an der Oder[44] übergeben wollten und um Pardon gebeten hatten, wurden Tausende von ihnen unbarmherzig niedergemetzelt, auch von den Truppen des Rheingrafen. Der schottische Kriegsteilnehmer und Augenzeuge Monro schildert die Einnahme von Frankfurt a. d. Oder am 3.4.1631: „Als wir fanden, daß der Feind keine Schlachtaufstellung gemacht hatte, hielten wir uns auf den Feldern, so als würden wir mit einem Male vorstoßen, uns der Stadt zu bemächtigen, als wüßten wir nichts von der Nähe unserer Feinde und der Stärke, die sie zusammen hatten. Und da wir sahen, daß wir der Fürsten nicht sicher sein konnten, so entschieden wir, daß es das beste für uns sei, die Zeit zu nützen. Unverzüglich kommandierte S. M. daher den größten Teil der Kavallerie dazu ab, hinter uns eine Bewegung auszuführen, sozusagen zwischen uns und Berlin, als ob General Tilly hinter uns herkäme, während wir mit der Stadt beschäftigt wären, und von der ganzen Kavallerie behielten wir nur den Rheingrafen [Otto Ludwig v. Salm; BW] mit seinem Regiment neben unserer Infanterie, falls der Feind einen Ausfall machte, uns gegen die Reiter beizustehen, die in der Stadt waren.
Als die Kavallerie angewiesen worden war, das zu tun, und S. M. die Angst seiner Feinde sah, die die Vorstädte von sich aus niedergebrannt hatten, was S. M. als Vorzeichen für einen künftigen Sieg ansah, befahl der König, daß ein Teil der abkommandierten Musketiere durch die brennende Vorstadt vorstoßen und sich beim Haupttor festsetzen sollte, und zwar solange, bis S. M. über den Einsatz der übrigen Armee Anordnungen getroffen hätte, wobei er jede Brigade gesondert in ihren Abschnitt einwies. Die Gelbe [Teuffel; BW] und die Blaue Brigade [Winckel; BW] hatten den Auftrag, in den Weingärten der Stadt Posten zu beziehen, auf der Seite, die Küstrin[45] am nächsten lag, und sie erhielten den Befehl, ihre Wachen vorzuschieben, während die übrige Brigade sich in geschlossener Formation mit ihren Waffen zur Ruhe niederlassen sollte, um ständig in Bereitschaft zu sein, wenn es zu einem Ausfall käme. Die Weiße Brigade, auch Dargitz-Brigade genannt, wurde angewiesen, in der Vorstadt Stellung zu beziehen, um den abkommandierten Musketieren Rückendeckung zu geben, die zwischen dieser Brigade bei der vom Tor ausgehenden Gefahr unmittelbar hinter den Wällen standen. Hepburns Brigade wurde abkommandiert, beim anderen Tor Stellung zu beziehen und ihre Posten ebenfalls vorzuschieben. Die übrigen abkommandierten Musketiere, die von Major John Sinclair befehligt wurden, erhielten den Befehl, auf einer Anhöhe in der Nähe eines Friedhofs Stellung zu beziehen, der unmittelbar vor den Festungswerken des Feindes lag. Auf dieser Anhöhe ging eine Batterie in Stellung, während die Artillerie und die Munitionswagen der Armee, wie es üblich war, zwischen unserer Brigade und den Reitern des Rheingrafen [Otto Ludwig v. Salm; BW] ihren Platz fanden, die hinter uns standen. Als das alles so eingeteilt war und alle in Stellung gegangen waren, wurden Leute aus allen Brigaden abkommandiert, Schanzkörbe für die Kanonen zu machen und Gräben auszuheben.
Dann ging der König, wie es üblich war, in eigener Person zusammen mit Oberst Teuffel zur Erkundung in die Nähe des Walls, wo der Oberst dann in den linken Arm geschossen wurde, was S. M. veranlaßte, für ihn selber in aller Öffentlichkeit um Hilfe zu rufen, weil der König glaubte, außer Hepburn keine Hilfe zu haben (II, 32). Im selben Augenblick wurde David Monro, mein Leutnant, von einer Musketenkugel ins Bein getroffen, dort wo Major John Sinclair in der Nähe der im Bau befindlichen Batterie die für den Schutz des Königs abkommandierten Musketiere befehligte. Um uns zu verspotten, hängte der Feind nun am Wall eine Gans heraus und machte sofort darauf mit 200 Mann einen Ausfall gegen unsere Wachen, die den Feind mit Musketensalven empfingen. Da er aber für die Wachen zu stark war, befahl S. M. dem Major Sinclair, einen Offizier mit weiteren 50 Musketieren abzukommandieren, die den Wachen beistehen sollten. Als der Feind trotzdem unsere Wachen weiter zurückdrängte und sie zwang, Gelände aufzugeben, befahl der König dem Major unverzüglich, mit 100 Musketieren einzugreifen, dem Feind Widerstand zu leisten und den Wachen zu Hilfe zu kommen, was der Major auch sofort ausführte. Er zwang den Feind, sich schneller zurückzuziehen als er vorgerückt war, wobei ein Oberstleutnant und ein Hauptmann gefangengenommen wurden. Nachdem der Major den Friedhof eingenommen hatte, lagen unsere Leute unmittelbar vor den Befestigungswerken des Feindes. Sinclair behielt seine Wachen nun dort bei und hatte ein Auge auf den Feind, so daß wir nicht mehr mit Ausfällen belästigt wurden, obwohl verschiedene Offiziere und Soldaten durch den Feind von seinen Befestigungen aus verwundet wurden, denn der Friedhof bot unseren Leuten, die unmittelbar unter den Werken des Feindes lagen, keinen Schutz.
Am Sonntagmorgen, es war Palmsonntag, der 3. April 1631, nahmen der König und die ganze Armee in ihrem besten Staat an einem Gottesdienst teil, und nach der Predigt ermunterte S. M. unsere Soldaten. Er sagte, er wünsche, daß er die schlechten Tage, die sie augenblicklich mit Geduld ertrügen, von ihnen nehmen könne, und er hoffe, ihnen in kürze bessere Tage bescheren zu können, an denen er sie Wein trinken lassen könne, anstatt des Wassers, das sie nun tränken. Dann gab der König dem General Baner Befehle, allen Brigaden mitzuteilen, sich mit ihren Waffen für weitere Anweisungen in Bereitschaft zu halten. Als dieser Befehl gegeben war, versahen sich einige der abkommandierten Musketiere, die unter Sinclairs Befehl standen, mit Leitern, da sie einen bevorstehenden Sturmangriff vermuteten.
Gegen 5 Uhr am Nachmittag kam S. M. zu unserer Brigade und ließ einen deutschen Hauptmann namens Guntier von Hepburns Regiment rufen. Er befahl ihm, einen leichten Harnisch anzulegen, seinen Degen zu ziehen, einen Sergeanten mit zwölf tüchtigen Burschen mitzunehmen, durch den Graben zu waten und zu erkunden, ob sich Leute zwischen dem Erdwall der äußeren Befestigung und dem steinernen Festungswall der Stadt aufhalten könnten. Dann sollten sie sich, so schnell sie es nur vermöchten, zurückziehen. Als die das getan hatten, kam S. M. zur Erkenntnis, daß zwischen den beiden Wällen Platz sei, Soldaten hineinzubringen, und da die Brigaden schon in Schlachtordnung standen, sollten sie, nachdem der Hauptmann ohne Verwundung zurückgekommen war, auf ein Zeichen hin angreifen. Der König befahl Baner und Hepburn, mit unserer Brigade den Graben zu überwinden und zu stürmen, und wenn sie den Feind vom Wall der äußeren Verteidigungslinie zurückgetrieben hätten, so sollten sie sich zwischen ihm und dem steinernen Hauptwall festsetzen. Wenn es glücken sollte, den Feind zum Weichen zu bringen, sollten sie mit ihm zusammen in die Stadt eindringen. Die gleichen Befehle ergingen auch an die übrigen Brigaden, die schon bereitstanden.
Der König hatte eine Anzahl großer und kleiner Kanonen in den Batteriestellungen laden lassen und befahl nun, an allen Abschnitten achtzugeben. Wenn die Geschütze abgefeuert würden, sollten die Sturmtruppen noch mitten im Pulverdampf der ersten Salve zum Angriff vorbrechen, was sie dann auch taten. Wir durchquerten den Graben und wateten dabei bis an die Hüften in Wasser und Schlamm, und als wir dann hinaufstiegen, den Wall zu erstürmen, da standen uns einige starke Palisaden im Weg, die im Wall so gut eingegraben waren, so daß wir, wenn der Feind sich nicht voller Angst vom Wall zurückgezogen hätte, nur mit großem Glück hätten eindringen können. Der Feind zeigte sich aber so schwach und zog sich zurück, so daß die Kommandeure die Befehle ausführen konnten, die sie vom König erhalten hatten (II, 13). Wir drängten nach, in der Absicht, dem zurückweichenden Feind durch eine große Ausfallpforte, die zwischen den beiden Wällen lag, in die Stadt hinein zu folgen. Sie hatten zwei große Türflügel geöffnet und drängten hier hinein. Nach ihrem Rückzug (vor einigen Tagen) hatten sie hier ein paar Orgelgeschütze in Stellung gebracht, mit denen man ein Dutzend Schüsse auf einmal abfeuern kann. Daneben hatten sie noch zwei kleine Ordonanzgeschütze aufgepflanzt, die ebenfalls den Eingang absicherten, und dann standen da noch Musketiere, die nun zusammen mit den Schüssen aus den Geschützen unbarmherzig unter unseren Musketieren und Pikenieren aufräumten.
Der tapfere Hepburn, der die Schlachtreihe der Pikeniere aus seiner eigenen Brigade anführte, wurde, als er bis auf eine halbe Pikenlänge Abstand zur Ausfallpforte vorgedrungen war, in dem Augenblick, als er eindringen wollte, oberhalb des Knies in den Schenkel geschossen, so daß er lahm wurde. Die großen Schmerzen betäubten seine Sinne, was ihn auch zwang, sich zurückzuziehen. Er sagte zu mir, ‚Schulfreund Monro, ich bin angeschossen worden‘, was mir wirklich sehr leid tat. Dann wurde sein Major, ein entschlossener Kavalier, der vorstürmte, um in die Ausfallpforte einzudringen, unmittelbar vor dem Eingang erschossen. Darauf wichen die Pikeniere zurück und blieben zunächst stehen. General Baner, der dabei war, feuerte nun die Kavaliere an, doch einzudringen. Oberst Lumsdale [Lumbsdain; BW] und ich, die wir beide an der Spitze unserer Fahnenabteilungen standen, er mit einer Partisane, ich mit einer Halbpike in der Hand und einem Sturmhelm auf dem Kopf, der mich schützte, gaben nun unseren Pikenieren das Zeichen zum Angriff. Wir führten sie Schulter an Schulter an, und beide konnten wir glücklicherweise die Pforte ohne Verletzung erreichen, doch einige von uns, wie ich weiß, fanden dort den Tod. Der Feind wurde nun gezwungen, sich in Verwirrung zurückzuziehen. Er war von unserem Eindringen so überrascht, daß er weder den Mut noch die Geistesgegenwart hatte, das Fallgatter des großen Tores herunterzulassen. So konnten wir, indem wir dem Feind auf den Fersen blieben, in die Straßen der Stadt eindringen. Dort hielten wir dann an, bis unsere Pikeniere nachgekommen waren und sich in Formation aufgestellt hatten. Flankiert von Musketieren griffen wir mit gefällten Piken an, wobei die Musketiere auf den Flanken Feuerschutz gaben, bis die Ordnung des Feindes ins Wanken gebracht wurde.
Nach uns kam General Baner mit einer Abteilung frischer Musketiere heran. Er verfolgte die Kaiserlichen in der einen Straße, Lumbsdale und ich in der anderen. Wir stießen mit dem Feind wieder zusammen, schlugen ihn aber ganz und gar, und unsere Offiziere nahmen ihm neun Fahnen ab, die dann S. M. überbracht werden sollten. Der größte Teil ihrer Soldaten wurde niedergehauen als Vergeltung für die Greueltaten, die sie in Neu-Brandenburg[46] verübt hatten, aber einige ihrer Offiziere erhielten ‚Quartier‘, so wie sie es auch gegenüber unseren gegeben hatten. Nachdem dieses Regiment besiegt war, wiesen wir einen Offizier mit einer starken Abteilung an, sich der Brücke zu bemächtigen, damit der Feind nicht mehr entkommen könne. Als den Feinden der Fluchtweg auf diese Weise abgeschnitten war, wurden sie nun alle niedergehauen, und die Straßen lagen voll mit Toten. Der größte Teil unserer Soldaten und Offiziere lief nun auseinander, um Beute zu machen, und sie ließen mich mit einer kleinen Zahl anständiger Soldaten zurück, die Fahnen zu schützen. Ich muß gestehen, daß ich einfach nicht in der Lage war, etwas gegen diese Disziplinlosigkeit zu unternehmen. Soweit zu Lumsdales Rolle und meiner. Ich kann mich dafür verbürgen, daß alles wahr ist. Und so wie ich von unseren eigenen Taten die Wahrheit ohne Aufhebens berichtet habe, auch wenn es kein Mensch als Freund der Tugend nachprüfen kann, so will ich von den Taten anderer Leute erzählen, soweit ich aus den Berichten meiner ehrenhaften Kameraden weiß, daß auch sie wahr sind.
Oberstleutnant Musten, der ernannt worden war, die Musketiere von Lumsdales Regiment und dem meines Obersts zu kommandieren, das unter meinem Befehl stand, sah uns eindringen und folgte uns nach. Er gab denen, die unter ihm standen, von sich aus den Befehl, wie sie sich verhalten sollten, so daß sie dem Feind keine besseren Bedingungen für ‚Quartier‘ gewährten, als wir es auch taten. Auch die Deutschen, die sich der Grausamkeiten erinnerten, die der Feind in Neu-Brandenburg verübt hatte, gaben nur wenig ‚Quartier‘ (II, 34). Major John Sinclair, wie mir glaubhaft versichert wurde, und Leutnant George Heatly, der ihn begleitete, beide entschlossen und tüchtig, waren die ersten, die mit Leitern über den Wall in die Stadt hineinkamen. Da sie bei ihrem Eindringen nur wenige Musketiere dabei hatten, wurden sie in den Straßen von den Kürassieren des Feindes, den besten Reitern, attackiert, die sie zwangen, dicht beieinander zu stehen, mit dem Rücken zum Wall, über den sie eingedrungen waren. Sie gaben mehrere Musketensalven auf die Reiter ab, die dadurch zum Rückzug gezwungen wurden.
Nachdem wir hineingekommen waren, drangen die Gelbe [Teuffel; BW] und Blaue Brigade [Winkel; BW], die von der ganzen Armee als entschlossen und tapfer in ihren Aktionen angesehen wurden, ebenfalls ein. Sie sollten die Stellungen der Iren angreifen, wurden aber zweimal unter großen Verlusten wütend zurückgeschlagen. Dabei erlitten sie schlimme Verluste durch die Handgranaten, die die Iren unter sie warfen. Als sie dann zuletzt doch vordrangen, stellten sich ihnen die Iren entgegen, die zahlenmäßig schwach waren. Ungeachtet des Unterschieds im Zahlenverhältnis kämpften sie lange mit Pike und Schwert in den Festungswerken, bis die meisten an der Stelle gefallen waren, an der sie gestanden waren und gekämpft hatten, so daß am Ende Oberstleutnant Walter Butler, der die Iren anführte, gefangengenommen wurde, nachdem er einen Schuß in den Arm und einen Pikenstich in den Schenkel davon getragen hatte. Am nächsten Tag konnte man an den einzelnen Stellen erkennen, wo am heftigsten gekämpft worden war, und in der Tat, hätten die anderen sich so tapfer gehalten wie die Iren, hätten wir uns mit großen Verlusten zurückziehen müssen, ohne den Sieg davongetragen zu haben.
Als die Wut verraucht war, waren alle Soldaten, die nun ihre Pflicht vernachlässigten, um so mehr darauf aus, Beute zu machen, denn die ganze Straße stand voll mit Reiteseln, Reitpferden, Kutschen und verlassenen Wagen, angefüllt mit Reichtümern aller art, Tafelsilber, Juwelen, Gold, Geld, Kleidern, so daß ich später nie mehr sah, daß man den Offizieren so schlecht gehorchte und keinen Respekt mehr vor ihnen hatte, wie es hier eine Zeitlang geschah, bis der Höhepunkt überschritten war. Und ich kenne sogar einige Regimenter, die keinen einzigen Mann mehr bei ihren Fahnen stehen hatten, bis das Wüten vorüber war. Einige Fahnen waren die ganze Nacht hindurch verschwunden, bis man sie dann am nächsten Morgen wieder beibrachte. So eine Unordnung herrschte bei uns, und das alles wurde hervorgerufen durch die Raffgier, die Wurzel allen Übels und der Ehrlosigkeit.
Als die Einnahme der Stadt abgeschlossen war, kam S. M. selbst herein. Er wurde vom Rheingrafen [Otto Ludwig v. Salm; BW] und seinen Reitern bewacht, die nun unverzüglich abkommandiert wurden, die Brücke zu überqueren und dem Feind auf den Fersen zu folgen, der in Richtung Glogau[47] auf der Flucht war. Dorthin hatten sich der Feldmarschall Tiefenbach, der Graf von Schauenburg und Montecuccoli mit jenen zurückgezogen, die entkommen waren. S. M. hatte kaum in der Stadt Quartier genommen, als ein zufällig ausgebrochenes Feuer die Stadt einzuäschern drohte. Unter Trommelschlag wurden daher Befehle in allen Straßen laut ausgerufen, daß sich alle Offiziere und Mannschaften bei Todesstrafe sofort bei ihren Fahnen auf der anderen Seite der Oder in den Außenbefestigungen einfinden sollten, wo Sir John Hepburn angewiesen war, das Kommando innerhalb der Festungswerke zu übernehmen. Ausgenommen waren die Truppen, die bestimmt worden waren, die Tore der Stadt zu bewachen, dazu das Quartier S. M. und die Unterkünfte der Generale am Marktplatz, wo eine starke Wache gehalten wurde, um Plünderungen und Übergriffe der Soldaten zu unterbinden. Obwohl diese Befehle öffentlich ausgerufen wurden, hielten sich viele nicht daran und blieben in der Stadt, um zu plündern.
Bei diesem Zusammenstoß verlor der Feind fast 3 000 Mann, nicht gerechnet die Offiziere, die dabei getötet wurden, vier Obristen, Pernstein [der allerdings erst am 26.7.1631 fiel; BW], Hydou-Mayence, [Berthold v.; BW] Wallenstein [der erst bei Lützen fiel; BW] und Joure. Weitere 36 Offiziere kamen ums Leben. Oberst [Ernst Georg v.; BW] Sparr mit fünf deutschen Oberstleutnanten und ein irischer Kavalier wurden gefangengenommen, der sich tapfer und ehrenvoll geschlagen hatte. Der Feind verlor 41 Fahnen, wie ich am nächsten Tag sehen konnte, als vor General Baner eine Zählung stattfand, dazu kamen neun Standarten der Reiterei. Auf unserer Seite kamen mindestens 800 Mann ums Leben, davon verloren das Blaue und das Gelbe Regiment allein 500. Dem König fiel hier eine sehr große Menge von Vorräten für die Armee in die hand, Getreide, Munition und 18 Ordonanzgeschütze. Am nächsten Tag ernannte S. M. Generalmajor Lesly [Alexander Leslie; BW] zum Gouverneur über die Stadt und gab ihm den Befehl, die schadhaften Festungswerke und Wälle auszubessern. Dann wurde der Befehl gegeben, die Toten zu begraben, was man in sechs Tagen nicht völlig schaffen konnte. Zuletzt warf man sie in Haufen in große Gruben, mehr als hundert in jedes Grab. Am nächsten Tag erhielten wir die Anweisung, unsere Regimenter zu versammeln, damit man sie mit den Waffen ausrüsten könne, die den Soldaten fehlten, da viele von ihnen in der dem Sturm folgenden Unordnung ihre Waffen verloren hatten“.[48] Tilly kam mit seinen Truppen zu spät zu Hilfe und zog sich nach dem Fall der Stadt wieder in Richtung Magdeburg[49] zurück.
Das Bollwerk des Protestantismus, die Stadt Magdeburg, war zu dieser Zeit von kaiserlichen Truppen unter Tilly und Pappenheim[50] eingeschlossen. Die Magdeburger glaubten fest an das Versprechen Gustav II. Adolfs, das er noch am 3.5. gegeben hatte, als schon die kaiserlichen Truppen auf Magdeburg im Anmarsch waren, dass er die Stadt nicht im Stich lassen werde, „solange er ein König in Ehren sei“. Aber statt Magdeburg zu befreien, stürmte er damals Frankfurt an der Oder. Magdeburg wurde fünf Wochen später, am 20.5., von den Kaiserlichen in Sturm genommen und in Schutt und Asche gelegt. Außer dem Dom und der Liebfrauenkirche blieben nur einige Fischerhütten übrig. Fast die gesamte Einwohnerschaft büßte bei der Katastrophe ihr Leben ein. Gustav Adolf stand damals untätig in Saarmund,[51] keine zwei Tagesmärsche von Magdeburg entfernt. Er konnte den Donner der Belagerungsgeschütze hören. „Magdeburg ist gefallen für das Evangelium“, das waren fortan seine einleitenden Worte bei Ansprachen und Proklamationen. Gustav Adolf kann nicht vom Vorwurf ernst zu nehmender Historiker freigesprochen werden, diese Phrase nur deshalb benutzt zu haben, um das Entsetzen der Protestanten über die Magdeburger Katastrophe propagandistisch für seine Ziele auszunutzen. Die Vernichtung Magdeburgs wurde propagandistisch in nicht weniger als zwanzig Zeitschriften, 205 Flugschriften und 42 illustrierten Flugblättern in ganz Europa verbreitet.[52]
Nach dem Fall Frankfurts und der Vernichtung Magdeburgs stand Otto Ludwig unter dem Kommando Baudissins und eroberte mit ihm Landsberg.[53] Im März 1631 kommandierte er seinen ersten Kampf gegen kaiserliche Truppen: Er griff die Verstärkung für Tilly unter dem Obristen Wengiersky bei Plauen[54] an und vernichtete den Truppenteil fast vollständig. Auf seinem weiteren Weg nach Schlesien wurde er im Juni 1631 auf dem rechten Elbufer von Pappenheim überfallen, konnte aber diesen Angriff erfolgreich abwehren. Dessen Oberbefehlshaber Tilly hatte seine erste Feindberührung mit dem Schwedenkönig Gustav II. Adolf am 26.7.1631. Nach dem Fall Frankfurts a. d. Oder und der Vernichtung Magdeburgs durch Tilly stand Pfalzgraf Otto Ludwig von Salm unter dem Kommando Baudissins und eroberte mit ihm Landsberg.
Tilly hatte seine erste Feindberührung mit Gustav II. Adolf am 26.7.1631. Er war mit seinem Heer von Magdeburg aus in Richtung Werben[55] marschiert. Dort hatten die Schweden ein festes Lager errichtet. Tilly postierte eine Vorhut aus drei Regimentern in den Dörfern Burgstall,[56] Sandbeiendorf[57] und Angern.[58] Zur Überraschung der Kaiserlichen griff Gustav II. Adolf jedes Regiment einzeln an. Baudissin vernichtete das gesamte Reiterregiment Ernesto Montecucculis in Burgstall; Gustav II. Adolf griff Pernstein in Sandbeiendorf an, wobei Pernstein angeblich im Kampf fiel, weil er sich der veralteten Form eines Reiterangriffs, des Caracolierens,[59] bediente.[60] Rheingraf Otto Ludwig fiel die Dragoner Holks[61] bei Angern an. Obwohl dessen Dragoner bereits in Schlachtordnung standen, erlitten sie hohe Verluste und ergriffen die Flucht. Der Ort Angern[62] wurde anschließend von Otto Ludwig sinnlos niedergebrannt.
Der schottische Augenzeuge Monro meinte sarkastisch: „Nachdem wir so vorbereitet waren, den Feind willkommen zu heißen, und nachdem S. M. vom Herannahen des Feindes mit einer starken Armee gehört hatte, entschloß sich der König, wie es ein umsichtiger General tut, den Mut des Feindes im offenen Feld auf die Probe zu stellen, ehe er herankäme, seine kleine Ar-mee zu entmutigen. Deshalb kommandierte S. M. eine starke Abteilung von 2 000 Musketieren und 1 000 Reitern hinaus, die er selbst anführte, und da er von seinen Kundschaftern erfahren hatte, daß Tillys Armee schon bis Wolmirstedt[63] herangerückt sei, rief S. M. alle Garnisonen, die auf dieser Seite der Elbe standen, auf der der Feind heranmarschieren würde, ins Lager zurück. Der König hatte inzwischen gute Aufklärungsergebnisse über die Vorausabteilungen des Feindes erhalten, die sich aus vier Reiterregimentern zusammensetzte, den besten der Armee Tillys, nämlich aus Oberst Pernsteins Kürassierregiment, Montecuccolis Regiment, Holcks Kürassierregiment und Coramines, die (II, 52) alle zusammen aus etwa 42 Kornetts bestanden. Sie lagen in der Nähe von Tangermünde[64] im Quartier und wußten nicht, wie nahe sie dem tapferen Gustav gekommen waren. Und obwohl es nicht dem Zeremoniell entsprach, daß ein König tapferen Kavalieren ihres Standes zuerst seine Aufwartung macht und ihnen durch seinen Besuch große Gnade erweist, wenn auch, weiß Gott, weniger vergnügen, so schickte der König den Rheingrafen und Oberst [Pensen v.; BW] Caldenbach mit 500 Dragonern und ihren eigenen beiden Reiterregimentern hinaus, die Feinde in ihren Quartieren im Namen S. M. zu begrüßen und sie zuerst mit einer Musketensalve zu ehren, damit sie es nicht für unhöflich hielten, daß S. M. ihnen seine Aufwartung machte, ohne es ihnen vorher angekündigt zu haben. Der Feind faßte dies aber falsch auf, so daß der Kampf losging. Oberst Pernstein wurde getötet, Holck und Coramine flohen, so daß die Vorausabteilung des Feindes in Verwirrung geriet und nach dem Verlust von 29 Kornetts besiegt und ruiniert war. Unsere Reiterei machte große Beute an Pferden und sehr viel mehr an Gut. Der Feind verlor bei diesem Zusammenstoß über tausend Mann, aber auch der Verlust S. M. war groß, denn er verlor den Sohn seiner eigenen Schwester, den jungen Pfalzgrafen, der bei seinem ersten Einsatz am 17. Juli getötet worden war. Dieser Edelmann wurde von S. M. und der ganzen Armee betrauert. Der Einsatz endete damit, daß sich S. M. in das Lager zurückzog, nachdem er einige Offiziere und Reiter zurückgelassen hatte, die dem flüchtenden Tilly und Holck nachsetzten und sie wie Hunde bis in ihr Quartier hetzten, wo beide mit knapper Not der Gefangenschaft entgingen. Die durch diesen Ausgang des wütenden Angriffs enttäuschten Schweden kehrten nach S. M. in das Lager zurück, nachdem sie durch diese Niederlage Schrecken in die Armee des Feindes getragen hatten.“[65]
„Gustav Adolph hatte bei der Nachricht von Tillys Nahen seine auf der linken Elbseite befindliche Kavallerie am 26. Juli in Arneburg[66] gesammelt und war in die Gegend von Wolmirstedt geritten, wo sein Gegner am folgenden Tage eintraf. Am weitesten vorgeschoben waren die kaiserlichen Reiterregimenter Ernesto Montecuccoli in Burgstall, Pernstein in Sandbeiendorf und Holck in Angern. Diese etwa 1000 bis 1200 Mann wurden in der eingefallenen Dunkelheit angegriffen und zersprengt. Die zweitgenannte Einheit hatte im Kampfe die Caracole mit dem üblichen unseligen Ergebnis angewandt, und Oberst Pernstein war gefallen. Die Anzahl der Toten war aber nicht unbedingt gross, der fast vollständige Verlust an Pferden und Bagage empfindlich, am schlimmsten wohl die Blamage, welche von den Schweden publizistisch weidlich ausgeschlachtet wurde. Die Gefechte von Burgstall könnten trotz allem als belanglos übergangen werden, wenn sie nicht so symptomatisch für den damaligen Feldzug gewesen wären: Die Feinde Gustav Adolphs pflegten mehr und gravierendere Fehler als der König zu machen und hatten ihm im vorliegenden Falle durch die Kombination zweier grober Schnitzer den Sieg in die Hand gespielt.
Zum einen war der Wachtdienst ungenügend organisiert gewesen und hatte sich auf die Quartiere der einzelnen Regimenter beschränkt. Die drei überfallenen Einheiten waren – wie der später berühmte jüngere Montecuccoli betonte – keinesfalls nachlässig gewesen. Doch die weitere Umgebung war weder durch Patrouillen noch durch Vorposten gesichert gewesen, so dass sich in jener Nacht zwei schwedische Regimenter sogar bis ans Hauptquartier Wolmirstedt heranmachen konnten und «von keiner sonderlichen wacht und ordinantz ausserhalb vom lermenschlagen» etwas feststellen konnten. Zweitens war gegen den Gemeinplatz verstossen worden, dass man bei akuter Gefahr nicht zerstreut in Dörfern, sondern geschlossen in einem Lager zu kampieren hatte. Oberst Holck, der so angewidert war, dass er sich mit Rücktrittsabsichten trug, schob die Schuld vollumfänglich dem Generalquartiermeister – es war der Bayer Lorenz von Münch – zu. Aber wenn dieser keine Leuchte war, weshalb remedierte Tilly nicht ?“.[67]
Da die Schweden den kaiserlichen Truppen den Nachschub abgeschnitten hatten, versuchte Tilly sein Heil im Angriff auf Werben. Der Angriff scheiterte und Tilly musste sich zurückziehen.
Die nächste Feindberührung mit den Schweden endete mit einer totalen Niederlage der kaiserlichen Truppen. Am 17.9.1631 standen sich bei Breitenfeld[68] die vereinten schwedischen und sächsischen[69] Heere und das kaiserliche Heer unter Tilly gegenüber. Die Schlacht war der Anfang vom militärischen Ende Tillys. In dieser Schlacht, die Pappenheim provoziert hatte und die Tilly entgegen seiner taktischen Pläne annehmen musste, kämpfte Otto Ludwig auf dem rechten Flügel der Schweden. Er wurde gegen drei Uhr nachmittags von Pappenheims Dragonern durch eine Flankenbewegung im Rücken angegriffen. Bei üblicher Schlachtordnung hätte dies bereits verhängnisvoll für die Schweden enden können. Durch die neue Schlachtordnung in Schachbrettaufstellung konnten Fußvolk und Reiterei in kürzester Zeit ihre Verteidigungsrichtung ändern. Dadurch geriet Pappenheim mit seinen Reitern völlig unverhofft in das Abwehrfeuer der Schweden und musste sich so gut es ging zurückziehen. Obwohl in dieser Schlacht die mit den Schweden verbündeten sächsischen Truppen den anstürmenden Kaiserlichen keinen langen Widerstand entgegensetzten (Johann Georg I. floh als erster), war der Sieg Gustav Adolfs total. Tilly und Pappenheim verloren 20 Kanonen, 12.000 Mann als Tote und 7.000 Gefangene. Nach der Schlacht von Breitenfeld war das Reich für die schwedischen Invasoren offen. Das Aktionsfeld Otto Ludwigs verlagerte sich ab Dezember 1631 in die Gegend des Rheins, der Mosel und des Elsass.
Die Zeit zwischen Januar 1632 und September 1634 war für den Rheingrafen eine ununterbrochene Folge siegreicher Schlachten und Gefechte. Auf Grund seiner Erfolge kann man wohl annehmen, dass Otto Ludwig zu den erfolgreichsten Feldherren des 30jährigen Krieges gezählt hätte, wenn er nicht schon mit 37 Jahren gestorben wäre.
Im Februar 1632 schlug Otto Ludwig, der erst Oxenstierna,[70] dann Horn unterstellt war, die spanischen Hilfstruppen an der Mosel, zusammen mit französischen Truppen unter dem Befehl des Herzogs von Orléans bei Veldenz[71] und stürmte Kirchberg[72] im Hunsrück. Er ebnete Ende Februar 1632 den Weg zur schwedischen Eroberung Kreuznachs[73] (1.3.). Als der spanische General Cajero den Rheingrafen mit einen Überraschungsangriff überfallen wollte, geriet er am 13.4. selbst in eine Falle des Rheingrafen, verlor 12 Kompanien und eine große Anzahl seiner Offiziere. Cajero konnte sich nur mit Mühe nach Mainz[74] in Sicherheit bringen.
Als Cajero im Mai 1632 gemeinsam mit General de Silva heimlich Speyer[75] verlassen und sich an der Mosel zurückziehen wollte, griff ihn Otto Ludwig zwischen Worms[76] und Kreuznach erfolgreich an, nahm ihnen die gesamte Bagage ab und verfolgte die Flüchtenden bis Trier.[77] Von August bis November 1632 kämpfte Otto Ludwig unter Horn in Württemberg und im Elsass erfolgreich gegen Ossa und Ernesto Montecuccoli. An der entscheidenden Schlacht des schwedischen Heeres gegen die Truppen Wallensteins im November 1632 bei Lützen[78] war Otto Ludwig nicht beteiligt, denn die Chroniken berichten, dass der Rheingraf am 16.6.1632 bei Schlettstadt[79] die dort stationierte kaiserliche Reiterei schlug.
In den Jahren 1633 und 1634 setzte Otto Ludwig seine militärischen Erfolge fort. Horn musste sich mit seinem Heer dem des Bernhard von Sachsen-Weimar anschließen, so dass der Rheingraf selbstständig im Elsass und den angrenzenden Territorien operieren konnte. In dieser Zeit hielt er die Heere der kaiserlichen Generäle Aldringen, Feria, die des Markgrafen Wilhelm V. von Baden und des Herzogs Karl IV. von Lothringen[80] in Schach und fügte ihnen zum Teil große Verluste zu.
Allerdings hatte es Otto Ludwig nicht nur mit kaiserlichen Soldaten zu tun; die unmenschliche Ausplünderung der ländlichen Bevölkerung führte auch im Elsass zu Bauernaufständen. Die katholische Bevölkerung der schwer in Mitleidenschaft gezogenen Länder sah in den Schweden nicht die Heilbringer. Mit zunehmender Dauer des Krieges entglitt den Kommandeuren die Disziplin der schwedischen Truppen. Das ursprüngliche protestantische Sendungsbewusstsein war abhanden gekommen; Raub und systematische Verwüstung der eroberten Gebiete machte die schwedische Soldateska zum Inbegriff von Vernichtung. Dabei war es für die heimgesuchte Bevölkerung völlig unerheblich, ob der Kommandeur der plündernden Truppen ein Schwede oder ein Deutscher war. Praktisch musste der Rheingraf gegen die kaiserlichen Truppen und einen zivilen Gegner in Gestalt aufständischer Bauern kämpfen, wobei der „zivile Gegner“ fast immer der Verlierer war. Bei dem Dorf Dammerskirch[81] (Ober-Elsass) ließ Otto Ludwig 1600 aufständische Bauern niedermetzeln.
Nachdem Otto Ludwig im Juni 1633 durch 8.000 Mann des Markgrafen Friedrich V. von Baden-Durlach verstärkt wurde, schlug er Soye und Ernesto Montecuccoli bei Breisach[82] und nahm beide gefangen.
Montecuccoli starb bald danach in der Gefangenschaft; nach anderen Quellen soll er in Colmar[83] Selbstmord begangen haben.
In den ersten Monaten des Jahres 1634 stellten die Kaiserlichen unter Franz von Mercy und Wilhelm V. von Baden ein neues Heer auf. Der Rheingraf war ihr erster Gegner. Er eroberte nacheinander Sulz,[84] Gebweiler,[85] Ruffach[86] und zwang die Kaiserlichen, sich in die Gegend um Thann[87] zurückzuziehen. Am 2.3.1634 kam es zur Schlacht, in deren Verlauf die Kaiserlichen 1.700 Mann verloren und die Obristen Salm, Mercy und der Marquis von Bassompierre gefangen wurden. Anschließend gelang es ihm, die Städte Thann, Belfort,[88] Altkirch,[89] Neuburg[90] und Freiburg[91] zu erobern.
In der Nr. 25 der „Wochentliche[n] Postzeittungen“ vom 20.6.1634 heißt es in einer Meldung aus Breisach vom 9.6.1634: Die Statt Rheinfelden[92] ist nunmehr ihrer blütigen Belägerung so viel als fast erlassen / dafür Gott zu dancken / vnd die mannhaffte Besatzung billich zu preysen. Vor diesem Stättlein haben die Schwedische Rheingräfische den Kopff ziemblicher massen hart gestossen / vnd obwol sie ihre eusserste mühe vnd Arbeit mit continuirlichem beschiessen / Approchiren / Sturmb anzulauffen / Granaten hinein zu werffen / etc. daran gewendet / iedoch zu ihrem Intent nicht gelangen können. Der an Ihr. Königl. Mayest. zu Hungarn vñ Böheimb / etc. vnlängst von hiesiger Statt abgeordneter Herr Hauptmann Reich / ist vor 3. oder 4 Tagen wider anhero kommen / berichtet imgleichen / daß die Italianische Armada ehest dieser Orthen zu erwarten. Der Com̃endant in Rheinfelden hat geschrieben / wolte selbige Statt / wiehart der Feindt auch darauff drünge / noch in 6. Wochen lang manuteniren vnd verthedigen / derselb aber ist mit vnglaublichem Nachtheyl vnd Ruin seiner Armee dauon gezogen. Im letzten Sturm hat Er vber 500. Mann dafür eingebüsst / deren er vnterschiedliche gethan / aber jedesmahls mit verlust zurück getrieben worden. Im Abzug haben die Schwedische viel Todten vnd Verwundten auff Wägen gelegt / hernach die Verwundten theils nach Speyer[93] / Wormbs[94] / Mayntz / vnd der Gegend geführt / vmb sie allda zu Curiren / vnnd zu erfrischen / ligen jetzo von ferne vmb gemelte Statt Rheinfelden her“.[95]
„Das Nassauische Infanterie-Regiment stand immer noch im Elsaß unter dem Rheingrafen Otto Ludwig und hatte im vorigen Jahr Gelegenheit gehabt, einen guten Fang zu thun. Der Rheingraf Otto Ludwig war nämlich auf eine listige Weise von einem Commando zu Meyerheim[96] überfallen worden. Um diesen Schimpf wieder auszulöschen, hatte er am 15. Juni [1634, BW] seinen Oberstlieutenant Kallenberg mit 14 Trupp Reitern und einigen Musquetiren bei nächtlicher Weile nach Breisach[97] geschickt, jedoch mit dem Befehl, daß sich die Hälfte in einem nahgelegenen Dorfe verbergen, der andere Theil aber die Besatzung vor die Stadt locken sollte. Dieses glückte auch vollkommen. Graf Ernst von Montecuculi rückte mit sieben Compagnien und einer starken Anzahl Musquetiren heraus, um die Schweden zu verfolgen. Nachdem diese einer scheinbaren Flucht sich überlassen, kehrten sie plötzlich um, worauf die in dem Dorfe verborgenen Reiter hervorbrachen und viele Gefangene machten. Graf von Montecuculi erhielt einen Schuß in den Schenkel und drei Wunden am Kopfe; derselbe wurde von dem Regiment Nassau gefangen und nach Colmar[98] gebracht, wo er sich wollte heilen lassen, aber bald zu Ensisheim[99] an seinen Wunden starb“.[100]
In dem „Gründlichen Bericht“[101] über die Schlacht bei Hessisch Oldendorf am 8.7.1634[102] heißt es im Anhang: „Der Rheingraf hat nicht weit von Prysach 16. Compagnia Reuter (welche die Wahlstädt[103] entsetzen wollen) geschlagen / vnd inen 8. Cornet abgenom̃en. Philipsburg[104] sampt der Stadt Vttenheim[105] / wird von den Schwedischen starck blocquirt / deßgleichen geschicht denen in Prysach auch“.
In den „48. Ordentliche[n] Wochentliche[n] Nachrichten. 1634“ wird unter dem 25.7./4.8. aus dem Ober-Elsass gemeldet: „Reinfelden helt sich noch / ihr: Excell: Herr Rheingraff hat ein Desseing auff Breysach gehabt / so auch ohne Zweifel glücklich abgangen were / wann sie nicht durch die Bawern mit Feuermachen weren verkundschafft worden“.[106]
„Große Hoffnungen setzte Feldmarschall Horn auf die Unterstützung des Rheingrafen Otto Ludwig, der mit 3000 Mann zu Fuß und 2000 zu Roß noch mit der Belagerung Rheinfeldens beschäftigt war, welches der Oberst Franz von Mercy besetzt hielt. Erst am 29. August erreichte man dort einen Akkord, wobei Mercy mit der Garnison freien Abzug erhielt. Anstatt sich nun unverzüglich zum Hauptheer zu begeben, machte Otto Ludwig Anstalten Breisach zu blockieren. Als sich der Rheingraf letztendlich doch zur Hilfeleistung entschloß, setzte er, anstatt sich mit der schnelleren Reiterei sofort auf den Weg zu machen, zuerst das Fußvolk über den Schwarzwald in Marsch, welches, hungerleidend und abgemattet, nur langsam voran kam, und folgte mit den berittenen Regimentern nach. Lediglich den Major Goldstein schickte er mit 4 Kompanien seines eigenen Regiments zu Pferd nach Nördlingen[107] voran, welche als einzige der rheingräflichen Truppen noch am 5. September vor Beginn der Kampfhandlungen eintrafen“.[108]
„Im Herbst des Jahres 1634 entschied sich bei Nördlingen die weitere militärische Zukunft der schwedischen Armee. Der Kardinal-Infant von Spanien hatte sich auf dem Marsch in die Niederlande mit dem Heer seines Vetters und Schwagers, Erzherzog Ferdinand[109] (III.), vereinigt und gemeinsam besiegten sie in der Schlacht bei Nördlingen[110] 1634 die protestantischen Heere unter dem Befehl Horns und Bernhards von Sachsen-Weimar.[111] Otto Ludwig erzwang zwar die Kapitulation von Freiburg und Rheinfelden, verzögerte aber wegen der Belagerung Breisachs den Abmarsch nach Nördlingen und erschien erst zwei Tage nach der Schlacht. Die Beute der Sieger war beachtlich. Mehr als 300 Cornets und Fähnlein, ein damaliger Gradmesser für die Größe des Sieges, wurden erbeutet und den Monarchen zu Füßen gelegt. Von diesen präsentierten die bayerisch-ligistischen Truppen unter Herzog Karl von Lothringen 125 Exemplare, 75 Trophäen hatte allein Johann von Werths Leibregiment erobert. Dazu kam der gesamte Schwedische Troß, bestehend aus 4000 vollbeladenen Wägen, 80 Geschützen und 1200 Pferden. Die berittenen Siegertruppen, vor allem die Kroaten, schwärmten nun regimentweise aus, um die Fliehenden zu verfolgen, niederzusäbeln und Beute zu machen. ‚Im Verfolgen sind die Reutter [der Schweden] hauffenweiß von den Pferden heruntergefallen und [haben] die schlechte auch unarmierte Croatenbueben kniend mit aufgehobenen Handen umb Quartier gebetten‘, berichtete Ferdinand III. (Lahrkamp/Werth, S. 40). Zum Glück für die Flüchtigen, jedoch auch nur für die Berittenen, war der Rheingraf Otto Ludwig über Göppingen[112] bis nahe Schwäbisch Gmünd[113] herangerückt, und konnte die verfolgenden Kroaten aufhalten: ‚welcher nur drey Meilen von der Wahlstatt in bataille gehalten, und manchem guten Kerl das Leben gerettet‘. (Chemnitz II, S. 533)“.[114] Militärisch bedeutete die Schlacht bei Nördlingen das Ende der schwedischen und den ruhmvollen Höhepunkt der spanischen Armee. Nach der Niederlage schickte Bernhard von Sachsen-Weimar Befehle an alle in Franken und Württemberg verstreuten schwedischen Truppenteile, ihre Standorte zu räumen und sich mit den geschlagenen und fliehenden Truppen weiter westlich zusammenzuschließen. Er beabsichtigte eine neue Verteidigungsstellung am Rhein aufzubauen, zweihundertvierzig Kilometer hinter der ursprünglichen Frontlinie.
Auch Otto Ludwig zog Richtung Rhein, um den Pass bei Kehl[115] zu sichern. Man hatte ihm vorgeworfen, dass er durch einen zu langsamen Marsch nicht rechtzeitig bei Nördlingen angekommen sei und dadurch die Niederlage der Schweden begünstigt hätte; immerhin war er am 6.9. nur drei Meilen vom Schlachtfeld entfernt gewesen. Es war Bernhard von Sachsen-Weimar, der ihn von dem Verdacht militärischer Versäumnisse entlastete. Der Sieg hatte die Moral der kaiserlichen Truppen wiederhergestellt. Die protestantischen Städte fielen den vorrückenden Kaiserlichen unter Werth, Piccolomini und Isolano in die Hände.
„Um den neuen Oberbefehl über die Fränkische Armee gab es ebenfalls Diskussionen. Neben Herzog Bernhard meldete der Pfalzgraf Christian von Birkenfeld seinen Anspruch an. Der schwedische Reichskanzler wollte gerne beide Feldherren behalten, ‚allein jener wollte keinen neben sich, dieser keinen über sich erleiden‘. Er entschied sich schließlich dafür, Herzog Bernhard das Oberkommando zu übertragen, worauf der Pfalzgraf ‚fast disgustiret‘ nach Worms abreiste“.[116]
„Herzog Karl von Lothringen[117] hatte sich unterdessen, eine Abteilung zur Blockade Augsburgs zurücklassend,mit dem größten Teil des bayerischen Heeres in die Markgrafschaft Durlach und die Unterpfalz begeben. Nachdem er auf dem Weg dorthin Heidenheim,[118] Eppingen[119] und Pforzheim[120] eingenommen hatte, zog er mit der bayerischen Reiterei und 6 Feldgeschützen am 23. September von Pforzheim nach Ettlingen,[121] wo er am 25.9. ankam, um sich von dort weiter auf die Verfolgung des Rheingrafen zu begeben. Am 26.9. ging es weiter nach Steinbach[122] (bei Bühl[123]) und am 27.9.1634 näherten sich die Bayern der Rheinbrücke bei Kehl.[124] Auf der Höhe von Willstätt[125] kam es zu einem kleineren Gefecht mit den rheingräflichen Truppen, welche durch die mittlerweile zum bayerischen Heer gestoßenen Werth’schen Reiter einige Verluste erlitten. Rheingraf Otto Ludwig, der beabsichtigt hatte, bei Willstätt sein Armeekorps zusammenzuziehen, war von Offenburg[126] kommend, wo er zusätzliche Truppen gesammelt hatte, im Anmarsch auf Straßburg. Als der Rheingraf, welcher mit nur 15 Begleitern vorausritt, auf das bayerische Reiterregiment Keller stieß, war er der Meinung, dieses gehöre zu seinen Truppen und ritt eine Zeitlang parallel zu diesem. Seinen Irrtum schließlich bemerkend, gab er, verfolgt von den Keller’schen Reitern, seinem Pferd die Sporen und versuchte, an der Kinzig angekommen, diese unter dem Kugelhagel der Verfolger schwimmend zu überwinden: ‚da er dann sambt dem Pferde über ein schrecklich hoch Gestade hinab, gantz unters Wasser und den Schleim [Schlamm] sich gestürtzet, nachgehens dem Pferde den Kopff mit den beiden Fäusten wieder hervorgezogen, und bis ans andere Gestade durchgeschwummen, das pferd, dieweilen demselben, da hinauff zuklettern nicht müglich, verlassen, sich an den Bäumen und Gesträuche hinauff geholffen und also, unerachtet des continuierlichen Schiessens vom Feinde, gantz unversehret auf die andere Seite gelanget‘.
Otto Ludwig erreichte also wirklich das andere Ufer, wo sich erneut ein tiefer Graben auftat, den er ebenfalls durchschwamm, sich mehrere Stunden in einem Busch versteckte und sich mit Hilfe eines Hanauischen[127] Bauern schließlich nach dreistündiger Fußwanderung nach Kehl zu seinen Truppen durchschlug, welche er dort eilig in Schlachtordnung stellte. Auf diese traf der Herzog von Lothringen eine Stunde vor Sonnenuntergang und eröffnete mit 2 Geschützen das Feuer. Die Rheingräflichen mußten schließlich ihre Stellungen bei dem Dorf Kehl verlassen und wichen bis an die Rheinbrücke zurück, wobei eine Abteilung, die nicht rechtzeitig aus dem Dorf kommen konnte, eingeschlossen wurde und in den Flammen umkam. Durch einen Flankenangriff des frischgebackenen Feldmarschall-Leutnants Johann von Werth wurden die Truppen des Rheingrafen schließlich in die Flucht gebracht. 1500 Mann von ihnen blieben auf dem Schlachtfeld, eine große Anzahl wurde in den Rhein gesprengt. Ein Teil des Gepäcks, welches noch auf dem Weg nach Offenburg war, wurde erbeutet. Das Gefecht ging auch als ‚Schlacht an der Straßburger Brücke‘ in die Annalen ein. Aus Wut und Enttäuschung über die seit Nördlingen erlittenen Niederlagen übergab Otto Ludwig alle besetzten Städte im Elsass an die Franzosen und starb an den Folgen dieser Strapazen und Aufregungen am 16.10.1634 in Worms“.[128]
Abgesprochen war, dass die Franzosen die Truppen Bernhards mit 6.000 Mann unterstützen sollten. Aber nach der Niederlage bei Nördlingen waren die im „Heilbronner Bund“ organisierten protestantischen Verbündeten der Schweden zum Spielball ausländischer, insbesondere französischer Interessen geworden. Deshalb weigerte sich La Force, dem Rheingraf Truppen für einen geplanten Angriff auf Bayern und Lothringen zur Verfügung zu stellen. Erst später, als Frankreich Spanien und seinen Verbündeten den Krieg erklärte, konnten die Schweden und damit auch Bernhard mit verstärkten Hilfen der Franzosen rechnen. Im Vertrag von Paris verpflichtete sich 1634 Frankreich, 12.000 Mann und 500.000 Livres für den Fall bereitzustellen, dass u. a. der katholische Glaube in Deutschland auch unter schwedischem Einfluss gesichert bleibe, einige Städte im Elsass französisch blieben und kein Waffenstillstand oder Friede ohne französische Zustimmung geschlossen werden sollte.
Wegen der gegen ihn erhobenen Vorwürfe, die Schlacht bei Nördlingen absichtlich verpasst zu haben, näherte sich Otto Ludwig Frankreich an und unterzeichnete (mit Zustimmung des schwedischen Residenten Mockel) am 6.10.1634 einen Vertrag, der Frankreich Colmar und Schlettstadt auslieferte. Als eingeschworener Gegner des Kaisers sah der Rheingraf in dem Vertrag den endgültigen Bruch zwischen Ludwig XIII. und Ferdinand II.; damit war eine gefürchtete Koalition dieser beiden gegen Schweden ausgeschlossen. Otto Ludwig überlebte diese Vertragsunterzeichnung nur um wenige Tage. Die Flucht vor den Kaiserlichen, das Bad im kalten Rhein und sicher auch der permanente Raubbau an seiner Gesundheit ließen ihn nicht älter als 37 Jahre werden. Er starb am 16.10.1634 in Worms an der Pest,[129] wohin ihn Oxenstierna gerufen hatte. Nach anderen Chronisten soll er in Speyer verstorben sein. „Dienstags den 4. Novembris [1634] hatt mann dess (zu Speyer) selig verstorbenen herren Reihngraffen Otto Ludtwig leichnamb herein gebracht undt marschierten in dieser ordnung. Erstlich ginge vorher ein lieutenant mit ettlichen mussquetieren, darnach in 300 pferdt ausserlesen volck. Nach diessen ritte der hoffmeister mit den edelpagen, alle in traurkleydern, darauff folgte die leichte auff einem nidrigen wagen, mit schwartzem tuch undt einem weisssen taffeten tuch bedeckt, gezogen. Darnach ritten der herr graff von Hanaw, der graff von Leyningen, darnach viel obristen … undt alsdann wider ein trouppen reutter, wart also in die kirche zu St. Niclaus in undis gebracht undt beygesetzt biss auff fernere verordnung …“[130]
Christian II. von Anhalt-Bernburg trug am 24.10./4.11.1634 in sein Tagebuch ein: „Zeitung das der Rhejngraf, ejner von den besten Schwedischen generaln, auf dem bette, gestorben seye“.[130a]
Sechs Monate später gebar seine Witwe seinen Sohn Johann X.
„Auff Mariae Verkündigung, den 25. Martii [1635] ist dess selig verstorbenen herren Reyhngraffen Otto Ludtwig leichconduct mit grossem pracht und kosten gehalten worden. Auff dem Münsterplatz wurden gestelt 4 compagien zu fuss mit eingewickelten faendlin, die gewehr alle under sich gekehrt. Hinder der infanterie hielte dass gantze Reyhngraeffische Regiment, in taussend pferdt starck, so von der S. Laurentzen thur ahn biss hinauff gegen der apotheck zum guldenen Hirsch gestellt waren … Sobald die leichte in die kirche kommen, haben die trompeter undt heerpauken ahngefangen, nach solchen die singende chor, uberauss beweglichen … darauff Dr. Joh. Schmidt praeses eine über alle massen herrliche leichtpredigt[131] gethan … nach solchem von der gantzen cavallerie in der kirche salve gegeben … und solches dreymahl. Die kirche war so voll dampff undt rauch dass man nicht sehen konte. Die leichte wurde in St. Chatarina capell inn die krufft beygesetzt undt alle die fahnen oben über auffgehenckt, wie noch zu sehen …“[132]
Das meuternde Heer Otto Ludwigs übernahmen die neuen, aber bei weitem nicht so fähigen Rheingrafen Otto und Hans Philipp.
[1] ADB 24, S. 730-734; SCHNEIDER, Geschichte, S. 185-194; MAUJEAU, Histoire des seigneurs (1926), S. 435-444; LAHRKAMP, Werth, S. 41; ENGERISSER, Von Kronach (die derzeit beste kriegsgeschichtliche Darstellung).a
[2] Kirn [Kr. Kreuznach]; HHSD V, S. 172.
[3] Mörchingen [Morhange; Dép. Moselle].
[4] Dhronecken [LK Bernkastel-Wittlich].
[5] Vgl. HEIBERG, Christian 4.
[6] Calenberg [Kr. Springe]; HHSD II, S. 91ff.
[7] Vgl. KAISER, Politik; JUNKELMANN, Der Du gelehrt hast; JUNKELMANN, Tilly.
[8] Steuerwald [Kr. Hildesheim]; HHSD II, S. 443.
[9] Vgl. LAHRKAMP, Everhard Wassenberg.
[10] WASSENBERG, Florus, S. 106f. Vgl. den ausführl. Bericht von Des Fours bei HEILMANN, Kriegswesen, S. 275ff.; JÜRGENS, Chronik, S. 419f. Hildesheim, Bischöfliches Archiv, Beverina: Liber Historiae Collegii Hildesheimensis 11, fol. 139. Der Hildesheimer Magistrat ließ die Dom-Immunität besetzen u. warnte per Anschlag vor Beleidigungen der Katholiken; Hildesheim, Bischöfliches Archiv, Beverina: Liber Historiae Collegii Hildesheimensis J 11, fol. 152.
[11] Bei RODE, Kriegsgeschichte, S. 40, als Obristleutnant Leo Freitag erwähnt. Vgl. OMPTEDA, Die von Kronberg, S. 515f.: „Das Cronbergische Regiment hat, ohne die Nachhut abzuwarten, mit 5 Kompagnien Kürassiere gegen 14 feindliche den Angriff gethan mit solcher Furie, dass die Dänemarkische bald hernach ganz in die Flucht geschlagen wurden. […] Die Obersten Erwitte, Kronenberg und Schönberg drangen auf sie eskadronsweise ein ohne einen Schuss zu thun, und niemals kein Schermetzrin oder Langrohr gebraucht. Der Anprall war so heftig, dass Freund und Feind längere Zeit unter einander gemischt blieben. Die Dänemarkischen hielten sich tapfer. Der Feind ist so fest gewesen, dasz die Pistolen einander an das Haupt gehalten; die Dänen wandten sich dreimal zum Angriffe, aber jedesmal vergebens. Erst nach drei Stunden wichen sie und wurden bis über die Leine verfolgt. Sie liessen 500 Tote auf der Wahlstatt. Die Kaiserlichen (Ligistischen) verdankten den Sieg ohne Zweifel der Fürbitte der heil. Jungfrau Maria und des heil. Franziskus, welcher Name in dieser Schlacht das Wort gewesen. Sie eroberten 6 Cornet und 15 Fähnderstangen (Kompagniefähnlein der Arkebusiere und Dragoner); sie selbst hatten ebenfalls nicht unbedeutend gelitten. Dem kronbergischen Regiment fehlten 100 Pferde. Dafür hatte ihr Oberst mit eigener Hand den dänischen Obersten Leo Freitag Cornet erobert, der dabei blieb. Es war vorher aufgerufen: kein Quartier zu geben„.
[12] Nach LIECHTENSTEIN, Schlacht, musste ein Kürassier mit einem 16 „Palmen“ hohen Pferd, Degen u. Pistolen antreten. Der Kürass kostete ihn 15 Rt. Er durfte ein kleineres Gepäckpferd u. einen Jungen mitbringen. Der Arkebusier hatte ebenfalls Pferd, Degen u. Pistolen mitzubringen, durfte aber ein 2. Pferd nur halten, wenn er v. Adel war. Für Brust- u. Rückenschild musste er 11 Rt. zahlen. Der Infanterist brachte den Degen mit u. ließ sich für das gelieferte Gewehr einen Monatssold im ersten halben Jahr seines Dienstes abziehen. Bei der Auflösung des Rgts erhielten die Soldaten sämtliche Waffen mit einem Drittel des Ankaufspreises vergütet, falls der Infanterist noch nicht 6 Monate, der Kavallerist noch nicht 10 Monate gedient hatte; andernfalls mussten sie die Waffen ohne jede Vergütung abliefern. Der Kürassier erhielt für sich u. seinen Jungen tgl. 2 Pfd. Fleisch, 2 Pfd. Brot, 1/8 Pfd. Butter oder Käse u. 3 „Pott“ Bier [1 Pott = 4 Glas = 0, 96 Liter]. Arkebusier u. Infanterist bekamen die Hälfte. Die tägliche Ration betrug 12 Pfd. Heu, Gerste oder Hafer nach den Vorräten. An das Kommissariat musste der Kürassier für Portion u. Ration monatlich 7 Rt., an den Wirt im eigenen oder kontribuierenden Land musste der Kürassier 5, der Unteroffizier 4, der Sergeant 3, Arkebusier u. Infanterist 2 1/2 Rt. zahlen. Im besetzten Land, das keine Kontributionen aufbrachte, wurde ohne Bezahlung requiriert. Ein Teil des Handgeldes wurde bis zum Abschied zurückbehalten, um Desertionen zu verhüten, beim Tode wurde der Teil an die Erben ausbezahlt. Kinder u. Witwen bezogen einen sechsmonatlichen Sold.
[13] Vgl. REBITSCH, Wallenstein; MORTIMER, Wallenstein; SCHUBERTH; REICHEL, Die blut’ge Affair’.
[14] Osterode; HHSD II, S. 370ff.
[15] WENDT, Chronicon, S. 406.
[16] 27.8.1626: Sieg der kaiserlichen Truppen unter Tilly über das dänische Heer unter König Christian IV. und seine protestantischen Verbündeten, die bis auf die Herzöge von Mecklenburg von ihm abfielen. Die Dänen verloren etwa 6.000 Mann, 2.500 gerieten in Gefangenschaft. Zu Beginn der Schlacht waren beide Armeen etwa 19.000 Mann stark. Die genauen Verluste sind nicht mehr feststellbar. Die Dänen dürften etwa 4.000 Tote und Verwundete, 3.000 Gefangene, etwa 100 Fahnen und Standarten, dazu die gesamte Artillerie und einen Großteil ihrer Bagage verloren haben. LAHRKAMPS Angaben, Bönninghausen, S. 246 (8.000 Tote), liegen eindeutig zu hoch. Das zeitgenössischen Flugblatt »Kurtze[r] vnd einfältige[r] […] Bericht« spricht von 6.000 Toten und 2.000 Gefangenen. Tillys Verluste lagen wohl deutlich unter 1.000 Mann. MELZNER, Schlacht bei Lutter am Barenberge; VOGES, Schlacht bei Lutter am Barenberge; VOGES, Neue Beiträge, Chronik; KLAY, 27./17. August.
[17] Schwerin; HHSD XII, S. 114ff.
[18] Ratzeburg [Kr. Herzogtum Lauenburg]; HHSD I, S. 216f.
[19] Wersebe, Wolf Heinrich v.; Offizier [ – 27.8.1626 Lutter]
[20] Nerprot, Johann v.; Generalleutnant [ – 27.8.1626 Lutter]
[21] Hessen-Kassel, Philipp Landgraf v. [1604 – 17.8.1626 Lutter], Sohn des Moritz v. Hessen-Kassel. Vgl. VD17 23:263431T: SEYLER, Crato, Oratio Qua Fortissimo & bellicosissimo iuveni Philippo, Hassiae Landgravio, … Mauritii Hassiae Landgravii … filio e secundo connubio natu maximo … Quum is 17. Aug. in Luterensi praelio fortiter in hostem pugnant occubuisset, Casselis in Collegii philadelphico Mauritiano 15 Septemb. … 1626 Amoris & devotionis ergo supremus honos habitus fuit / a Cratone Seylero P.P.P. Kassel 1626.
[22] Solms-Hohensolms, Graf Hermann Adolph v.; Obrist [ – 27.8.1626 Lutter].
[23] Katlenburg [Kr. Northeim]; HHSD II, S. 263f.
[24] Pogwisch, Sievert v.; Generalkommisar [1587 – 27.8.1626 Lutter].
[25] Kalkum, Wilhelm v., genannt Lohausen [Lohehausen]; Generalmajor [Aschermittwoch 1584 auf Lohausen – 30.1.1640 Rostock].
[26] Stolberg, Bodo Ulrich Graf v.; Offizier [29.5.1596 – 28.10.1626].
[27] Twachting, N; Obrist [ – ].
[28] Geist [Geistes, Geest], Berend; Obrist [ – ].
[29] Courville [Corvill, Corvillt], Nic(h)olas de; Generalmajor [ – 1.6.1634 in Regensburg gefallen].
[30] Gunternach, N; Offizier ? [ – ].
[30a] Wolf v. Buchwald [2.5.1588-13.9.1637 Rastorf], Sohn des Joachim v. Buchwald [1553-1635]; Erbherr auf Pronstorf u. Rastorf; seit 1613 Hofmarschall Christians IV. v. Dänemark u. Norwegen [1577-1648], später königl. Landrat, 1625/26 dän. Obrist; 1631-1637 Propst des Klosters Preetz.
[31] Rantzau, Marquard; Generalkommissar, Generalmajor [ – ].
[32] DUVE, Diarium belli Bohemici et aliarum memorabilium S. 49f.
[33] Vgl. JENDRE, Diplomatie und Feldherrnkunst.
[34] Flensburg; HHSD I, S. 52ff.
[35] Fünen (dänisch: Fyn), nach Seeland und Vendsyssel-Thy Dänemarks drittgrößte Insel (abgesehen von Grönland) zwischen dem Kleinen und Großen Belt.
[36] Odense [Fyns A, Fünen]; HHSDän, S. 151ff.
[37] Assens [Fyns A, Fünen]; HHSDän, S. 16f.
[38] MAHR, Monro, S. 53. Zu Monro vgl. generalrobertmonro.com [in Bearbeitung].
[39] Wolgast [Kr. Greifswald]; HHSD XII, S. 317ff.
[40] Stralsund [Kr. Stralsund]; HHSD XII, S. 292ff.
[41] MAHR, Monro, S. 82ff.
[42] MAHR, Monro, S. 85.
[43] Vgl. BROCKMANN, Dynastie.
[44] Frankfurt a. d. Oder [Stadtkr.]; HHSD X, 177ff.
[45] Küstrin [Kostrzyn; Kr. Königsberg]; HHSD X, 441ff.
[46] Neubrandenburg [Kr. Neubrandenburg]; HHSD XII, S. 69ff.
[47] Glogau [Glogów]; HHSSchl, S. 127ff.
[48] MAHR, Monro, S. 110ff.
[49] Magdeburg; HHSD XI, S. 288ff.
[50] Vgl. STADLER, Pappenheim.
[51] Saarmund, heute Ortsteil von Nuthetal [LK Potsdam-Mittelmark].
[52] Vgl. MEDICK, Magdeburg.
[53] Landsberg [Gorzów Wielkopolski, Brandenburg, h. Polen]; HHSD X, S. 446ff.
[54] Plauen [Vogtland]; HHSD VIII, S. 279ff.
[55] Werben [Kr. Osterburg]; HHSD XI, S. 492f.
[56] Burgstall [Kr. Wolmirstedt/Tangerhütte]; HHSD XI, S. 63f.
[57] Sandbeiendorf [LK Börde].
[58] Angern [Kr. Wolmirstedt/Tangerhütte]; HHSD XI, S. 16.
[59] Caracole: (franz.; span. caracol: Schnecke), ein in der frühen Neuzeit entwickeltes, relativ verlustreiches Kavallerie-Manöver. Dabei ritt die Kavallerie in mehreren Reihen hintereinander auf die gegnerischen Linien zu. Die einzelnen Reihen feuerten jeweils ihre Salven mit ihren Radschlosswaffen auf die Gegner ab und kehrten danach sofort um (Kürassiere konnten mit ihren beiden Pistolen zweimal feuern, Bandelierreiter mit ihren Arkebusen nur einmal, hatten aber die größere Reichweite). War der Gegner ausreichend geschwächt, ging die Kavallerie jetzt in geschlossener Formation mit gezogenem Degen gegen die sich auflösenden gegnerischen Reihen vor. Damit wollte man der Benachteilung der Reiterei im Kampf gegen die Pikeniere wirkungsvoll begegnen. Durch Gustav II. Adolf wurde die Caracole im Dreißigjährigen Krieg wieder abgeschafft, ab jetzt wurde vor dem Nahkampf höchstens noch eine Salve geschossen. Grund dafür war der sinkende Teil der Pikeniere; gegenüber den Musketieren war man beim Feuergefecht als Reiter weit unterlegen, im Nahkampf dagegen deutlich überlegen. Das entsprechende Verfahren der Infanterie wurde als Enfilade bezeichnet.
[60] So noch STADLER, Pappenheim, S. 538, nach HESS, Pappenheim, S. 141; THEATRUM EUROPAEUM Bd. 2, S. 408. Auch MAHR, Monro, S. 125, behauptet, dass Pernstein gefallen sei.
[61] Vgl. ARENDT, Wallensteins Faktotum.
[62] Angeblich 1630 durch Reiter Holks zerstört. HHSD XI, S. 16.
[63] Wolmirstedt [Kr. Wolmirstedt]; HHSD XI, S. 515f.
[64] Tangermünde [Kr. Stendal]; HHSD XI, S. 458ff.
[65] MAHR, Monro, S. 125f.
[66] Arneburg [Kr. Stendal]; HHSD XI, S. 20ff.
[67] STADLER, Pappenheim, S. 537f.
[68] Breitenfeld [Kr. Leipzig]; HHSD VIII, S. 38f. Schlacht bei Breitenfeld (nahe Leipzig) am 17.9.1631, in der das Heer der katholischen Liga unter Tilly durch die Schweden unter Gustav II. Adolf und die mit diesen vereinigte sächsische Armee unter Kurfürst Johann Georg I. eine vernichtende Niederlage erlitt. HAPPES Zahlen (vgl. mdsz.thulb.uni-jena.de) liegen deutlich zu hoch: Auf kaiserlich-ligistischer Seite dürfte von 8.000 Toten, 6.000 Verwundeten, 3.000 Gefangenen und 3.000 auf der Flucht Umgekommenen auszugehen sein, auf der Gegenseite waren 3.000 Sachsen und 2.000 Schweden ums Leben gekommen. RUDERT, Kämpfe, S. 49ff.; WALZ, Der Tod, S. 51ff.
[69] Vgl. SENNEWALD, Das Kursächsische Heer (ab Dezember 2012).
[70] Vgl. FINDEISEN, Axel Oxenstierna.
[71] Veldenz [Kr. Bernkastel]; HHSD V, S. 385ff.
[72] Kirchberg (Hunsrück) [Kr. Simmern]; HHSD V, S. 169.
[73] (Bad) Kreuznach; HHSD V, S. 24ff.
[74] Mainz; HHSD V, S. 214ff.
[75] Speyer; HHSD V, S. 350ff.
[76] Worms; HHSD V, S. 410ff.
[77] Trier; HHSD V, S. 372ff.
[78] Lützen [Kr. Merseburg/Weißenfels]; HHSD XI, S. 286f. Schlacht bei Lützen am 16.11.1632 zwischen den Schweden unter Gustav II. Adolf (18.000 Mann) und den Kaiserlichen (16.000 Mann) unter Wallenstein. Die für die Schweden siegreiche Schlacht endete mit dem Tod Gustav Adolfs und dem Rückzug Wallensteins, der etwa 6.000 Mann verloren hatte, nach Böhmen. Nach Lützen schlug Wallenstein keine Schlacht mehr. Vgl. dazu HAPPES ausführliche Schilderung und Reflexion der Ereignisse [HAPPE I 295 v – 302 r; mdsz.thulb.uni-jena]. Vgl. SIEDLER, Untersuchung; STADLER, Pappenheim, S. 729ff.; WEIGLEY, Lützen; BRZEZINSKI, Lützen 1632; MÖRKE, Lützen als Wende; WALZ, Der Tod, S. 113ff.
[79] Schlettstadt/Sélestat, Reichstadt [Elsass, h. Frankreich, Dép. Bas-Rhin]; vgl. STEIN, Protéction.
[80] Vgl. BABEL, Zwischen Habsburg und Bourbon.
[81] Dammerkirch [Dannemarie; Dép. Haut-Rhin].
[82] Breisach am Rhein [LK Breisgau-Hochschwarzwald]; HHSD VI, S. 110ff.
[83] Colmar, Reichstadt [Ober-Elsass, h. Frankreich, Dép. Haut-Rhin]; vgl. STEIN, Protéction.
[84] Sulz/Soultz oder Sulz unterm Wald/Soultz-sous-Fôrets (Herrschaft Fleckenstein).
[85] Gebweiler [Guebweiler; Frankreich, Dép. Haut-Rhin].
[86] Rufach [Rouffach; h. Frankreich, Dép. Haut-Rhin].
[87] Thann [Tann, Elsass, h. Frankreich, Dép. Haut-Rhin].
[88] Belfort; Vorderösterreich [Sundgau; heute Frankreich].
[89] Altkirch a. d. Ill [Elsass; h. Frankreich, Dép. Haut-Rhin].
[90] Neuburg [Neubourg, h. Frankreich, Dép. Haut-Rhin].
[91] Freiburg im Breisgau, HHSD VI, S. 215ff.
[92] Rheinfelden (Baden) [LK Lörrach]; HHSD VI, S. 659.
[93] Speyer; HHSD V, S. 350ff.
[94] Worms; HHSD V, S. 410ff.
[95] Archives Municipales, Strasbourg AA 1065.
[96] Meienheim [Meyenheim; Frankreich, Dép. Haut-Rhin] ?
[97] Breisach am Rhein [LK Breisgau-Hochschwarzwald]; HHSD VI, S. 110ff.
[98] Colmar, Reichstadt [Ober-Elsass, Frankreich, Dép. Haut-Rhin]; vgl. STEIN, Protéction.
[99] Ensisheim [Anze, Frankreich, Dép. Haut-Rhin].
[100] KELLER, Drangsale, S. 206.
[101] Kungliga Biblioteket Stockholm Sv. Krig 228c.
[102] 28.6./8.7.1633: Schwedisch-hessische Truppen unter Dodo von Knyhausen, hessische unter Melander (Holzappel) und Georg von Braunschweig-Lüneburg schlagen die kaiserlich-ligistische Armee unter Gronsfeld, Mérode-Waroux und Bönninghausen, die an die 4000 Tote Verlust haben. In einer zeitgenössischen Flugschrift war auf die ungewöhnlich hohen Verluste in dieser Schlacht verwiesen worden; COPIA KÖNIGL. MAY. IN DENNEMARCK / ERGANGENES SCHREIBEN: „Vnnd ist der eigentliche Bericht von den Gräfflichen Schaumbergischen Dienern einbracht / daß derselben auffs höchste etwa in die vierhundert Mann / die man alle hätte zählen können / in Münden [Minden; BW] ankommen wehren / vnnd ist eine solche Schlacht geschehen / daß weder in der Leipzischen Anno 1631. noch Lützischen Schlacht / Anno 1632. so viel Todten auf der Wahlstatt gefunden vnnd gesehen worden / wie jetzo“. Abgesehen von der reichen Beute hatte der Sieg bei Hessisch-Oldendorf jedoch eine nicht zu unterschätzende Wirkung im protestantischen Lager, glaubte man doch, dass „deß feindes force vollents gebrochen sein solle“; Staatsarchiv Bamberg C 48/195-196, fol. 112 (Ausfertigung): Johann Casimir von Sachsen-Coburg an Markgraf Christian von Brandenburg-Kulmbach, Coburg, 1633 VII 04 (a. St.). In der COPIA KÖNIGL. MAY. IN DENNEMARCK / ERGANGENES SCHREIBEN hieß es: „Bei den Konföderierten sind fast alle Reuter Reich worden / vnnd ist Silber Geld vnnd Pferde gnug zur Beute gemacht worden / denn der Feind allen seinen Trost bey sich gehabt: Deßwegen vnsere Hohe- vnnd Nieder Officirer vnnd alles Volck dermassen Resolut zum fechten gewesen / daß nit zu glauben / noch gnugsam außzusprechen / vnd ist abermahls der Papisten Ruhm / in der Compositione pacis prächtig angeführt: Daß die Evangelische keine offene FeldSlacht wider die Papisten niemals erhalten / durch Gottes Krafft zu nicht vnd zur offnen Weltkündigen Lügen geworden“. In einem Bericht aus Bericht aus Osterode, 1633 VII 01 (a. St., Kopie); Postskriptum, heißt es sogar: „Ferner kompt bericht, daß in etlichen unseren kirchen und schulen der herrlichen vittory halber welche höher als die iüngste vor Lützen erhaltene schlacht zu æstimiren, gebetet und gesungen“ [worden].Staatsarchiv Bamberg C 48/195-196, fol. 146 v.
[103] Waldstädte: Rheinfelden, Bad Säckingen, Laufenburg u. Waldshut.
[104] Philippsburg [LK Karlsruhe]; HHSD VI, S. 632f.
[105] Udenheim [LK Alzey-Worms].
[106] Archives Municipales, Strasbourg AA 1065.
[107] Nördlingen [LK Donau-Ries]; HHSD VII, S. 525ff.
[108] ENGERISSER, Von Kronach, S. 309ff. (die zurzeit beste kriegsgeschichtliche Darstellung).
[109] Vgl. HÖBELT, Ferdinand III.
[110] Schlacht bei Nördlingen am 5./6.9.1634 zwischen den kaiserlich-ligistischen Truppen unter Ferdinand (III.) von Ungarn und spanischen Kontingenten unter dem Kardinal-Infanten Fernando auf der einen Seite und dem schwedischen Heer unter Feldmarschall Gustav Horn, der in eine 7 Jahre dauernde Gefangenschaft geriet, und Bernhard von Weimar auf der anderen. Die Schwedisch-Weimarischen verloren nicht allein die Schlacht, etwa 8.000-10.000 Tote und 3.000-4.000 Verwundete – auf kaiserlicher Seite waren es 1.200 Tote und 1.200 Verwundete – , sondern mit ihr auch den Einfluss in ganz Süddeutschland, während der französische Einfluss zunahm. Vgl. die ausführliche Darstellung bei ENGERISSER; HRNČIŘĺK, Nördlingen 1634 (die detaillierteste Darstellung der Schlacht); STRUCK, Schlacht, WENG, Schlacht. Vgl. den lat. Bericht »Pugna et victoria ad Nordlingam«, der den protestantischen Ständen zuging; Staatsarchiv Bamberg B 48/145, fol. 74 (Abschrift). Zur französischen Sicht vgl. den Avis Richelieus, 1634 IX 11; HARTMANN, Papiers de Richelieu, Nr. 288.
[111] Vgl. JENDRE, Diplomatie und Feldherrnkunst.
[112] Göppingen; HHSD VI, S. 260f.
[113] Schwäbisch Gmünd [Ostalbkr.]; HHSD VI, S. 720ff.
[114] ENGERISSER, Von Kronach, S. 344.
[115] Kehl [Ortenaukr.]; HHSD VI, S. 395f.
[116] ENGERISSER, Von Kronach, S. 349.
[117] Vgl. BABEL, Zwischen Habsburg und Bourbon.
[118] Heidenheim a. d. Brenz [LK Heidenheim]; HHSD VI, S. 312f.
[119] Eppingen [LK Heilbronn]; HHSD VI, S. 184f.
[120] Pforzheim [Stadtkreis]; HHSD VI, S. 627ff.
[121] Ettlingen [LK Karlsruhe]; HHSD VI, S. 199ff.
[122] Steinbach [Stadtkr. Baden-Baden ]; HHSD VI, S. 753.
[123] Bühl [LK Rastatt]; HHSD VI, S. 123f.
[124] Kehl [Ortenaukr.]; HHSD VI, S. 395f.
[125] Willstätt [Ortenaukr.]; HHSD VI, S. 892f.
[126] Offenburg [Ortenaukr.]; HHSD VI, S. 607ff.
[127] Hanauerland; HHSD VI, S. 285f.
[128] ENGERISSER, Von Kronach, S. 358f.
[129] REUSS, Strassburg, S. 31, Anm. 2. Die Hinweise verdanke ich Herrn Uwe Volz.Nach FRANCK, Wild- und Rheingraf Otto Ludwig, S. 487, ist er am 7./17.10.1634 in Speyer verstorben.
[130] REUSS, Strassburg, S. 31.
[130a] http://diglib.hab.de/edoc/ed000228/start.htm: Bl. 172v.
[131] Die erwähnte Leichenpredigt von Dr. Johann Schmidt erschien 1635 in Straßburg im Druck und trägt den Titel: „Christliche Leichpredigt / Vber den tödlichen vnd seligen Abschied / Deß hochwohlgebornen Graven vnd Herren / Herren Ott-Ludwigen / Wild- vnd Rheingraven / Graven zu Salm vnd Herren zu Vinstingen/ [et]c. Der Königlichen Cron Schweden vnnd Vnirter Evangelischer Stände hochverdienten Generals vnd Obristen zu Roß vnd Fuß: Welcher in nächst-abgewichenem 1634 Iahr / den 6. Octobr. in deß Heil. Reichs-Stadt Speyer sanfft vnd selig in Christo Iesu entschlaffen“ [VD17 23:265420N].
[132] REUSS, Strassburg, S. 31.
Veröffentlicht unter Miniaturen
|
Verschlagwortet mit S
|
Callenberg [Calenberg, Kahlenberg, Kalenberg, Kalemberg, Kahlemberg, Kabenbeck] Curt Reinecke I. Reichsgraf von; Obrist [17.9.1607 Wettesingen bei Volkmarsen-7.5.1672 Muskau]

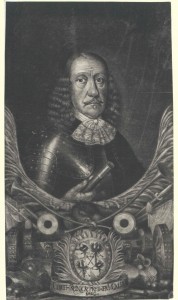
Curt Reinecke I. von Callenberg[1][Calenberg, Kahlenberg, Kalenberg, Kalemberg, Kahlemberg, Kabenbeck][17.9.1607 Wettesingen[2] bei Volkmarsen[3]-7.5.1672 Muskau[4]] war der Sohn des französischen Obristleutnants Hermann von Callenberg und dessen Ehefrau Margarethe von Bodenhausen und der Bruder von Otto Heinrich von Callenberg. Nachdem er zunächst von einem Hauslehrer unterrichtet worden war, besuchte er die witzlebische Landesschule in Roßleben.[5] Aus finanziellen Gründen konnte Callenberg sein Studium an der Universität Marburg[6] nicht aufnehmen.
Noch im selben Jahr trat er daher als Page des Grafen Johann II. von Mérode-Waroux in das Heer Wallensteins[7] ein. In der Schlacht an der Dessauer Elbbrücke[8] im September 1626 gegen Ernst von Mansfeld[9] zeichnete er sich als Kürassier aus. Nach den Kämpfen in Ungarn wurde Callenberg 1629 zum Fähnrich befördert. Ein Jahr später wurde er als Leutnant für zwei Jahre nach Greifswald[10] unter den Befehl von Luigi di Perusi und nach der Eroberung von Greifswald nach Rostock[11] versetzt. 1631 diente er als Kapitänleutnant unter Caspar von Gramb in Wismar.[12] 1632 war er in Kostenblut[13] zum Hauptmann befördert worden. Bis 1634 war er in Schlesien stationiert. Er nahm dann auch seinen Abschied und unternahm 1634 eine Art Kavalierstour durch die Generalstaaten. Gerüchte, diese Reise diente einer geheimen diplomatischen Mission, bestätigten sich nicht. Nach seiner Rückkehr im Januar 1635 trat Callenberg in Torgau[14] als Obristwachtmeister in das 1. kursächsische Leibregiment[15] unter der Führung von Dietrich von Taube ein.
1635 nahm ihn Fürst Ludwig I. von Anhalt-Köthen als „der Durchwachsende“ in die „Fruchtbringende Gesellschaft“ auf.
Bei der Niederlage von Wittstock[16] 1636 zeichnete er sich durch Tapferkeit aus. 1638 wurde er zum Obristleutnant befördert. Ende 1639 geriet er bei Leipzig[17] in schwedische Kriegsgefangenschaft, die er durch einen Gefangenenaustausch bald wieder verlassen konnte.
In den Jahren 1641/42 kämpfte Callenberg in Schlesien gegen die Truppen Torsten Stålhandskes. Wegen seiner Tapferkeit wurde er zum Obristen des 1. Leibregiments befördert. Er nahm 1642 an der 2. Schlacht von Breitenfeld[18] und 1643 am Entsatz von Freiberg[19] teil. Am 31.3.1643 stürzte er auf der Flucht vor den Schweden im Schlossgraben des Schlosses Senftenberg[20] (Niederlausitz) vom Pferd und verletzte sich schwer.
1644 konnte er zwar die schwedischen Truppen aus Sonnewalde[21] und Lübben[22] vertreiben, scheiterte aber in Luckenwalde.[23]
Der schwedische Rittmeister Langemaken gab „sogar im folgenden Jahre 1644 die Stadt [Sonnewalde; BW] aus Furcht vor den Kaiserlichen auf, und zog sich den 10. Mai, sie ihrem eigenen Schicksale überlassend, mit seinen Reitern aufs Schloß zurück. – Hier sorgte er eifrig für die Proviantirung des Letzteren. – Alle Vorräthe, welche auf demselben Bürger und Landleute dem Schutze der Besatzung anvertraut hatten, wurden von ihm den 16. Mai mit Arrest belegt. – Das war eine Vorsichtsmaßregel, die für ihn um so nöthiger sein mochte, da bei dem, den 12. Mai in Luckau,[24] angeblich durch unvorsichtiges Tabakrauchen eines Schotten, entstandenen Brande, der die Stadt nebst Kirche, Rathhaus und Apotheke bis auf dreißig Häuser und den, die große Glocke tragenden, Kirchthurm in Asche gelegt hatte, auch sämmtlicher Proviant der dasigen Besatzung verloren gegangen, und der der von der Stadt Sonnenwalde aus abgegangene, in zwanzig Wagen bestehende Transport, welcher diesen Verlust auf der Stelle ersetzen sollte, von kurfürstlich sächsischen Truppen genommen worden war.
Bereits im April war die Besatzung des Schlosses durch die Compagnie des schon genannten Rittmeisters Langemaken, den man zwar zur Verstärkung der Luckauer Besatzung zu Ende vorigen Jahres von Leipzig berufen hatte, dessen Reiter sich aber mit der dasigen schottischen Besatzung nicht befreunden konnten, vermehrt worden. Dieser half nach seiner Art treulich bei Vermehrung des Schloßproviants. Täglich durchstreiften seine Reiter meilenweit, – bis nach Dahme[25] hin, – die Gegend, und kehren mit reicher Beute an Vieh und Getreide nach Sonnenwalde zurück. – Die nächsten Umgebungen der Stadt sind längst, von Menschen und Vieh entblößt, zu Wüsten geworden; denn das alte, aber dem Zeitpunkte seiner Bestätigung immer näher rückende Gerücht einer, durch die Kaiserlichen beabsichtigten, Blockade der Städte Luckau und Sonnenwalde hat alles verscheucht.
In der That zeigen sich im Juni kurfürstlich sächsische Reiter vor den Mühlen der Stadt und verbieten, unter harten Drohungen, den Müllern für die feindliche Besatzung des Schlosses Getreide zu mahlen. – Dagegen brennt bald darauf Rittmeister Langemaken die Mühlen nieder, deren Besitzer dem Gebote gehorchten, und sich von ihrem Geschäfte zurückzogen.
In der Stadt selbst sucht der Commandant Lunden alles zu entfernen, was hier dem belagernden Feinde förderlich, und das auf das Oberschloß zu schaffen, was dort den Belagerten nützlich werden konnte. – Alles Holz, namentlich auch das zum Kirchbau bestimmte, muß das Oberschloß aufnehmen. – Unterdessen durchsuchten die Reiter des Rittmeisters Langemaken alle Gemächer des Schlosses, heben alles Blei, das den Fensterstäben und anderem Eisenwerke zur Befestigung diente, aus den Werkstücken und verwandeln es in Kugeln, die den zur Belagerung sich nahenden Feind bewillkommen sollen.
Fünf Tage zuvor hatten bereits des Rittmeisters Reiter die Kraft ihrer Kugeln an den kurfürstlich sächsischen Reitern erprobt, die in kleinen Abtheilungen auf dem, von der Stadt nach Goßmar[26] führenden, hohen Wege herumschwärmten, aber in drohenden Massen aus dem zwischen Pießigk[27] und Münchhausen[28] gelegen Eichbusche hervorstürzten und den beutelustigen Rittmeister, der ihnen mit seinen Reitern entgegengerückt war, mit dem Verluste eines Corporals in die Stadt zurückjagten, und noch weiter verfolgt haben würden, wenn sie nicht durch die, ihren Kameraden Hülfe bietenden Schotten auf den Stadtwällen zurückgeschreckt worden wären.
Unverhohlen spricht den 14. Juni ein kurf. sächsisch. Trompeter, der von Goßmar aus, wegen Auslieferung eines Gefangenen, das Schloß betritt und aus demselben, der soldatischen Artigkeit der damaligen Zeit gemäß, wohl berauscht entlassen wird, die Absicht der Kursächsischen aus, und verheißt, indem er auch das Feindliche in das Gewand der Artigkeit kleidet, den Schloßbewohnern einen baldigen zahlreichen Besuch.
Dieser Besuch traf zwei Tage darauf ein und hatte die fest zwei Monate dauernde, von der Stadt aus geleitete Blockade des Schlosses zur Folge. – Den 16. Juni, des Nachts um 1 Uhr, kam der kurfürstlich sächsische Obrist, [Callenberg, der die Avant-Garde des, unter dem General-Major Enkenfurth [Adrian v. Enckevort; BW] bei Camenz[29] gesammelten, sächsischen Corps befehligte, mit seinem aus Dragonern bestehenden Regimente an, und nahm die, von der Schlossbesatzung schon längst verloren gegebene, Stadt ohne Widerstand ein, indem die auf den Wällen Wacht haltenen Schotten aufs Schloß sich zurückzogen. Während Lunden, der Commandant des Schlosses, weitere Zurüstungen zur Vertheidigung trifft, eilt Callenberg selbst, Luckau zu blockieren, und überlässt dem Rittmeister, Peter Beckolt, die Commandantur über die Stadt, und die Blockade des Schlosses.
Obgleich Lunden schon längst, außer den Beamten und dem Superintendenten, alle Bewohner der Stadt und Umgebung, mit Innebehaltung ihrer Habe, vom Schlosse entfernt hatte, hatten sich doch mehrere Personen, besonders Frauen, Jungfrauen und Kinder, den Abend vor der Einnahme der Stadt ins schützende Schloß zu schleichen gewußt, und fanden sich jetzt, mehr zur Beunruhigung des Commandanten als der ihrigen – denn man zog damals die Gefahren einer Belagerung der Willkür einbrechender Soldaten vor – mit eingeschlossen.
Der Angriff auf das Schloß wurde sofort dadurch eröffnet, dass man aus einigen, dem Unterschlosse am nächsten liegenden, Häusern der Stadt ein starkes und ununterbrochenes Feuer unterhielt.
Das Bestreben der Belagerten dagegen ging dahin, den Feinden die Schutzwehr, die sie hinter jenen Häusern fanden, zu nehmen. – Es war namentlich ein, an der äußersten westlichen Ecke der Stadt gelegenes, zur interimistischen Wohnung für den Superintendenten bestimmtes, von diesem aber noch nicht bezogenes, Häuschen, und ein, in der Nähe des alten Brauhauses, dicht an der östlichen Seite des Schloßgrabens befindliches, Bürgerhaus, welche zum Gegenstande der wechselseitigen kriegerischen Operationen gemacht wurden. Die Belagerten versuchten zunächst das erstere in Brand zu stecken. Sie bereiteten zu diesem Zwecke, – wie wenigstens unser Chronikus ausführlich berichtet, – eine mit starken Lappen umwundene, verpichte und mit Pulver, Schwefel, Salpeter und Speck versehene Kugel, und warfen sie vom Schlosse aus, mittels eines kleinen Feldstücks, in das bezeichnete Haus. – Und siehe ! es gelang. – Das Gebäude ging in Feuer auf. – Erfolglos blieben aber alle ähnliche Versuche, die man gegen das Brauhaus und das, in seiner Nähe gelegene, Bürgerhaus machte. –
Bedeutenden Schaden richteten indeß die, aus dem Schlosse, gesandten Kugeln unter den, auf dem Markte frei stehenden, kurfürstlichen Truppen an. Um sich dagegen zu schützen, wurden von Soldaten und aufgegriffenen Bauern Bretter, Thore, Thüren und Tische aus den benachbarten Dörfern herbeigeschleppt, und, ungeachtet des verstärkten Feuers vom Schlosse aus und der Verwundung einiger Soldaten und Bauern, ein Blendwerk, vom Luckauer Thore über den Markt bis zur Kirche hin, den 18. Juli glücklich aufgeführt.
Wenige Tage darauf dehnte man diese Blende noch weiter aus, und brachte sie dem Schloßgraben näher.
Auf eine zwar nicht blutige, aber dennoch nicht minder Gefahr bringende Weise hatten die Belagerer schon früher der kleinen Cidatelle zu schaden gesucht. Das in der Mitte des Schloßhofes rinnende, von weit gelegenen köstlichen Quellen herbeigeführte Röhrwasser, das heute noch den Trinker labt und die Wäscherin erfreut, blieb plötzlich aus. Doch die Blockirten wußten sich zu helfen. Mehrere an den Mauern gegrabene Brunnen mußten, wenn auch nicht die Güte, doch den Mangel des Wassers ersetzen.
Ueberdieß hatten sich die Belagerten einen, dem Feinde unbekannten, Schlupfwinkel geöffnet, durch den sie manchen Bedarf aus den nächsten Umgebungen des Schlosses herbeizuführen verstanden, und aus dem sie nicht selten einen unerwarteten, mit Erfolg belohnten Ausfall auf die Belagerer machten.
Das war ein Umstand, der die Belagerer, abgesehen von der Gefahr, die er ihnen brachte, schon um deshalb beunruhigen mußte, weil ihrem Feinde ein Ein- und Ausgang der Cidatelle, die sie von allen Seiten bewacht glaubten, offen stand, durch den er oft hervordrang, unter ihren Augen in dem, an das Schloß stoßenden, Baum- oder Hopfgarten und auf der, in der Nähe des Schlosses gelegenen, sogenannten Hahnwiese fouragierte und, ehe man ihn zu erreichen vermochte, mit einem leichten Kahne über den äußersten Schloßgraben hinweg setzte und auf eine den Spähenden unbegreifliche Weise verschwand.
Ein, durch die auf dem Schlosse eingeschlossenen Frauen und Jungfrauen, deren man sich noch nicht hatte entledigen können, herbeigeführter Zufall gab endlich zur Entdeckung jenes verborgenen Ausganges die Veranlassung.
Wie über die wilde Wellenbewegung des Meeres die leitende Flamme des Leuchtthurms himmelan steigt, so stieg – ein Zeichen der allgemeinen, siegenden Kraft der Religion, wie eines durch den Geist und die Gestalt der damaligen Zeit geweckten und genährten frommen Sinnes – die stille Flamme der Andacht über das wildbewegte Leben des Krieges empor, und während das tödtende Geschoß vom Schlosse zur Stadt und von der Stadt zum Schlosse flog, hielt das heilsbedürftige Häuflein der Stadt seine kirchlichen Versammlungen, unter Leitung des Caplans, in der Behausung des Bürgermeisters, und das des Schlosses die seinigen, unter der Leitung des Superintendenten, im großen Saale des Schlosses. – und hier war es, wo man sich, nach beendigter gottesdienstlicher Versammlung, der, wider den Willen des Commandanten ins Schloß gedrungenen und durch die Belagerer eingeschlossenen, Frauen und Jungfrauen plötzlich versicherte, und sie, ungeachtet ihres Sträubens und Flehens, – denn schändende Mißhandlung roher Krieger konnte leicht außerhalb der schützenden Schloßmauer ihr Loos werden, – vom Oberschlosse herabtrieb, um sie über die Zugbrücke des Unterschlosses in die Stadt zu entlassen. Aber die, wegen ihrer Aufnahme in die Stadt mit dem kurfürstlich sächsischen Commandanten gepflogene, Unterhandlung zog sich in die Länge. Unterdessen war es einem Theile der Frauen und Jungfrauen gelungen, in das Oberschloß wieder zurückzukehren, während man die übrigen, wider den Willen des Commandanten, aus jenem verborgenen Ausgange der Citadelle, der den Belagerern so lästig und den Belagerten so vortheilhaft war, heimlich entließ. Mit ihnen waren durch eben den Ausgang zwei Stallbuben des Schlosses unbemerkt im Gedränge entwichen und nahmen, während jene nach Herzberg[30] flüchteten, ihren Weg, durch den Baumgarten schleichend, zur Stadt. Hier wurden sie vor dem kurfürstlichen Commandanten die Verräther des Ausganges.
Es war eine, auf der westlichen Seite des Schlosses durch die Mauer gebrochene, Oeffnung an dem nach Zeckerin[31] zu liegenden Rundel. Sie wird jetzt ein Punkt besonderer Aufmerksamkeit des Commandanten. Mehrere Dragoner werden sofort nach der bezeichneten Stelle beordert, und finden eben noch auf der Hahnwiese fouragirende Schweden, die aufs Neue den Ausfall benutzt hatten, sich aber schnell, bei Ankunft des stärkeren Feindes, zurückziehen. Verstärkt und vorbereitet, wagen sie indeß mehrmals, ihre vermeintliche Gradeberechtigung mit dem Schwerte in der Hand gegen die wachthabenden Dragoner zu behaupten.
Commandant Beckolt läßt daher mitten in der Nacht, dem verderblichen Ausfall gegenüber, eine Batterie errichteten, und versucht sie den folgenden Tag mit glücklichem Erfolge. Sie war es, durch die der, im Schlosse anwesende, Superintendent, Christianus Dröschelius, am Schlafe gefährlich verwundet und auf ein Krankenlager geworfen wurde, während dessen Dauer der mit ihm eingeschlossene Pastor des Dorfes Schönewalde,[32] Namens Rudolphi, im Schlosse kirchlich fungirte.
Bald darauf wird auf der vollen westlichen Seite des Schlosses im Baumgarten, – jetzt Hopfgarten genannt, – ein Laufgraben geöffnet und eine Blende errichtet.
Eine zweite Batterie erhebt sich in der folgenden Nacht auf dem hinter der alten Schulstelle gelegenen Walle, dem westlichen Eckrundel, dessen Ruine das bedeutendste Ueberbleibsel der Schloßmauer ist, gegenüber, und eine dritte im Baumgarten hinter den Fischhältern. Endlich wird in der Nähe der Schloßbrücke vor dem, die Stadt vom Schlosse trennenden, Graben ein Laufgraben geöffnet, und eine mit Schießscharten versehene, geschlossene Blende aufgeführt. – Jetzt ist das Schloß von allen Seiten blockirt.
Der Mangel, eine Folge des verrathenen Ausgangs, wird fühlbar. – Brennholz müssen hölzerne Treppen und Meublen geben, und nach Lebensmitteln durchsucht man aufs Neue alle Gemächer des Schlosses. Mehl findet sich nicht, dagegen Heidekorn[33] und Roggen. Und jetzt müssen Frauen und Jungfrauen, die bei Entfernung ihrer Gefährtinnen das Schloß wieder erreicht hatten, ans Werk, und auf den Handmühlen aus dem aufgefundenen Getreide den Bedarf des Mehles für die Besatzung bereiten. –
Verderblich wird der Mangel bei den Rossen. Große Gruben in der Nähe der Wälle nehmen die auf, welche ihm erlagen oder welche, als halbverhungerte Gerippe, das Grauen erregende Mitleid der Soldaten hineinstürzt. –
Man fängt den 3. August ernstlicher an zu verhandeln als zuvor. Denn bereits den 14. Juli stellte man die Feindseligkeiten, seit ihrem Beginnen zum ersten Male, auf einige Stunden ein, und sahe den kurfürstlichen Lieutenant, Peter Sperling, der einen Monat darauf im Scharmützel bei Lübben fiel, das Unterschloß betreten, während der schwedische Rittmeister mit den übrigen kurfürstlich sächsischen Offizieren auf der Schlossbrücke eine Verhandlung pflog, die sich zerschlug und erneute und verstärkte Feindseligkeiten, besonders von Seiten der Belagerer, zur Folge hatte. – Jetzt traf von Luckau der kurfürstliche Obrist, Callenberg, selbst ein. Zum zweiten Male schwieg seit der Belagerung das Geschütz, und man sahe gespannt dem Erfolge einer Verhandlung entgegen, die so geheim betrieben wurde, dass kein Einwohner den Wällen sich nahen durfte. –
Zwar beginnen auch nach dieser Unterhandlung und der Rückkehr Callenberg’s die Feindseligkeiten aufs Neue; aber drei Tage darauf stellt man sie nicht nur ein, sondern entläßt auch die, durch das anhaltende Mahlen ermüdeten, Frauen und Jungfrauen von den Handmühlen, nachdem sie im Laufe der Zeit gegen ein Malter Getreide gemahlen haben.
Weiteifernde Artigkeit des Krieges tritt an die Stelle des wetteifernden Streites. – Der schwedische Rittmeister, Langemaken, überschickt vom Schlosse aus durch einen Trompeter dem kurfürstlichen Obristen, Callenberg, ein schönes Windspiel, als willkommenes Geschenk, ins Lager vor Luckau, und empfängt durch eben diesen Abgesandten von den kurfürstlich sächsischen Officieren frisches Obst aus dem, gegenwärtig bedeutend erweiterten und verschönerten, von Gartenliebhabern der Umgegend oft besuchten, gräflichen Lustgarten für seine, im Schlosse krank liegende Gemahlin, als ein, nicht minder willkommenes, Labsal.
Den 8. August trifft Callenberg aufs Neue ein. Der vor dem Geschosse schützende Dünger an dem Eingange des Unterschlosses wird völlig beseitigt, die Klappen werden niedergelassen, und ein freierer Verkehr denn je öffnet sich zwischen den Officieren und Wundärzten der Besatzung des Schlosses und der Besatzung der Stadt. – Den 9. August ist der Accord geschlossen. – Schon besetzen am Abend desselben Tages kurfürstlich sächsische Wachen das Unterschloß, während die schwedische Besatzung das Oberschloß innebehält; aber den 10. August verläßt, dem Accord gemäß, Schwede und Schotte – kurfürstliche und kaiserliche Landeskinder, die sich ihnen angeschlossen hatten, wurden ausgehoben – mit sämmtlicher Bagage, doch ohne gerührtes Spiel und ohne Ober- und Untergewehr, das Schloß und die Stadt, und wird von kurfürstlichen Truppen bis zur brandenburgischen Gränze geleitet“.[34]
„Der Kurfürst wiederum zog mit seinen Truppen nach Eilenburg[35] und erstürmte am 16. September [1644; BW] das Schloss. Da der Kommandant einen Vergleich verweigert hatte, ließ er diesen samt der Besatzung der Besatzung niederhauen. Nunmehr übergab er seine Kavallerie an den Kaiserlichen Adrian von Enckevort und kehrte nach Dresden[36] zurück. Der Reitergeneral zog nach Luckau und blockierte dort die Lebensmittelzufuhr. Dadurch erklärte sich die Stadt am 1. Oktober zu einem Vergleich bereit. Bis zuletzt hatte sie auf Oberst Per Anderson gehofft, den Lilie Aus Pommern zum Entsatz kommandiert hatte. Doch gelang es den von Oberst Kurt Reinecke von Callenberg kommandierten Sachsen, Anderson bei Lübbenau[37] zu stellen und in die Flucht zu jagen“.[38]
Am 1.12. dieses Jahres heiratete er Ursula Catharina von Dohna.
1645 war Callenberg als Kommandeur der Kursachsen an der Niederlage in der Schlacht bei Jankau[39] beteiligt. Am 25. März desselben Jahres wurde er zum Landvogt der Oberlausitz ernannt. Dieses Amt bekleidete er bis 1672. Mit der kursächsischen Bestätigung vom 7.4.1652 wurde er am 4.3.1651 zum Reichsfreiherrn ernannt.
1652 wurde er zum Kammerherrn und kursächsischen Rat ernannt. 1654 erfolgte die Erhebung zum Reichsgrafen. Am 23.6.1664 erreichte Callenberg den Höhepunkt seiner Laufbahn mit der Ernennung zum kurfürstlichen Oberhofmarschall.
Am 27.4.1672 verstarb er in Muskau.
[1] Angaben nach VD17 14:051324N Geier, Martin, „I. Verdrüßliche / II. Durchgehende III. Immerwährende IV. Mannigfaltige Lebens-Last; aus dem Spruch Sirachs / c.XL, 1.2.3: Es ist ein elend jämmerlich ding um aller menschen leben / [et]c. Bey … Leichbegängniß des … Hrn. Curt Reinigken / Freyherrn von Callenberg …“ Leipzig 1673. Freundlicher Hinweis von Herrn Uwe Volz. Vgl. auch HARRACH, Tagebücher.
[2] Wettesingen [Kr. Wolfhagen].
[3] Volkmarsen [Kr. Wolfhagen]; HHSD IV, S. 441f.
[4] Muskau [Kr. Weißwasser]; HHSD VIII, S. 239.
[5] Roßleben a. d. Unstrut [Kr. Querfurt/Artern]; HHSD XI, S. 395f.
[6] Marburg; HHSD IV, S. 35ff.
[7] Vgl. REBITSCH, Wallenstein; MORTIMER, Wallenstein; SCHUBERTH; REICHEL, Die blut’ge Affair’.
[8] In der Schlacht an der Dessauer Brücke am 25.4.1626 besiegte Wallenstein die mansfeldisch-weimarischen Truppen unter Ernst von Mansfeld und die dänischen Kontingente unter Johann Ernst von Sachsen-Weimar und drängte sie über Schlesien und Mähren bis nach Ungarn ab. Vgl. WESELOH, Die Schlacht, S. 135ff.; WÜRDIG, HEESE, Dessauer Chronik, S. 197ff.
[9] Vgl. KRÜSSMANN, Ernst von Mansfeld.
[10] Greifswald [Kr. Greifswald]; HHSD XII, S. 194ff.
[11] Rostock; HHSD XII, S. 95ff.
[12] Wismar [Kr. Wismar]; HHSD XII, S. 133ff.
[13] Kostenblut [Kostomłoty, Kr. Neumarkt; HHSSchles, S. 243f.
[14] Torgau [Kr. Torgau]; HHSD XI, S. 467ff.
[15] Vgl. SENNEWALD, Das Kursächsische Heer (ab März 2012).
[16] Wittstock [Kr. Ostprignitz/Wittstock]; HHSD X, S. 394ff. 24.9./4.10.1636: Schwedische Truppen (9150 Berittene und 7228 Infanteristen) unter Johan Banér schlagen die kaiserlich-sächsischen Truppen (9000 Berittene und 9000 zu Fuß) unter Melchior von Hatzfeldt. Dadurch konnten die schwedischen Kontributionsgebiete wieder ausgeweitet werden; Banér hatte bewiesen, dass mit Schweden als Militärmacht in dieser Kriegsphase wieder zu rechnen war. Vgl. Eigentlicher Verlauff Des Treffens bey Wittstock / etc. vorgangen den 4. October / 24. September 1636 [VD17 23.313240S]. Vgl. die hervorragende Edition von EICKHOFF; SCHOPPER, 1636; MURDOCH; ZICKERMANN; MARKS, Battle of Wittstock; ferner HÖBELT, Wittstock; HEßELMANN, Simpliciana XXXIII.
[17] Leipzig; HHSD VIII, S. 178ff.
[18] Breitenfeld [Kr. Leipzig]; HHSD VIII, S. 38f. Schlacht bei Breitenfeld am 23.10./2.11.1642: Die Schweden unter Torstensson besiegen die Kaiserlichen unter Erzherzog Leopold Wilhelm und Ottavio Piccolomini. Vgl. RUDERT, Kämpfe; WALZ, Der Tod, S. 160ff.
[19] Freiberg; HHSD VIII, S. 99ff.
[20] Senftenberg [Kr. Calau/Senftenberg]; HHSD X, S. 356f.
[21] Sonnewalde [LK Elbe-Elster]; HHSD X, S. 358.
[22] Lübben (Spreewald) [LK Dahme-Spreewald]; HHSD X, S. 273f.
[23] Luckenwalde [LK Teltow-Fläning]; HHSD X, S. 271ff.
[24] Luckau [LK Dahme-Spreewald]; HHSD X, S. 268ff.
[25] Dahme/Mark [LK Teltow-Fläming].
[26] Goßmar, heute Ortsteil von Heideblick [LK Dahme-Spreewald].
[27] Pießig, heute Ortsteil von Sonnewalde [LK Elbe-Elster].
[28] Münchhausen-Ossak, heute Ortsteil von Sonnewalde [LK Elbe-Elster].
[29] Kamenz [LK Bautzen]; HHSD VIII, S. 158ff.
[30] Herzberg [LK Elbe-Elster].
[31] Zeckerin, heute Ortsteil von Sonnewalde [LK Elbe-Elster].
[32] Schönewalde [LK Elbe-Elster].
[33] Buchweizenart.
[34] ZEHME, Die Einäscherung, S. 42ff.
[35] Eilenburg [LK Nordsachsen]; HHSD XI, S. 100ff.
[36] Dresden; HHSD VIII, S. 66ff.
[37] Lübbenau [LK Oberspreewald-Lausitz].
[38] KUNATH, Sachsen, S. 271f.
[39] Jankau [Jankov, Bez. Beneschau]; HHSBöhm, S. 226. 6.3.1645: 16.000 Mann schwedische Truppen unter Feldmarschall Torstensson besiegten ein kaiserliches Heer von 18.000 unter Feldmarschall Johann von Götz, der in der Schlacht fiel. Die Kaiserlichen hatten 4.000 Tote und Verwundete zu beklagen, verloren 4.500 Gefangene (darunter auch Melchior von Hatzfeldt) und alle Geschütze. Die Schweden büßten 2.000 Mann ein.
Veröffentlicht unter Miniaturen
|
Verschlagwortet mit C
|
Strijk [Stryk, Strick, Stryck, Stricker], Hans [Johann]; Obrist [1595 Livland-14.2.1653 Härnösand]
Der Livländer Hans [Johann] Strijk [Stryk, Strick, Stryck, Stricker] [1595 Livland-14.2.1653 Härnösand[1]], auf Morsel,[2] Erbherr auf Skogsekeby und Norby, aus baltischem Uradel, stand zuletzt als Obristleutnant[3] bzw. Obrist[4] des Helfinschen Fußregiments[5] in schwedischen Diensten.[6]
Strijk war mit zwölf Jahren nach Schweden gekommen und Page bei dem Reichsrat Johan Skytte[7] geworden, bevor er in deutsche, französische und venetianische Dienste trat. 1623 kehrte er nach Schweden zurück und war 1629 noch Fähnrich[8] in Otto von Uexkülls[9] Kavalleriekompanie.[10] 1631 wurde er im Ritterhaus introduziert,
Der Chronist Cosmus von Simmern [19.3.1581 Kolberg-16.11.1650 Kolberg] aus Kolberg[11] notiert unter 1631 dessen bemerkenswert gutes und ungewohntes Auftreten von Offizieren im Reich: „Nach dem Admiral Ulfspar[12] ist von den Ständen der Kron-Schweden nach Colberg geordnet worden, der Obrist Lieuten. Hans Strick, welcher von Stockholm abgeschicket, und eine esquadron[13] etwa von 600 wohl bewapneter Mannschaft bey sich gehabt, so er bey einem Jahrlang bei täglichem Gebethe auch Kriegs exercitio mit guter ordre rühmlich gehalten, besser als noch von keinem geschehen, auch so, dass über dieses Volk, so lauter Schweden gewesen, und stets in ihren Waffen gewachet und aufgezogen, nicht eine eintzige Klage von der Kantzel, , wie wohl vor diesem geschehen, gehöret worden, e. g.[14] daß sie jemand was gestohlen oder sonderlich Schaden gethan“.[15]
1635 werden vier Kompanien Infanterie zu 500 Mann in Pommern gelistet,[16] bzw. vier Kompanien zu 524 Mann als in Stettin[17] stationiert geführt.[18] Im selben Jahr sind allerdings auch nur vier Kompanien zu 300 Mann angegeben, die nach Schweden abgeführt werden sollten.[19]
Der schwedische Hofhistoriograph Bogislaw Philipp von Chemnitz [9.5.1605 Stettin-19.5.1678 Hallsta, Gem. Västerås] berichtet zum Januar 1636: „Zu solchem ende kam der Königl Schwedische FeldMarschalck[20] / H. Herman Wrangel[21] / mit dem überrest von Preussischem volcke / zu rechter zeit in Pommern an. Dieser / nachdem Er / den andern tag Jenners / Elbingen[22] den Polen / vnnd den fünfften die Pillow[23] den ChurBrandenburgischen überliefert / lies darauff Gen-Major[24] Essens[25] Regiment bey Balga[26] übergehen / vnd auf der Elbingischen höhe zu den Schwedischen trouppen stossen: Von dannen Sie sämbtlich über Nogaten[27] fortgerücket / den dreyzehenden die Weixel passiret / den vierzehenden zu Prist[28] gelegen / vnd ferner ihre marche nach Pommern zugenommen. Selbiges volck bestand in des Obristen Thomas Thomassons[29] / einem schönen / wolbekleideten Regiment / dan dem Essenschen / so dem erstē nicht bevorgab / weiter des Obristen Nils Kaggen[30] / vnd drey Compagnien Obristen Lieutenant Strickens / worunter auch des Gen-Major Axel Lillies[31] / vnd Obristen Drackens[32] in Preussen unterbliebene knechte[33] zufinden; Insgesambt dreytausend / vierhundert / vier vnd funfzig Man: Darzu sechszig reuter / so der FeldHerr / Graff Iacob de la Gardie,[34] bey seinem abzuge / dem FeldMarschalck hinterlassen / vnd etliches artoleri volck kommen. Nebenst denen der FeldMarschalck vier RegimentStücklein[35] / so dan etliche Rüstwägen[36] vnd Karren mit allerhand munition / darunter anderthalb last[37] Pulver / bey sich führete“.[38]
Der Historiker Samuel Freiherr von Pufendorf [8.1.1632 Dorfchemnitz-26.10.1694 Berlin] hält unter dem September 1638: „Der Commandant in Wolgast[39] / der Oberste Anton Webel[40] sprach den Oberst-Lieutenant Strick / der das Schloß belagerte / aus Mangel des Proviants um einen ehrlichen Accord[41] an. Ob nun wohl Webel mit Hunger hätte können gezwungen werden / daß er sich ohne Accord ergeben müssen / so wurde doch mit Baners[42] Consens den alten Kayserlichen Soldaten zugelassen / daß sie ihre Fahnen und Gewehre niederlegen / und mit Sack und Pack abziehen möchten: Weil den Schweden viel dran gelegen war / daß selbiges Schloß ehestens in ihre Hände kam. Weil man auch die Völcker / die davor lagen / anderswo gebrauchen kunte. Wiewol die meisten Gemeinen[43] von freyen Stücken zu den Schweden traten[44] / weil es dazumahl bey allen beyden Armeen gebräuchlich war / daß sie daselbst Dienste annahmen / wo ihre Fahnen blieben“.[45]
Im Tagebuch des Christoph von Bismarck[46] [1583-1655] heißt es unter 1639: „Wie nun bald nach Abzug der Kaiserlichen und Sächsischen sich die Schwed. Armee genähert und zu Bleckede[47] auf dem Lande Braunschweig und Lüneburg zugegangen, sind von Berlin etliche Truppen Reiter auf Salzwedel[48] und Gardelegen[49] unter dem Rittmeister[50] Kalckreuter[51] und einem andern kommandiert, zu denen der tolle Helm Wrangel auf empfangene Ordre die Altmark[52] für Fremde zu defendieren mit seinem Rgt. zu Pferde gestoßen und den 2 Sonnt. p. 3 Könige war der 20.1. in Gardelegen mit sonderlicher Praktik eingelassen. Ob nun wohl, sobald von der Schwedischen Anwesenheit in der Nachbarschaft Kundschaft angekommen, dieser Brand. Reiterei geraten worden, zu weichen und sich zu salvieren, so hat doch bei dem Wrangel, so schon heimlich Conspirat. mit Stahlhansen[53] gehabt, nichts gelten müssen und was er in Sinne gehabt, alsbald den 29. wie etliche Schwedische Regimenter vor Gardelegen gekommen sich erweisen, daß er den 30. hinausgeritten und also accordiert, daß die Stadt nebst dieser Brandenb. Reiterei in der Schweden Hand wieder geraten und des Obristen Strick Rgt. zu Fuß zu completieren hineingelegt worden“.[54] „Im J. 1639 brach General Banner,[55] diese Stütze des Schwedischen Ruhmes, aus Meklenburg auf, ging bei Dömiz[56] über die Elbe und nahm seinen Marsch hinter Salzwedel weg nach dem Erzstift Magdeburg. Bei dieser Gelegenheit hatte er der Stadt Salzwedel eine Plünderung[57] zugedacht; aber der vorhin genannte Lieutenant[58] Burchard,[59] welcher vormals unter ihm gedient, wurde auch dismahl durch seine Fürbitte der Retter Salzwedels. Noch in demselben Jahr kam indessen der Schwedische Obrist Hans Stryck nach Salzwedel. Als man ihn wieder fortschikte, um das durch Wrangels[60] Treulosigkeit übergegangene Gardelegen zu besetzen, nahm er der Stadt Feldstükke[61] mit. Er versprach zwar, dieselben wieder auszuliefern, wenn man ihm für Gewehr und Kriegsvorrath Bezahlung leisten würde, aber er brach sein gegebenes Wort und verlangte vielmehr noch ansehnliche Lieferungen, Speise- und Entschädigungsgelder für seine Truppen. Die Stadt fand diese Forderungen überspannt und meldete den ganzen Vorgang dem Feldmarschall Banner, welcher dem Stryk deswegen einen derben schriftlichen Verweis gab“.[62] „Die Gefährdung des Havellandes durch die Schweden schien behoben. Da überrumpelten 500 Musketiere[63] unter dem Oberst Lieutenant Bernhard Bender[64] Regiments Stricker, am 5. August früh um 2 Uhr Rathenow[65] und die hier einquartierte Companie des Rittmeisters Osten‘.[66] Doch räumten die Schweden Rathenow nach Brandschatzung[67] der Bürger wiederum“.[68]
In den Aufzeichnungen der Wernigeroder[69] „Sechsmänner“[70] heißt es für Ende 1639: „ ‚Den 12. Dezember wurde Herr Oberst Strick die Grafschaft auf ein Regiment zu verpflegen assignirt, worauf den 16. accordirt, dasselbe alle 10 Tage mit 325 Thlr. zu unterhalten,[71] da er anfangs 1000 Thlr. forderte. […] Wahrscheinlich gehörte dieses Regiment zu den Truppen, welche den 8. Jan. [1640; BW] von Halberstadt[72] nach Böhmen zog“.[73] Unter 1639/40 wird aus Halberstadt über die üblichen Ausschreitungen berichtet: „Im Decemb. sind noch Obrist Meyers[74] und Stricken Regiment dazu in die Stadt einquartiret worden, welche uns viel Drangsal angethan, sonderlich haben die St[r]ickschen die Leute bey Tag und Nacht auf der Gassen beraubet, und sind des Nachts in die Häuser gebrochen, haben den Leuten die Kleider,[75] ja die Tücher aus den Betten unter ihnen weggestohlen. A. 1640. den 8. Jan. sind beyde Regimenter Gott Lob wieder fortgezogen“.[76] Im Januar 1640 nahm er Querfurt ein.
Der Erzgebirgschronist Christian Lehmann [11.11.1611-11.12.1688][77] erwähnt ihn unter dem 29.1.1640 anlässlich des Durchzuges seines Fußregiments durch den Pressnitzer Pass[78] nach Böhmen.[79] Im November 1641 wurden noch acht Kompanien Infanterie unter seinem Befehl in den schwedischen Kriegslisten geführt.[80]
1644 wurde Strijk Landeshauptmann über Jämtland,[81] Medelpad[82] und Ångermanland.[83]
Um weitere Hinweise unter Bernd.Warlich@gmx.de wird gebeten !
[1] Härnösand, seit 1778 Residenzstadt der schwedischen Provinz Västernorrlands län und Hauptort der Gemeinde Härnösand.
[2] Morsel-Podrigel [Riidaja (estnisch küla), Dorf in der estnischen Landgemeinde Põdrala im Kreis Valga].
[3] Obristleutnant [schwed. Överstelöjtnant, dän. oberstløjtnant]: Der Obristleutnant war der Stellvertreter des Obristen, der dessen Kompetenzen auch bei dessen häufiger, von den Kriegsherrn immer wieder kritisierten Abwesenheit – bedingt durch Minderjährigkeit, Krankheit, Badekuren, persönliche Geschäfte, Wallfahrten oder Aufenthalt in der nächsten Stadt, vor allem bei Ausbruch von Lagerseuchen – besaß. Meist trat der Obristleutnant als militärischer Subunternehmer auf, der dem Obristen Soldaten und die dazu gehörigen Offiziere zur Verfügung stellte. Verlangt waren in der Regel, dass er die nötige Autorität, aber auch Härte gegenüber den Regimentsoffizieren und Soldaten bewies und für die Verteilung des Soldes sorgte, falls dieser eintraf. Auch die Ergänzung des Regiments und die Anwerbung von Fachleuten oblagen ihm. Zu den weiteren Aufgaben gehörten Exerzieren, Bekleidungsbeschaffung, Garnisons- und Logieraufsicht, Überwachung der Marschordnung, Verproviantierung etc. Der Profos hatte die Aufgabe, hereingebrachte Lebensmittel dem Obristleutnant zu bringen, der die Preise für die Marketender festlegte. Um all diese Aufgaben bewältigen zu können, waren umfangreiche Kenntnisse und Erfahrungen notwendig. Nicht selten lag die eigentliche Führung des Regiments in der Verantwortung eines fähigen Obristleutnants, der im Monat je nach Truppengattung zwischen 120 [nach der „Ordnung Wie es mit der verpflegung der Soldaten“ (1630)] und 150 fl. bezog – in besetzten Städten (1626) wurden z. T. monatlich 400 Rt. erpresst (HEIMATMUSEUM SCHWEDT, Die Uckermark, S. 15 – , in der brandenburgischen und dänischen Armee Armee sogar 300 fl. Nach Wallensteins Verpflegungsordnung (1629) standen ihm bei der Infanterie 320 Rt. monatlich zu; KRAUSE, Urkunden 1. Bd., S. 460. Voraussetzung war allerdings in der bayerischen Armee die richtige Religionszugehörigkeit. Maximilian I. hatte Tilly den Ersatz der „unkatholischen“ Offiziere befohlen; Bayerisches Hauptstaatsarchiv München Dreißigjähriger Krieg Akten 236, fol. 39′ (Ausfertigung): Maximilian I. an Tilly, München, 1629 XI 04: … „wann man dergleich officiren nit in allen fällen, wie es die unuorsehen notdurfft erfordert, gebrauchen khan und darff: alß werdet ihr euch angelegen sein lassen, wie die uncatholischen officiri, sowol undere diesem alß anderen regimentern nach unnd nach sovil muglich abgeschoben unnd ihre stellen mit catholischen qualificirten subiectis ersezt werden konnde“. Der Obristleutnant war zumeist auch Hauptmann oder Rittmeister einer Kompanie, wofür er ein zusätzliches Einkommen bezog, so dass er bei Einquartierungen und Garnisonsdienst zwei Quartiere und damit auch entsprechende Verpflegung und Bezahlung beanspruchte oder es zumindest versuchte. Von Piccolomini stammt angeblich der Ausspruch (1642): „Ein teutscher tauge für mehrers nicht alß die Oberstleutnantstell“. HÖBELT, „Wallsteinisch spielen“, S. 285.
[4] Obrist [schwed. Överste, dän. Oberst]: I. Regimentskommandeur oder Regimentschef mit legislativer und exekutiver Gewalt, „Bandenführer unter besonderem Rechtstitel“ (ROECK, Als wollt die Welt, S. 265), der für Bewaffnung und Bezahlung seiner Soldaten und deren Disziplin sorgte, mit oberster Rechtsprechung und Befehlsgewalt über Leben und Tod. Dieses Vertragsverhältnis mit dem obersten Kriegsherrn wurde nach dem Krieg durch die Verstaatlichung der Armee in ein Dienstverhältnis umgewandelt. Voraussetzungen für die Beförderung waren (zumindest in der kurbayerischen Armee) richtige Religionszugehörigkeit (oder die Konversion), Kompetenz (Anciennität und Leistung), finanzielle Mittel (die Aufstellung eines Fußregiments verschlang 1631 in der Anlaufphase ca. 135.000 fl.) und Herkunft bzw. verwandtschaftliche Beziehungen (Protektion). Zum Teil wurden Kriegskommissare wie Johann Christoph Freiherr v. Ruepp zu Bachhausen zu Obristen befördert, ohne vorher im Heer gedient zu haben; Bayerisches Hauptstaatsarchiv München Kurbayern Äußeres Archiv 2398, fol. 577 (Ausfertigung): Ruepp an Maximilian I., Gunzenhausen, 1631 XI 25. Der Obrist ernannte die Offiziere. Als Chef eines Regiments übte er nicht nur das Straf- und Begnadigungsrecht über seine Regimentsangehörigen aus, sondern er war auch Inhaber einer besonderen Leibkompanie, die ein Kapitänleutnant als sein Stellvertreter führte. Ein Obrist erhielt in der Regel einen Monatssold von 500-800 fl. je nach Truppengattung, 500 fl. zu Fuß, 600 fl. zu Roß [nach der „Ordnung Wie es mit der verpflegung der Soldaten“ (1630)] in der kurbrandenburgischen Armee 1.000 fl. „Leibesbesoldung“ nebst 400 fl. Tafelgeld und 400 fl. für Aufwärter. In besetzten Städten (1626) wurden z. T. 920 Rt. erpresst (HEIMATMUSEUM SCHWEDT, Die Uckermark, S. 15). Daneben bezog er Einkünfte aus der Vergabe von Offiziersstellen. Weitere Einnahmen kamen aus der Ausstellung von Heiratsbewilligungen, aus Ranzionsgeldern – 1/10 davon dürfte er als Kommandeur erhalten haben – , Verpflegungsgeldern, Kontributionen, Ausstellung von Salvagardia-Briefen – die er auch in gedruckter Form gegen entsprechende Gebühr ausstellen ließ – und auch aus den Summen, die dem jeweiligen Regiment für Instandhaltung und Beschaffung von Waffen, Bekleidung und Werbegeldern ausgezahlt wurden. Da der Sold teilweise über die Kommandeure ausbezahlt werden sollten, behielten diese einen Teil für sich selbst oder führten „Blinde“ oder Stellen auf, die aber nicht besetzt waren. Auch ersetzten sie zum Teil den gelieferten Sold durch eine schlechtere Münze. Zudem wurde der Sold unter dem Vorwand, Ausrüstung beschaffen zu müssen, gekürzt oder die Kontribution unterschlagen. Zur brandenburgischen Armee heißt es; OELSNITZ, Geschichte, S. 64: „Fälle, daß die Obersten mit ihren Werbegeldern durchgingen, gehörten nicht zu den größten Seltenheiten; auch stimmte bei den Musterungen die Anzahl der anwesenden Mannschaften außerordentlich selten mit den in der Kapitulation bedingten. So sollte das Kehrberg’sche [Carl Joachim v. Karberg; BW] Regiment 1638 auf 600 Mann gebracht werden, es kam aber nie auf 200. Es wurde dem Obersten der Proceß gemacht, derselbe verhaftet und kassirt. Aehnlich machte es der Oberst Rüdiger v. Waldow [Rüdiger [Rötcher] v. Waldow; BW] und es ließen sich noch viele ähnliche Beispiele aufführen“. Vgl. BELLINCKHAUSEN; TEGEDER; KREIENBRINK, der osnabrugischen handlung, S. 277: „Wir burger mußen alle wochen unse contribution zahlen, die obristen nehmmens geldt zu sich, und die gemeinen soldaten mußen hunger leyden“. Der Austausch altgedienter Soldaten durch neugeworbene diente dazu, ausstehende Soldansprüche in die eigene Tasche zu stecken. Zu diesen „Einkünften“ kamen noch die üblichen „Verehrungen“, die mit dem Rang stiegen und nichts anderes als eine Form von Erpressung darstellten, und die Zuwendungen für abgeführte oder nicht eingelegte Regimenter („Handsalben“) und nicht in Anspruch genommene Musterplätze; abzüglich allerdings der monatlichen „schwarzen“ Abgabe, die jeder Regimentskommandeur unter der Hand an den Generalleutnant oder Feldmarschall abzuführen hatte; Praktiken, die die obersten Kriegsherrn durchschauten. Zudem erbte er den Nachlass eines ohne Erben und Testament verstorbenen Offiziers. Häufig stellte der Obrist das Regiment in Klientelbeziehung zu seinem Oberkommandierenden auf, der seinerseits für diese Aufstellung vom Kriegsherrn das Patent erhalten hatte. Der Obrist war der militärische ‚Unternehmer‘, die eigentlich militärischen Dienste wurden vom Major geführt. Das einträgliche Amt – auch wenn er manchmal „Gläubiger“-Obrist seines Kriegsherrn wurde – führte dazu, dass begüterte Obristen mehrere Regimenter zu errichten versuchten (so verfügte Werth zeitweise sogar über 3 Regimenter), was Maximilian I. von Bayern nur selten zuließ oder die Investition eigener Geldmittel von seiner Genehmigung abhängig machte. Im April 1634 erging die kaiserliche Verfügung, dass kein Obrist mehr als ein Regiment innehaben dürfe; ALLMAYER-BECK; LESSING, Kaiserliche Kriegsvölker, S. 72. Die Möglichkeiten des Obristenamts führten des Öfteren zu Misshelligkeiten und offenkundigen Spannungen zwischen den Obristen, ihren karrierewilligen Obristleutnanten (die z. T. für minderjährige Regimentsinhaber das Kommando führten; KELLER, Drangsale, S. 388) und den intertenierten Obristen, die auf Zeit in Wartegeld gehalten wurden und auf ein neues Kommando warteten. Zumindest im schwedischen Armeekorps war die Nobilitierung mit dem Aufstieg zum Obristen sicher. Zur finanziell bedrängten Situation mancher Obristen vgl. dagegen OMPTEDA, Die von Kronberg, S. 555. Da der Obrist auch militärischer Unternehmer war, war ein Wechsel in die besser bezahlten Dienste des Kaisers oder des Gegners relativ häufig. Der Regimentsinhaber besaß meist noch eine eigene Kompanie, so dass er Obrist und Hauptmann war. Auf der Hauptmannsstelle ließ er sich durch einen anderen Offizier vertreten. Ein Teil des Hauptmannssoldes floss in seine eigenen Taschen. Dazu beanspruchte er auch die Verpflegung.
OELSNITZ, Geschichte, S. 64f.: Der kurbrandenburgische Geheime Rat Adam Graf zu „Schwarzenberg spricht sich in einem eigenhändigen Briefe (22. August 1638) an den Geheimen Rath etc. v. Blumenthal [Joachim Friedrich Freiherr v. Blumenthal; BW] sehr nachtheilig über mehrere Obersten aus und sagt: ‚weil die officierer insgemein zu geitzig sein und zuviel prosperiren wollen, so haben noch auf die heutige stunde sehr viele Soldaten kein qvartier Aber vnter dem schein als ob Sie salvaguardien sein oder aber alte reste einfodern sollen im landt herumb vagiren vnd schaffen ihren Obristen nur etwas in den beutel vnd in die küch, Es gehöret zu solchen dantz mehr als ein paar weißer schue, das man dem General Klitzingk [Hans Kaspar [Caspar] v. Klitzing; BW] die dispositiones vom Gelde und vonn proviant laßen sollte, würde, wan Churt borxtorff [Konrad [Kurt] Alexander Magnus v. Burgsdorff; BW] Pfennigmeister vnd darvber custos wehre der katzen die kehle befohlen sein, wir haben vnd wissen das allbereit 23 Stäbe in Sr. Churf. Drchl. Dienst vnd doch ist kein einsiger ohne der alte Obrister Kracht [Hildebrand [Hillebrandt] v. Kracht; BW] der nit auß vollem halse klaget als ob Man Ihme ungerecht wehre, ob Sie In schaden gerieten, Man sol sie vornemen Insonderheit die, welche 2000 zu lievern versprochen vnd sich nit 300 befinden vndt sol also exempel statuiren – aber wer sol Recht sprechen, die höchste Im kriegsrath sein selber intressirt vnd mit einer suppen begossen“. Ertragreich waren auch Spekulationen mit Grundbesitz oder der Handel mit (gestohlenem) Wein (vgl. BENTELE, Protokolle, S. 195), Holz, Fleisch oder Getreide. Zum Teil führte er auch seine Familie mit sich, so dass bei Einquartierungen wie etwa in Schweinfurt schon einmal drei Häuser „durch- und zusammen gebrochen“ wurden, um Raum zu schaffen; MÜHLICH; HAHN, Chronik 3. Bd., S. 504. Die z. T. für den gesamten Dreißigjährigen Krieg angenommene Anzahl von rund 1.500 Kriegsunternehmern, von denen ca. 100 bis 300 gleichzeitig agiert hätten, ist nicht haltbar, fast alle Regimentsinhaber waren zugleich auch Kriegs- bzw. Heeresunternehmer. II. Manchmal meint die Bezeichnung „Obrist“ in den Zeugnissen nicht den faktischen militärischen Rang, sondern wird als Synonym für „Befehlshaber“ verwandt. Vgl. KAPSER, Heeresorganisation, S. 101ff.; BOCKHORST, Westfälische Adelige, S. 15ff., REDLICH, German military enterpriser; DAMBOER, Krise; WINKELBAUER, Österreichische Geschichte Bd. 1, S. 413ff.
[5] Regiment: Größte Einheit im Heer: Für die Aufstellung eines Regiments waren allein für Werbegelder, Laufgelder, den ersten Sold und die Ausrüstung 1631 bereits ca. 135.000 fl. notwendig. Zum Teil wurden die Kosten dadurch aufgebracht, dass der Obrist Verträge mit Hauptleuten abschloss, die ihrerseits unter Androhung einer Geldstrafe eine bestimmte Anzahl von Söldnern aufbringen mussten. Die Hauptleute warben daher Fähnriche, Kornetts und Unteroffiziere an, die Söldner mitbrachten. Adlige Hauptleute oder Rittmeister brachten zudem Eigenleute von ihren Besitzungen mit. Wegen der z. T. immensen Aufstellungskosten kam es vor, dass Obristen die Teilnahme an den Kämpfen mitten in der Schlacht verweigerten, um ihr Regiment nicht aufs Spiel zu setzen. Der jährliche Unterhalt eines Fußregiments von 3.000 Mann Soll-Stärke wurde mit 400- 450.000 fl., eines Reiterregiments von 1.200 Mann mit 260.-300.000 fl. angesetzt. Zu den Soldaufwendungen für die bayerischen Regimenter vgl. GOETZ, Kriegskosten Bayerns, S. 120ff.; KAPSER, Kriegsorganisation, S. 277ff. Ein Regiment zu Fuß umfasste de facto bei den Kaiserlichen zwischen 650 und 1.100, ein Regiment zu Pferd zwischen 320 und 440, bei den Schweden ein Regiment zu Fuß zwischen 480 und 1.000 (offiziell 1.200 Mann), zu Pferd zwischen 400 und 580 Mann, bei den Bayerischen 1 Regiment zu Fuß zwischen 1.250 und 2.350, 1 Regiment zu Roß zwischen 460 und 875 Mann. Das Regiment wurde vom Obristen aufgestellt, von dem Vorgänger übernommen und oft vom seinem Obristleutnant geführt. Über die Ist-Stärke eines Regiments lassen sich selten genaue Angaben finden. Das kurbrandenburgische Regiment Carl Joachim v. Karberg [Kerberg] sollte 1638 sollte auf 600 Mann gebracht werden, es kam aber nie auf 200. Karberg wurde der Prozess gemacht, er wurde verhaftet und kassiert; OELSNITZ, Geschichte, S. 64. Als 1644 der kaiserliche Generalwachtmeister Johann Wilhelm v. Hunolstein die Stärke der in Böhmen stehenden Regimenter feststellen sollte, zählte er 3.950 Mann, die Obristen hatten 6.685 Mann angegeben. REBITSCH, Gallas, S. 211; BOCKHORST, Westfälische Adlige.
[6] schwedische Armee: Trotz des Anteils an ausländischen Söldnern (ca. 85 %; nach GEYSO, Beiträge II, S. 150, Anm., soll Banérs Armee 1625 bereits aus über 90 % Nichtschweden bestanden haben) als „schwedisch-finnische Armee“ bezeichnet. Die Unterscheidung zwischen der „Royal-Armee“, die v. Gustav II. Adolf selbst geführt wurde, u. den v. den Feldmarschällen seiner Konföderierten geführten „bastanten“ Armeen erscheint angesichts der Operationen der letzteren überflüssig. Nach LUNDKVIST, Kriegsfinanzierung, S. 384, betrug der Mannschaftsbestand (nach altem Stil) im Juni 1630 38.100, Sept. 1631 22.900, Dez. 1631 83.200, Febr./März 1632 108.500, Nov. 1632 149.200 Mann; das war die größte paneuropäische Armee vor Napoleon. Schwedischstämmige stellten in dieser Armee einen nur geringen Anteil der Obristen. So waren z. B. unter den 67 Generälen und Obristen der im Juni 1637 bei Torgau liegenden Regimenter nur 12 Schweden; die anderen waren Deutsche, Finnen, Livländern, Böhmen, Schotten, Iren, Niederländern und Wallonen; GENTZSCH, Der Dreißigjährige Krieg, S. 208. Vgl. die Unterredung eines Pastors mit einem einquartierten „schwedischen“ Kapitän, Mügeln (1642); FIEDLER, Müglische Ehren- und Gedachtnis-Seule, S. 208f.: „In dem nun bald dieses bald jenes geredet wird / spricht der Capitain zu mir: Herr Pastor, wie gefället euch der Schwedische Krieg ? Ich antwortet: Der Krieg möge Schwedisch / Türkisch oder Tartarisch seyn / so köndte er mir nicht sonderlich gefallen / ich für meine Person betete und hette zu beten / Gott gieb Fried in deinem Lande. Sind aber die Schweden nicht rechte Soldaten / sagte der Capitain / treten sie den Keyser und das ganze Römische Reich nicht recht auff die Füsse ? Habt ihr sie nicht anietzo im Lande ? Für Leipzig liegen sie / das werden sie bald einbekommen / wer wird hernach Herr im Lande seyn als die Schweden ? Ich fragte darauff den Capitain / ob er ein Schwede / oder aus welchem Lande er were ? Ich bin ein Märcker / sagte der Capitain. Ich fragte den andern Reuter / der war bey Dreßden her / der dritte bey Erffurt zu Hause / etc. und war keiner unter ihnen / der Schweden die Zeit ihres Lebens mit einem Auge gesehen hette. So haben die Schweden gut kriegen / sagte ich / wenn ihr Deutschen hierzu die Köpffe und die Fäuste her leihet / und lasset sie den Namen und die Herrschafft haben. Sie sahen einander an und schwiegen stille“.
Zur Fehleinschätzung der schwedischen Armee (1642): FEIL, Die Schweden in Oesterreich, S. 355, zitiert [siehe VD17 12:191579K] den Jesuiten Anton Zeiler (1642): „Copey Antwort-Schreibens / So von Herrn Pater Antoni Zeylern Jesuiten zur Newstadt in under Oesterreich / an einen Land-Herrn auß Mähren / welcher deß Schwedischen Einfalls wegen / nach Wien entwichen / den 28 Junii An. 1642. ergangen : Darauß zu sehen: I. Wessen man sich bey diesem harten und langwürigen Krieg in Teutschland / vornemlich zutrösten habe / Insonderheit aber / und für das II. Was die rechte und gründliche Ursach seye / warumb man bißher zu keinem Frieden mehr gelangen können“. a. a. O.: „Es heisst: die Schweden bestünden bloss aus 5 bis 6000 zerrissenen Bettelbuben; denen sich 12 bis 15000 deutsche Rebellen beigesellt. Da sie aus Schweden selbst jährlich höchstens 2 bis 3000 Mann ‚mit Marter und Zwang’ erhalten, so gleiche diese Hilfe einem geharnischten Manne, der auf einem Krebs reitet. Im Ganzen sei es ein zusammengerafftes, loses Gesindel, ein ‚disreputirliches kahles Volk’, welches bei gutem Erfolge Gott lobe, beim schlimmen aber um sein Erbarmen flehe“. Im Mai 1645 beklagte Torstensson, dass er kaum noch 500 eigentliche Schweden bei sich habe, die er trotz Aufforderung nicht zurückschicken könne; DUDÍK, Schweden in Böhmen und Mähren, S. 160.
[7] Johan Skytte [1577 Nyköping-15.3.1645 Söderåka], schwedischer Politiker.
[8] Fähnrich [schwed. fänrik, dän. fændrik]: Rangunterster der Oberoffiziere der Infanterie und Dragoner, der selbst bereits einige Knechte zum Musterplatz mitbrachte. Dem Fähnrich war die Fahne der Kompanie anvertraut, die er erst im Tod aus den Händen geben durfte. Der Fähnrich hatte die Pflicht, beim Eintreffen von Generalspersonen die Fahne fliegen zu lassen. Ihm oblagen zudem die Inspektion der Kompanie (des Fähnleins) und die Betreuung der Kranken. Der Fähnrich konnte stellvertretend für Hauptmann und Leutnant als Kommandeur der Kompanie fungieren. Bei der Kavallerie wurde er Kornett genannt. Zum Teil begannen junge Adelige ihre militärische Karriere als Fähnrich. Vgl. BLAU, Die deutschen Landsknechte, S. 45f. In der brandenburgischen Armee erhielt er monatlich 40 fl., nach der „Ordnung Wie es mit der verpflegung der Soldaten“ (1630) 50 fl. Nach Wallensteins Verpflegungsordnung (1629) standen ihm bei der Infanterie 48 Rt. monatlich zu; KRAUSE, Urkunden 1. Bd., S. 460.
[9] Otto v. Uexküll [ca.1604-26.1.1650 Tallin, Estland], schwedischer Obrist.
[10] SCHRÖER, Das Havelland, S. 293. – Kompanie [schwed. kompani, dän. kompany]: Eine Kompanie zu Fuß (kaiserlich, bayerisch und schwedisch) umfasste von der Soll-Stärke her 100 Mann, doch wurden Kranke und Tote noch 6 Monate in den Listen weiter geführt, so dass ihre Ist-Stärke bei etwa 70-80 Mann lag. Eine Kompanie zu Pferd hatte bei den Bayerischen 200, den Kaiserlichen 60, den Schwedischen 80, manchmal bei 100-150, zum Teil allerdings auch nur ca. 30. Geführt wurde die Fußkompanie von einem Hauptmann, die berittene Kompanie von einem Rittmeister. Vgl. TROUPITZ, Kriegs-Kunst. Vgl. auch „Kornett“, „Fähnlein“, „Leibkompanie“.
[11] Kolberg [Kołobrzeg, LK Kołobrzeg]; HHSD XII, S. 220ff.
[12] Erik Hanson [Åke Hansson, Erich Hansen oder Jansohn] Ulftspar [Ulfsparre, Ulsparr, Wulff Sparr] af Broxvik [1599 ?/1600-1652], schwedischer Obristwachtmeister u. Obrist.
[13] Schwadron, Esquadron [schwed. Skvadron]: Im 16. Jahrhundert bezeichnete Escadre (von lateinisch exquadra Gevierthaufen, Geschwader) eine Stellungsform des Fußvolks und der Reiterei, aus welcher im 17. Jahrhundert für letztere die Eskadron, für ersteres das Bataillon hervorging. Ca. 210 Pikeniere sollten eine Schwadron bilden, 3 eine Brigade. Die Schwadron der Reiterei entsprach der Kompanie der Fußtruppen. Die schwedische Kompanie (Fußtruppen) bestand nach Lorenz TROUPITZ, Kriegs-Kunst / nach Königlich Schwedischer Manier eine Compagny zu richten, Franckfurt 1638, aus drei Schwadronen (zu Korporalschaften, eine Schwadron entsprach daher dem späteren Zug). Die Schwadron war in der Regel eine taktische, selbstständig operierende Infanterie- oder Kavallerieeinheit, die nur für die jeweilige Schlacht aus verfügbaren Einheiten gebildet wurde, meist aus einem Regiment bestehend. Nach Bedarf konnten a) bestehende zahlenmäßig starke Regimenter geteilt oder b) schwache Regimenter zu einer Schwadron zusammengelegt werden; SCHÜRGER, Archäologisch entzaubert, S. 380.
[14] e. g.: exempli gratia: zum Beispiel.
[15] HANNCKE, Cosmus von Simmern Lebenslauf, S. 1f.
[16] MANKELL, Uppgifter, S. 221, 222.
[17] Stettin [Szczecin]; HHSD XII, S. 280ff.
[18] MANKELL, Uppgifter, S. 222.
[19] MANKELL, Uppgifter, S. 226.
[20] Feldmarschall [schwed. fältmarskalk]: Stellvertreter des obersten Befehlshabers mit richterlichen Befugnissen und Zuständigkeit für Ordnung und Disziplin auf dem Marsch und im Lager. Dazu gehörte auch die Organisation der Seelsorge im Heer. Die nächsten Rangstufen waren Generalleutnant bzw. Generalissimus bei der kaiserlichen Armee. Der Feldmarschall war zudem oberster Quartier- und Proviantmeister. In der bayerischen Armee erhielt er 1.500 fl. pro Monat, in der kaiserlichen 2.000 fl. [nach der „Ordnung Wie es mit der verpflegung der Soldaten“ (1630)], die umfangreichen Nebeneinkünfte nicht mitgerechnet, war er doch an allen Einkünften wie Ranzionsgeldern, den Abgaben seiner Offiziere bis hin zu seinem Anteil an den Einkünften der Stabsmarketender beteiligt.
[21] Herman Wrangel [29.6.1587 Estland-11.12.1643 Riga], schwedischer Feldmarschall. Vgl. auch die Erwähnungen bei BACKHAUS, Brev 1-2.
[22] Elbing [Elbląg, Stadtkr.]; HHSPr, S. 45ff.
[23] Pillau [Baltijsk; LK Baltijsk, Polen], HHSPr, S. 170ff.
[24] Generalmajor [schwed. generalmajor, dän. generalmajor]: Der Generalmajor nahm die Aufgaben eines Generalwachtmeisters in der kaiserlichen oder bayerischen Armee war. Er stand rangmäßig bei den Schweden zwischen dem Obristen und dem General der Kavallerie, bei den Kaiserlichen zwischen dem Obristen und dem Feldmarschallleutnant.
[25] Johann v. Essen [1610-23.10.1661], schwedischer Obrist.
[26] Balga [Oblast Kaliningrad].
[27] Nogat, Fluss; HHSPr, S. 158f.
[28] Pristen: nicht identifiziert. Um Hinweise wird gebeten !
[29] Thomas Thomasson [Thomson] [ – ], schwedischer Obrist.
[30] Nils Kagg [ – ], schwedischer Obrist.
[31] Axel [Achsel] Graf Lille [Lillie, Lilie, Lielie, Axellilly, Lilli] v. Löfstad [23.7.1603-20.12.1662], schwedischer Generalmajor.
[32] Sir Johann [Hans] Baronet Drake [Dracke] v. Asch af Hagelsrum [ -1653], schwedischer Obrist.
[33] Knecht, gemeiner: dienstgradloser einfacher Soldat. Er hatte 1630 monatlich Anspruch auf 6 fl. 40 kr., in der brandenburgischen Armee auf 8 fl. 10 gr. = 7 Rtl. 2 Gr. Ein Bauernknecht im bayerischen Raum wurde mit etwa 12 fl. pro Jahr (bei Arbeitskräftemangel, etwa 1645, wurden auch 18 bis 24 fl. verlangt) entlohnt. Doch schon 1625 wurde festgehalten; NEUWÖHNER, Im Zeichen des Mars, S. 92: „Ihme folgete der obrist Blanckhardt, welcher mit seinem gantzen regiment von 3000 fueßknechte sechß wochen lang still gelegen, da dann die stath demselben reichlich besolden muste, wovon aber der gemeine knecht nicht einen pfennig bekommen hatt“. In einem Bericht des Obristleutnants des Regiments Kaspar von Hohenems (25.8.1632) heißt es; SCHENNACH, Tiroler Landesverteidigung, S. 336: „daß sie knecht gleichsam gannz nackhent und ploß auf die wachten ziehen und mit dem schlechten commißbroth vorlieb nemmen müessen, und sonderlichen bey dieser kelte, so dieser orten erscheint, da mich, als ich an ainem morgen die wachten und posti visitiert, in meinem mantl und guetem klaidt gefrorn hat, geschweigen die armen knecht, so übel beklaidt, die ganze nacht auf den wachten verpleiben müessen. So haben sie auch gar kain gelt, das sie nur ain warme suppen kauffen khönnen, müessen also, wegen mangl der klaider und gelt, mit gwalt verschmachten und erkhranken, es sollte ainen harten stain erbarmen, daß die Graf hohenembsische Regiment gleich von anfang und biß dato so übel, und gleichsam die armen knecht erger alß die hundt gehalten werden. Es were gleich so guet, man käme und thete die armen knecht […] mit messern die gurgel abschneiden, alß das man sie also lenger abmatten und gleichsam minder als einen hundt achten thuett“. Gallas selbst schrieb am 25.1.1638 dem Kaiser; ELLERBACH; SCHERLEN, Der Dreißigjährige Krieg Bd. 3, S. 222: „Mochte wohl den Stein der erd erbarmen zuzuschauen, wie die arme knecht kein kleid am leib, keine schuh am fuße, die reiter keine stiefel oder sattel haben, auch den mehrerteil sich freuen, wenn sie nur die notdurft an eichelbrot bekommen können“. => Verpflegung.
[34] Jakob De la Gardie [20.6.1583 Reval-12.8.1652 Stockholm], schwedischer Reichsmarschall. Vgl. BACKHAUS (Hg.), Brev 1-2.
[35] Regimentsstück: leichtes Feldgeschütz, durch Gustav II. Adolf eingeführt, indem er jedem Infanterie-Regiment ständig zwei leichte Geschütze zuordnete. Die Bedienung übernahmen erstmals besonders eingeteilte Soldaten. Die Regimentsstücke waren meist 3-4-Pfünder-Kanonen. Sie wurden durch eine Protze im meist zweispännigen Zug, gefahren vom Bock. d. h. der Fahrer saß auf der Protze, beweglich gemacht. [wikipedia]
[36] Rüstwagen: Plan-, Fracht-, Tross-, Kriegswagen.
[37] Last: 1 Last = 33, 706 Hektoliter, 1 Schiffslast = 1, 374 Tonnen.
[38] CHEMNITZ, Königlichen Schwedischen […] Kriegs, S. 956f.
[39] Wolgast [LK Vorpommern-Greifswald]; HHSD XII, S. 317ff.
[40] Anton [„Don Felix von”] Reichsfreiherr v. Weveld [Webel, Webell, Wevel, Weibel, Weivel, Weiwel, Waevell, Waevel, Wedel, Wellwarth; „Major Anthony“, „Major Antonius“, Major Arctonius“] [ -1659 Mainz ?], kaiserlicher Obrist, Generalwachtmeister.
[41] Akkord: Übergabe, Vergleich, Vertrag: Vergleichsvereinbarungen über die Übergabebedingungen bei Aufgabe einer Stadt oder Festung sowie bei Festsetzung der Kontributionen und Einquartierungen durch die Besatzungsmacht. Angesichts der Schwierigkeiten, eine Stadt oder Festung mit militärischer Gewalt einzunehmen, versuchte die militärische Führung zunächst, über die Androhung von Gewalt zum Erfolg zu gelangen. Ergab sich eine Stadt oder Festung daraufhin ‚freiwillig‘, so wurden ihr gemilderte Bedingungen (wie die Verschonung von Plünderungen) zugebilligt. Garnisonen erwarteten je nach Lage der Dinge meist einen ehrenvollen Abzug und zogen in der Regel gegen die Verpflichtung ab, die nächsten sechs Monate keine Kriegsdienste beim Gegner zu leisten. Auch wurde festgelegt, z. B. 1634 Landsberg/Warthe beim Abzug der kaiserlichen Garnison; THEATRUM EUROPAEUM 3. Bd., S. 196: „Ingleichen sollen sie vor- vnd bey dem Abzug einigen Einwohner / Bürger vnnd Schutzverwandten / er sey Geist- oder Weltlich / im geringsten nicht beleydigen / vielmehr aber / was jedweder Officierer vnnd Soldat der Burgerschafft schuldig / so entlehnet / oder mit Gewalt abgenommen / vorm Abzug richtig bezahlen“. Vgl. auch die genauen Festlegungen im Akkord von Dömitz (26.12.1631; THEATRUM EUROPAEUM 2. Bd., S. 497ff.). Zumeist wurden diese Akkorde vom Gegner unter den verschiedensten Vorwänden, z. B.. wegen der Undiszipliniertheit ihrer Truppen oder weil die Abziehenden gegen den Akkord verstießen, nicht eingehalten. CHEMNITZ über durch Wallenstein gewährten Akkord für die Besatzung von Glogau (1633), Königlichen Schwedischen [ …] Krieg, 1. Buch, 60. Kap., S. 273: „Schrieten also die / darin gelegene / hohe Officirer zum accord / Den der Hertzog von Friedland / mit sack vnd pack / brennenden lunten / fliegenden Fähnlein auszumachiren / vnd gerade auf Landsberg begleitet zu werden / bewilliget / doch schlecht gehalten, in deme Er sie bald vor / bald hinter sich zurücke geführet / dadurch den Soldaten abgemattet / vnd dergestalt schwierig gemacht / das letztlich erst im WinterMonat fast weinig vnd ohngefehr dreyhundert mann davon in Pommern überkommen“. Der Markgröninger Dekan Wendel Bilfinger unter dem 3.12.1634; BILFINGER, Wahrhaffte Beschreibung, S. 233: „Und seind disen tag uf dem Asperg ankommen 3. Stuckh Officiers, ein Leutenant, Fendrich und Corporal, welche von dem Tubadelischen [Georg Christoph v. Taupadel; BW] Volckh, so von Schorndorff außgezogen [25.11. war Schorndorf gefallen; BW], entrunnen, dann ihnen die kaiserische den accord nit gehalten, Sie betrüglicher weiß 6. Tag umbgefüert, hernacher erst gezwungen sich underzustellen, oder sollten nidergemacht werden: Und seind alle Officier dabey gefangen genommen worden“.
[42] Johan Banér [Bannier, Panier, Panner] [23.6./3.7.1596 Djursholm-20.5.1641 Halberstadt], schwedischer Feldmarschall. Vgl. BJÖRLIN, Johan Baner.
[43] Knecht, gemeiner: dienstgradloser einfacher Soldat. Er hatte 1630 monatlich Anspruch auf 6 fl. 40 kr., in der brandenburgischen Armee auf 8 fl. 10 gr. = 7 Rtl. 2 Gr; nach der „Ordnung Wie es mit der verpflegung der Soldaten“ (1630) 6 fl. 40 kr. Ein Bauernknecht im bayerischen Raum wurde mit etwa 12 fl. pro Jahr (bei Arbeitskräftemangel, etwa 1645, wurden auch 18 bis 24 fl. verlangt) entlohnt. Schon 1625 wurde festgehalten; NEUWÖHNER, Im Zeichen des Mars, S. 92: „Ihme folgete der obrist Blanckhardt, welcher mit seinem gantzen regiment von 3000 fueßknechte sechß wochen lang still gelegen, da dann die stath demselben reichlich besolden muste, wovon aber der gemeine knecht nicht einen pfennig bekommen hatt“. In einem Bericht des Obristleutnants des Regiments Kaspar von Hohenems (25.8.1632) heißt es; SCHENNACH, Tiroler Landesverteidigung, S. 336: „daß sie knecht gleichsam gannz nackhent und ploß auf die wachten ziehen und mit dem schlechten commißbroth vorlieb nemmen müessen, und sonderlichen bey dieser kelte, so dieser orten erscheint, da mich, als ich an ainem morgen die wachten und posti visitiert, in meinem mantl und guetem klaidt gefrorn hat, geschweigen die armen knecht, so übel beklaidt, die ganze nacht auf den wachten verpleiben müessen. So haben sie auch gar kain gelt, das sie nur ain warme suppen kauffen khönnen, müessen also, wegen mangl der klaider und gelt, mit gwalt verschmachten und erkhranken, es sollte ainen harten stain erbarmen, daß die Graf hohenembsische Regiment gleich von anfang und biß dato so übel, und gleichsam die armen knecht erger alß die hundt gehalten werden. Es were gleich so guet, man käme und thete die armen knecht […] mit messern die gurgel abschneiden, alß das man sie also lenger abmatten und gleichsam minder als einen hundt achten thuett“. Gallas selbst schrieb am 25.1.1638 dem Kaiser; ELLERBACH; SCHERLEN, Der Dreißigjährige Krieg Bd. 3, S. 222: „Mochte wohl den Stein der erd erbarmen zuzuschauen, wie die arme knecht kein kleid am leib, keine schuh am fuße, die reiter keine stiefel oder sattel haben, auch den mehrerteil sich freuen, wenn sie nur die notdurft an eichelbrot bekommen können“. => Verpflegung. In den Feldlagern (über)lebte er unter den schwierigsten Bedingungen bei einer durchschnittlichen Lebenserwartung von 3, 4 Jahren. Bei Gefangennahme oder Stürmen auf eine Stadt lief er immer Gefahr, getötet zu werden, da für ihn keine Ranzion (Lösegeld) zu erwarten war, oder wenn eine Untersteckung unter die eigenen Truppen nicht notwendig erschien. Generell wurden jedoch „teutsche Knechte“ gegenüber etwa den „Welschen“ bevorzugt übernommen.
[44] Fahnenwechsel: „sich unterhalten lassen“, d. h., in die Dienste des Gegners zu treten, geschah bei Gefangennahme entweder freiwillig oder auch gezwungenermaßen (=> Untersteckung), wenn man nicht genügend Ranzion stellen konnte oder Gefahr lief, getötet zu werden. Bei der Einnahme von Städten lief man immer Gefahr, dass man zurückbehalten wurde und wieder in die vorigen Dienste zurücktreten musste. Der häufige Fahnenwechsel konnte natürlich aiuch insofern Folgen haben, als gerade die Offiziere gute Detailkenntnisse mit ins gegnerische oder in das Lager von Verbündeten nahmen. OMPTEDA, Die von Kronberg, S. 538: „Diesesmal gehörte auch Adam Philipp zu den Unsicheren. Um ihn zu halten, stellte ihm der Kurfürst folgendes Ultimatum, vom 4. März 1632: ‚Ir sollt die Ursache schreiben, aus welcher ir merfach geäussert habt, dass ir in unseren und des katholischen Bundes Kriegsdiensten zu continuiren wenig Lust habt oder, eurem Vorgeben nach, gedrungen werdet, ander Resolution zu fassen. Wir haben euch vor anderen zum General-Wachtmeister gemacht. .. Andere hohe und niedere Officirs, auch gemeine Soldatesca würde von euch ein bös und schädlich Exempel nehmen … Ihr habt versprochen zu continuiren und ist das in der jetzigen allgemeinen necessitet eure Schuldigkeit‘. … Der Kurfürst will sich versehen ‚Ir werdet furtherhin einer mehreren discretion und dankbahrkeit bezeigen. Wenn aber ir andere resolution zu fassen gedenket, so begehren Wir, zuvor zu vernehmen: wohin Ir eure Resolution gestelt und ob ir die euch anvertraute charge und das Regiment zu resigniren gemeint wäret‘. Gleichzeitig soll er berichten: ob er endlich den Tross und die pigage [Bagage; BW] reduzirt habe ? Die Antwort Adam Philipps auf diese ernste Mahnung zur Fahnentreue liegt nicht vor. Dass der Verdacht des Kurfürsten gegen ihn wohlbegründet war, wird sich später erweisen; wie auch, dass einige seiner Offiziere ihren jungen Obristen drängten“.
[45] PUFENDORF, Das X. Buch Der Schwedisch- und Deutschen Kriegs-Geschichte, S. 437.
[46] KRUSENSTJERN, Selbstzeugnisse, S. 52.
[47] Bleckede [LK Lüneburg]; HHSD II, S. 51f.
[48] Salzwedel [Altmarkkreis Salzwedel]; HHSD XI, S. 130ff.]; HHSD XI, S. 404ff.
[49] Gardelegen [Altmarkkreis Salzwedel]; HHSD XI, S. 130ff.
[50] Rittmeister [schwed. ryttmåstere, dän. kaptajn]: Oberbefehlshaber eines Kornetts (später Esquadron) der Kavallerie. Sein Rang entspricht dem eines Hauptmannes der Infanterie (vgl. Hauptmann). Wie dieser war er verantwortlich für Werbung und Soldzahlung, für Disziplin, Ausrüstung und Verpflegung sowie für die Ernennung der untergebenen Führer. Oft war er in erster Linie für die materielle Versorgung der Truppe zuständig, und die eigentlich militärischen Aufgaben wurden von seinem Stellvertreter, dem Leutnant, übernommen. Bei den kaiserlichen Truppen standen unter ihm Leutnant, Kornett, Wachtmeister, 2 oder 3 Korporale, 1 Fourier oder Quartiermeister, 1 Musterschreiber, 1 Feldscher, 2 Trompeter, 1 Schmied, 1 Plattner. Bei den schwedischen Truppen fehlten dagegen Sattler und Plattner, bei den Nationalschweden gab es statt Sattler und Plattner 1 Feldkaplan und 1 Profos, was zeigt, dass man sich um das Seelenheil als auch die Marsch- und Lagerdisziplin zu kümmern gedachte. Der Rittmeister beanspruchte in einer Kompanie Kürassiere 150 fl. Monatssold, d. h. 1.800 fl. jährlich, während ein bayerischer Kriegsrat 1637 jährlich 792 fl. erhielt, 1620 war er in der brandenburgischen Armee als Rittmeister über 50 Pferde nur mit 25 fl. monatlich datiert gewesen. Bei seiner Bestallung wurde er in der Regel durch den Obristen mit Werbe- und Laufgeld zur Errichtung neuer Kompanien ausgestattet. Junge Adlige traten oft als Rittmeister in die Armee ein.]: Oberbefehlshaber eines Kornetts (später Esquadron) der Kavallerie. Sein Rang entspricht dem eines Hauptmannes der Infanterie (vgl. Hauptmann). Wie dieser war er verantwortlich für Werbung und Soldzahlung, für Disziplin, Ausrüstung und Verpflegung sowie für die Ernennung der untergebenen Führer. Oft war er in erster Linie für die materielle Versorgung der Truppe zuständig, und die eigentlich militärischen Aufgaben wurden von seinem Stellvertreter, dem Leutnant, übernommen. Bei den kaiserlichen Truppen standen unter ihm Leutnant, Kornett, Wachtmeister, 2 oder 3 Korporale, 1 Fourier oder Quartiermeister, 1 Musterschreiber, 1 Feldscher, 2 Trompeter, 1 Schmied, 1 Plattner. Bei den schwedischen Truppen fehlten dagegen Sattler und Plattner, bei den Nationalschweden gab es statt Sattler und Plattner 1 Feldkaplan und 1 Profos, was zeigt, dass man sich um das Seelenheil als auch die Marsch- und Lagerdisziplin zu kümmern gedachte. Der Rittmeister beanspruchte in einer Kompanie Kürassiere 150 fl. Monatssold, d. h. 1.800 fl. jährlich, während ein bayerischer Kriegsrat 1637 jährlich 792 fl. erhielt, 1620 war er in der brandenburgischen Armee als Rittmeister über 50 Pferde nur mit 25 fl. monatlich datiert gewesen. Bei seiner Bestallung wurde er in der Regel durch den Obristen mit Werbe- und Laufgeld zur Errichtung neuer Kompanien ausgestattet. Junge Adlige traten oft als Rittmeister in die Armee ein.
[51] N Kalckreuter [ – ], schwedischer Rittmeister.
[52] Altmark: Die Altmark ist eine Region im Norden des Landes Sachsen-Anhalt. Die historische Kulturlandschaft erstreckt sich vom Drawehn im Westen bis an die Elbe im Osten, grenzt südlich an die Magdeburger Börde und nördlich an das Wendland. Der Name Altmark erscheint erstmals 1304 – Antiqua Marchia (Alte Mark) – und bezieht sich auf ihre Bedeutung als westelbisches Ausgangsgebiet bei der Einrichtung der Mark Brandenburg. Darauf beziehen sich auch blumige Charakterisierungen als „Wiege Brandenburgs“ oder gar „Wiege Preußens“. Als Ganzes gehörte sie seit der Gründung der Mark Brandenburg zu dieser Markgrafschaft und dem daraus hervorgegangenen preußischen Staat. Die Altmark wird heute in den Altmarkkreis Salzwedel und den Landkreis Stendal untergliedert. Erst seit der Landkreis Stendal auch östlich der Elbe gelegene Gebiete umfasst, werden diese, historisch zu Jerichower Land und Prignitz gehörend, gelegentlich mit zur Altmark gezählt [nach Wikipedia]. Vgl. ENDERS, Die Altmark.
[53] Torsten Stålhandske [Stolhanscha, Stahlhandschuh, Stahlhanndtschuch, Stalhans, Stallhans, Stalhansch, Stallhuschl, Stalhanß, Stallhaus] [1594 Porvoo/Borgå (Finnland)-21.4./1.5.1644 Haderslev/Nordschleswig], schwedischer Generalmajor.
[54] SCHMIDT, Tagebuch, S. 89f. Freundlicher Hinweis von Herrn Uwe Volz.
[55] Johan Banér [Bannier, Panier, Panner] [23.6./3.7.1596 Djursholm-20.5.1641 Halberstadt], schwedischer Feldmarschall. Vgl. BJÖRLIN, Johan Baner.
[56] Dömitz [LK Ludwigslust-Parchim]; HHSD XII, S. 21ff.
[57] Plünderung: I. Trotz der Gebote in den Kriegsartikeln auch neben der Erstürmung von Festungen und Städten, die nach dem Sturm für eine gewisse Zeit zur Plünderung freigegeben wurden, als das „legitime“ Recht eines Soldaten betrachtet. Vgl. die Rechtfertigung der Plünderungen bei dem ehemaligen hessischen Feldprediger, Professor für Ethik in Gießen und Ulmer Superintendenten Conrad Dieterich, dass „man in einem rechtmässigen Krieg seinem Feind mit rauben vnd plündern Schaden vnd Abbruch / an allen seinen Haab vnd Güttern / liegenden vnd fahrenden / thun könne vnd solle / wie vnd welchere Mittel man jmmermehr nur vermöge. […] Was in Natürlichen / Göttlichen / vnd Weltlichen Rechten zugelassen ist / das kann nicht vnrecht / noch Sünde seyn. Nun ist aber das Rechtmessige Rauben / Beutten vnd Plündern in rechtmessigen Kriegen / in Natürlichen / Göttlichen vnnd Weltlichen Rechten zugelassen“. DIETERICH, D. Konrad Dieterich, S. 6, 19. Vgl. BRAUN, Marktredwitz, S. 37 (1634): „Welcher Teil ehe[r] kam, der plünderte. [Wir] wurden von beiden Teilen für Feind[e] und Rebellen gehalten. Ein Teil plünderte und schalt uns für Rebellen darumb, dass wir lutherisch, der andere Teil, plünderte darumb, dass wir kaiserisch waren. Da wollte nichts helfen – wir sind gut kaiserisch, noch viel weniger beim andern Teil; wir sind gut lutherisch – es war alles vergebens, sondern es ging also: ‚Gebt nur her, was ihr habt, ihr mögt zugehören und glauben wem und was ihr wollt’ “. Dazu kamen noch die vielen Beutezüge durch Marodeure, darunter auch von ihren eigenen Soldaten als solche bezeichnete Offiziere, die durch ihr grausames und ausbeuterisches Verhalten auffielen, die von ihrem Kriegsherrn geschützt wurden. Vgl. BOCKHORST, Westfälische Adlige, S. 16f.; KROENER, Kriegsgurgeln; STEGER, Jetzt ist die Flucht angangen, S. 32f. bzw. die Abbildungen bei LIEBE, Soldat, Abb. 77, 79, 85, 98; das Patent Ludwigs I. von Anhalt-Köthen: „Von Gottes gnaden“ (1635). Vgl. den Befehl Banérs vom 30.5.1639; THEATRUM EUROPAEUM Bd. 4, S. 101f. Vielfach wurden die Plünderungen auch aus Not verübt, da die Versorgung der Soldaten bereits vor 1630 unter das Existenzminimum gesunken war. KROENER, Soldat oder Soldateska, S. 113; DINGES, Soldatenkörper. II. zum Teil aber auch bei Ausschreitungen der Bevölkerung, die sich an den Gütern der Flüchtlinge bereicherte, so z. B. 1629 in Havelberg: „Im Tempel war viel Gut in Kasten und Kisten, wovon die rechtmäßigen Besitzer das Wenigste wiederbekamen. Das meiste wurde den königlichen [Dänen], die während des Brandes darüber hergefallen waren, die Kirche zu plündern, und später den kaiserlichen Soldaten zuteil. Auch einigen Einwohnern und Benachtbarten, die keine Rechte daran hatten. Summa: Ihrer viele wurden arm; etliche mit unrechtem Gut reich“. VELTEN, Kirchliche Aufzeichnungen, S. 76-79, bzw. BRAUN, Marktredwitz, S. 84f., über die auch anderweitig übliche Plünderungsökonomie: „Hingegen ihre Herbergsleute, die sich vor diesem als Tagelöhner bei ihnen erhalten, die haben sich jetzt sehr wohl befunden; denn diese hatten keine Güter, daher gaben sie auch keine Kontribution. Und ein solcher Gesell hat allezeit so viel gestohlen, daß er sich [hat] erhalten können. Wie er ein paar Taler zusammengebracht, hat er gesehen, daß er von den Soldaten eine Kuh [hat] erkaufen können. Oder aber, er hat den Soldaten etwas verraten, do er dann von ihnen eine geschenkt und umsonst bekommen. Do [hat] er dann solche an einen anderen Ort getrieben und soviel daraus erlöst, daß er hernach 3 oder 4 von den Soldaten hat (er)kaufen können. Denn es ward so ein Handel daraus, daß man auch aller christlichen Liebe vergaß; vielweniger fragte man auch mehr nach Ehrbarkeit und Redlichkeit. Wie es dann auch soweit gekommen [ist], daß die Soldaten in einem Dorf das Vieh genommen und hinweg getrieben, und die Bauern als ihre Nach(t)barn in dem nächsten Dorf haben solches Vieh von den Soldaten erkauft und alsbald bei Nacht weiter getrieben und wieder verkauft. Und war schon fast ein allgemeines Gewerbe daraus. Ihrer viel[e] hatten sich auf diesen ehrbaren Handel gelegt, denn wenn ein Soldat eine Kuh gestohlen, wußte er schon seinen gewissen Kaufmann. Und wenn an manchem Ort eine Partei Soldaten mit einer geraubten Herd[e] Vieh ankam, da war bei etlichen gottlosen Menschen ein freudenreiches Zulaufen und Abkaufen, nit anders(t) als wenn zu Amsterdam in Holland eine indianische Flotte anlangte. Ein jeder wollte der nächste sein und die schönste Kuh er(kaufen); ungeachtet der armen Leute, denen das Vieh abgenommen worden, [die] allernächst auf der Seite mit jämmerlichen Gebärden standen und sich wegen der Soldaten nichts (ver)merken lassen durften“. Zum Teil plünderten auch Nachbarn die Hinterlassenschaft ihrer geflüchteten oder abgebrannten Mitbürger; KRAH, Südthüringen, S. 95.: „So berichtete Suhl, daß ‚sich noch etliche volks- und ehrvergessene Leute allhier und anderswo gelüsten lassen, sich an der armen verbrannten Sachen, so nach der Plünderung und Brand in Kellern, Gewölben und sonderlich im Feld und in den Wäldern geflüchtet und übrig geblieben, zu vergreifen und dieblich zu entwenden. Wie dann etliche – auf frischer Tat allzu grob begriffen und darum zu gefänglicher Verhaftung gebracht‘ seien. Auch Benshausen erhielt seine Salvaguardia, um dem täglichen Plündern, nicht nur durch streifende Soldaten zu wehren !“
[58] Leutnant [schwed. Löjtnant, dän. Løjtnant]: Der Leutnant war der Stellvertreter eines Befehlshabers, insbesondere des Rittmeisters oder des Hauptmanns. Wenn auch nicht ohne Mitwissen des Hauptmannes oder Rittmeisters, hatte der Leutnant den unmittelbarsten Kontakt zur Kompanie. Er verdiente je nach Truppengattung monatlich 35-80 fl. – zumindest wurden in den besetzten Städten monatlich 80 Rt. (120 fl.) erpresst; HEIMATMUSEUM SCHWEDT, Die Uckermark, S. 15 -, was etwa dem Sold eines bayerischen Kriegsrats entsprach. Nach Wallensteins Verpflegungsordnung (1629) standen ihm bei der Infanterie 60 Rt. monatlich zu; KRAUSE, Urkunden 1. Bd., S. 460. LAVATER, KRIEGSBüchlein, S. 52f.: „Ein Leutenant wird von dem wörtlein Lieutenant, quasi locum tenens, Ort / Platz / Stell- oder Statthalter eines Capitains genant / diweil er in abwesen seines Capitains desselben Stell verwaltet / er könnte auch der Unterhaubtmann geheissen werden. Ein solcher sol ein dapferer / aufrichtiger / Kriegsgeübter / und praver Cavalier seyn / und ist dem Capitain der nächste: in dessen abwesen commandiert er follkommen / und hat auch in gegenwart des Capitains den gantzen Befehl über die Compagnie: dann wann dem Capitain von dem Regiment etwas anbefohlen wird / so gibt er dem Leutenant Ordre / wie er sich in einem und anderem verhalten solle / der dann durch seine nachgesetzte Officier den Befehl follstrecken laßt: Dieser sol auch des Capitains guten Namen / Ehr / und Reputation lieb haben und schirmen / alß sein eigen Leben und Ehr / und sich sonderlich dem Capitain um dapfere und versuchte Soldaten umschauen / auch wie er die Soldaten logiren und wol einquartieren möge: Darneben soll er fleissig achtung geben / daß al Musketier [schwed. musketerare, musketör, dän. musketeer]: Fußsoldat, der die Muskete führte. Die Muskete war die klassische Feuerwaffe der Infanterie. Sie war ein Gewehr mit Luntenschloss, bei dem das Zündkraut auf der Pulverpfanne durch den Abzugsbügel und den Abzugshahn mit der eingesetzten Lunte entzündet wurde. Die Muskete hatte eine Schussweite bis zu 250 m. Wegen ihres Gewichts (7-10 kg) stützte man die Muskete auf Gabeln und legte sie mit dem Kolben an die Schulter. Nach einem Schuss wichen die Musketiere in den Haufen der Pikeniere zurück, um nachladen zu können. Nach 1630 wurden die Waffen leichter (ca. 5 kg) und die Musketiere zu einer höheren Feuergeschwindigkeit gedrillt; die Schussfolge betrug dann 1 bis 2 Schuss pro Minute (vgl. BUßMANN; SCHILLING, 1648, Bd .1, S. 89). Die zielfähige Schussweite betrug ca. 300 Meter, auf 100 Meter soll die Kugel die damals übliche Panzerung durchschlagen haben. Die Treffsicherheit soll bei 75 Metern Entfernung noch 50 % betragen haben. Die Aufhaltewirkung war im Nahbereich sehr hoch, die Getroffenen sollen sich förmlich überschlagen haben. Je nach Entfernung sollen jedoch im Normalfall nur 5-7% aller abgegebenen Schüsse eine Wirkung im Ziel gehabt haben. Vgl. WALLHAUSEN, Kriegskunst zu Fuß. Zudem rissen sie auf etwa 10 Meter Entfernung etwa dreimal so große Wundhöhlen wie moderne Infanteriegeschosse. Ausführlich beschrieben wird deren Handhabung bei ENGERISSER, Von Kronach nach Nördlingen, S. 544ff. Eine einfache Muskete kostete etwa 2 – 3 ¼ Gulden, die qualitativ besseren Suhler Waffen das Doppelte, so dass seine Ausrüstung nicht so kostenintensiv war. Die Muskete löste das Handrohr ab. Die ab 1630 im thüringischen Suhl gefertigte schwedische Muskete war etwa 140 cm lang bei einer Lauflänge von 102 cm und wog etwa 4,5 – 4,7 kg bei einem Kaliber von zumeist 19,7 mm. Sie konnte bereits ohne Stützgabel geschossen werden, wenngleich man diese noch länger zum Lade- und Zielvorgang benutzte. Die Zerstörung Suhls durch Isolanos Kroaten am 16./26.10.1634 geschah wohl auch in der Absicht, die Produktionsstätten und Lieferbetriebe dem Bedarf der schwedischen Armee endgültig zu entziehen. BRNARDÍC, Imperial Armies I. Für den Nahkampf trug er ein Seitengewehr – Kurzsäbel oder Degen – und schlug mit dem Kolben seiner Muskete zu. In aller Regel kämpfte er jedoch als Schütze aus der Ferne. Deshalb trug er keine Panzerung, schon ein leichter Helm war selten. Eine einfache Muskete kostete etwa 3 ¼ Gulden, die qualitativ besseren Suhler Waffen das Doppelte, so dass seine Ausrüstung nicht so kostenintensiv war. Im Notfall wurden die Musketiere auch als Dragoner verwendet, die aber zum Kampf absaßen. MAHR, Monro, S. 15: „Der Musketier schoß mit der Luntenschloßmuskete, die wegen ihres Gewichtes [etwa 5 kg] auf eine Gewehrgabel gelegt werden mußte. Die Waffe wurde im Stehen geladen, indem man den Inhalt der am Bandelier hängenden hölzernen Pulverkapseln, der sog. Apostel, in den Lauf schüttete und dann das Geschoß mit dem Ladestock hineinstieß. Verschossen wurden Bleikugeln, sog. Rollkugeln, die einen geringeren Durchmesser als das Kaliber des Laufes hatten, damit man sie auch bei Verschmutzung des Laufes durch die Rückstände der Pulvergase noch einführen und mit Stoff oder Papier verdämmen konnte. Da die Treffgenauigkeit dieser Musketen mit glattem Lauf auf die übliche Kampfentfernung von maximal 150 Metern unter 20 Prozent lag, wurde Salvenschießen bevorzugt. Die Verbände waren dabei in sog. Treffen aufgestellt. Dies waren Linien zu drei Gliedern, wobei das zweite Treffen etwa 50 Schritt, das dritte 100 Schritt hinter der Bataille, d. h. der Schlachtlinie des ersten Treffens, zu stehen kamen, so daß sie diese bei Bedarf rasch verstärken konnten. Gefeuert wurde gliedweise mit zeitlichem Abstand, damit für die einzelnen Glieder Zeit zum Laden bestand. Ein gut geübter Musketier konnte in drei Minuten zwei Schuß abgeben. Die Bleigeschosse bis zu 2 cm Kaliber [vgl. auch GROTHE, Auf die Kugeln geschaut, S. 386, hier 16, 8-19,5 mm] verformten sich beim Aufprall auf den Körper leicht, und es entstanden schwere Fleischwunden. In den Kämpfen leisteten Feldscherer erste Hilfe; doch insgesamt blieb die medizinische Versorgung der Verwundeten mangelhaft. Selbst Streifschüsse führten oft aufgrund der Infektion mit Tetanus zum Tode, erst recht dann schwere Verletzungen“. Der Hildesheimer Arzt und Chronist Dr. Jordan berichtet 1634, dass sich unter den Gefallenen eines Scharmützels auch ein weiblicher Musketier in Männerkleidern gefunden habe; SCHLOTTER, Acta, S. 194. Der Bad Windheimer Chronist Pastorius hält unter 1631 fest; PASTORIUS, Kurtze Beschreibung, S. 100: „1631. Den 10. May eroberte der General Tylli die Stadt Magdeburg / plünderte sie aus / eine Jungfrau hatte ihres Bruders Kleider angezogen / und sich in ein groß leeres Weinfaß verstecket / ward endlich von einem Reuter gefunden / der dingte sie für einen Knecht / deme sie auch drey Monat treulich die Pferde wartete / und als in einem Treffen der Reuter umkam / und sie von denen Schweden gefangen gen Erffurt kam / ließ sie sich für einen Musquetirer unterhalten / dienete fünff Jahr redlich / hatte in etlichen Duellen mit dem Degen obsieget / wurde endlich durch eine Müllerin / wo sie im Quartier lag / verrathen / daß sie ein Weib wäre / da erzehlete sie der Commendantin allen Verlauff / die name sie zu einer Dienerin / kleidete sie / und schenckte ihr 100. Ducaten zum Heyrath-Guthe“. Weiter gibt es den Fall der Clara Oefelein, die schriftliche Aufzeichnungen über ihren Kriegsdienst hinterlassen haben soll. Allerdings heißt es schon bei Stanislaus Hohenspach (1577), zit. bei BAUMANN, Landsknechte, S. 77: „Gemeiniglich hat man 300 Mann unter dem Fenlein, ist 60 Glied alleda stellt man welsche Marketender, Huren und Buben in Landsknechtskleyder ein, muß alles gut seyn, gilt jedes ein Mann, wann schon das Ding, so in den Latz gehörig, zerspalten ist, gibet es doch einen Landsknecht“. Bei Bedarf wurden selbst Kinder schon als Musketiere eingesetzt (1632); so der Benediktiner-Abt Gaisser; STEMMLER, Tagebuch 1. Bd., S. 181f.; WALLHAUSEN, Kriegskunst zu Fuß, S. 43ff., über die Bedienung; BRNARDÍC, Imperial Armies I, S. 33ff.; Vgl. KEITH, Pike and Shot Tactics; EICKHOFF; SCHOPPER, 1636, S. 59ff.les gleich zugehe / nach guter ordnung und ohne klag. Alle Abend sol er sich auf der Parade finden lassen / und sehen / wo mangel erscheine: ob auch die Parade / Wacht / und Ordre wol angestellet und gehalten werden: dagegen sol er sich in seinem Commandement gravitetisch und ernsthaft erzeigen / daß ihn seine untergebene Officier und Soldaten ehren / und so wol alß den Capitain fürchten. Die Soldaten werden auch durch ihn gestraft / und ligt ihme aller Last auf dem hals: dann so er die Compagnie nicht versehen müßte / mangelte man keinen Leutenant. Sein Oberwehr ist eine Partisane / er thut keine Wacht / alß die Haubtwacht / da die Compagnie wachet. Er sol auch die Corporalschaften an Mannschaft gleich außtheilen / und keiner mehr versuchte Soldaten geben alß der anderen / daß einer die besten / ein anderer aber die schlechtesten Soldaten habe / woran in einer Occassion vil gelegen ist: Er sol den strafwürdigen streng / den gehorsamen aber gutthätig seyn: Er sol auch aller Soldaten humores erkennen. In summa / er sol wüssen in abwesen des Capitains die Compagnie mit satsamer genugthuung zuregieren / alß wann der Capitain selbst zugegen were / und beyde Officia unklagbar zuverwalten“.
[59] N Burchard [ – ], schwedischer Leutnant.
[60] Helm[old] [Wilhelm] Wrangel [Wrangler] genannt der „tolle Wrangel“ [1599-25.8.1647], schwedischer Generalmajor.
[61] Feldgeschütz: Im April 1629 gelang es der königlichen Gießerei Stockholm, den ersten Dreipfünder herzustellen, der mit 123 kg sehr beweglich war. Wenig später wurde das Gewicht sogar auf nur 116 kg reduziert. Der Name Regimentstücke für diese neue Feldartillerie blieb erhalten. Durch Gustav II. Adolf eingeführt, indem er jedem Infanterie-Regiment ständig zwei leichte Geschütze zuordnete. Die Bedienung übernahmen erstmals besonders eingeteilte Soldaten. Die Regimentsstücke waren meist 3-Pfünder-Kanonen. Sie wurden durch eine Protze im meist zweispännigen Zug, gefahren vom Bock. d. h. der Fahrer saß auf der Protze, beweglich gemacht. [wikipedia]
[62] POHLMANN, Geschichte der Stadt Salzwedel, S. 362.
[63] Musketier [schwed. musketerare, musketör, dän. musketeer]: Fußsoldat, der die Muskete führte. Die Muskete war die klassische Feuerwaffe der Infanterie. Sie war ein Gewehr mit Luntenschloss, bei dem das Zündkraut auf der Pulverpfanne durch den Abzugsbügel und den Abzugshahn mit der eingesetzten Lunte entzündet wurde. Die Muskete hatte eine Schussweite bis zu 250 m. Wegen ihres Gewichts (7-10 kg) stützte man die Muskete auf Gabeln und legte sie mit dem Kolben an die Schulter. Nach einem Schuss wichen die Musketiere in den Haufen der Pikeniere zurück, um nachladen zu können. Nach 1630 wurden die Waffen leichter (ca. 5 kg) und die Musketiere zu einer höheren Feuergeschwindigkeit gedrillt; die Schussfolge betrug dann 1 bis 2 Schuss pro Minute (vgl. BUßMANN; SCHILLING, 1648, Bd .1, S. 89). Die zielfähige Schussweite betrug ca. 300 Meter, auf 100 Meter soll die Kugel die damals übliche Panzerung durchschlagen haben. Die Treffsicherheit soll bei 75 Metern Entfernung noch 50 % betragen haben. Die Aufhaltewirkung war im Nahbereich sehr hoch, die Getroffenen sollen sich förmlich überschlagen haben. Je nach Entfernung sollen jedoch im Normalfall nur 5-7% aller abgegebenen Schüsse eine Wirkung im Ziel gehabt haben. Vgl. WALLHAUSEN, Kriegskunst zu Fuß. Zudem rissen sie auf etwa 10 Meter Entfernung etwa dreimal so große Wundhöhlen wie moderne Infanteriegeschosse. Ausführlich beschrieben wird deren Handhabung bei ENGERISSER, Von Kronach nach Nördlingen, S. 544ff. Eine einfache Muskete kostete etwa 2 – 3 ¼ Gulden, die qualitativ besseren Suhler Waffen das Doppelte, so dass seine Ausrüstung nicht so kostenintensiv war. Die Muskete löste das Handrohr ab. Die ab 1630 im thüringischen Suhl gefertigte schwedische Muskete war etwa 140 cm lang bei einer Lauflänge von 102 cm und wog etwa 4,5 – 4,7 kg bei einem Kaliber von zumeist 19,7 mm. Sie konnte bereits ohne Stützgabel geschossen werden, wenngleich man diese noch länger zum Lade- und Zielvorgang benutzte. Die Zerstörung Suhls durch Isolanos Kroaten am 16./26.10.1634 geschah wohl auch in der Absicht, die Produktionsstätten und Lieferbetriebe dem Bedarf der schwedischen Armee endgültig zu entziehen. BRNARDÍC, Imperial Armies I. Für den Nahkampf trug er ein Seitengewehr – Kurzsäbel oder Degen – und schlug mit dem Kolben seiner Muskete zu. In aller Regel kämpfte er jedoch als Schütze aus der Ferne. Deshalb trug er keine Panzerung, schon ein leichter Helm war selten. Eine einfache Muskete kostete etwa 3 ¼ Gulden, die qualitativ besseren Suhler Waffen das Doppelte, so dass seine Ausrüstung nicht so kostenintensiv war. Im Notfall wurden die Musketiere auch als Dragoner verwendet, die aber zum Kampf absaßen. MAHR, Monro, S. 15: „Der Musketier schoß mit der Luntenschloßmuskete, die wegen ihres Gewichtes [etwa 5 kg] auf eine Gewehrgabel gelegt werden mußte. Die Waffe wurde im Stehen geladen, indem man den Inhalt der am Bandelier hängenden hölzernen Pulverkapseln, der sog. Apostel, in den Lauf schüttete und dann das Geschoß mit dem Ladestock hineinstieß. Verschossen wurden Bleikugeln, sog. Rollkugeln, die einen geringeren Durchmesser als das Kaliber des Laufes hatten, damit man sie auch bei Verschmutzung des Laufes durch die Rückstände der Pulvergase noch einführen und mit Stoff oder Papier verdämmen konnte. Da die Treffgenauigkeit dieser Musketen mit glattem Lauf auf die übliche Kampfentfernung von maximal 150 Metern unter 20 Prozent lag, wurde Salvenschießen bevorzugt. Die Verbände waren dabei in sog. Treffen aufgestellt. Dies waren Linien zu drei Gliedern, wobei das zweite Treffen etwa 50 Schritt, das dritte 100 Schritt hinter der Bataille, d. h. der Schlachtlinie des ersten Treffens, zu stehen kamen, so daß sie diese bei Bedarf rasch verstärken konnten. Gefeuert wurde gliedweise mit zeitlichem Abstand, damit für die einzelnen Glieder Zeit zum Laden bestand. Ein gut geübter Musketier konnte in drei Minuten zwei Schuß abgeben. Die Bleigeschosse bis zu 2 cm Kaliber [vgl. auch GROTHE, Auf die Kugeln geschaut, S. 386, hier 16, 8-19,5 mm] verformten sich beim Aufprall auf den Körper leicht, und es entstanden schwere Fleischwunden. In den Kämpfen leisteten Feldscherer erste Hilfe; doch insgesamt blieb die medizinische Versorgung der Verwundeten mangelhaft. Selbst Streifschüsse führten oft aufgrund der Infektion mit Tetanus zum Tode, erst recht dann schwere Verletzungen“. Der Hildesheimer Arzt und Chronist Dr. Jordan berichtet 1634, dass sich unter den Gefallenen eines Scharmützels auch ein weiblicher Musketier in Männerkleidern gefunden habe; SCHLOTTER, Acta, S. 194. Der Bad Windheimer Chronist Pastorius hält unter 1631 fest; PASTORIUS, Kurtze Beschreibung, S. 100: „1631. Den 10. May eroberte der General Tylli die Stadt Magdeburg / plünderte sie aus / eine Jungfrau hatte ihres Bruders Kleider angezogen / und sich in ein groß leeres Weinfaß verstecket / ward endlich von einem Reuter gefunden / der dingte sie für einen Knecht / deme sie auch drey Monat treulich die Pferde wartete / und als in einem Treffen der Reuter umkam / und sie von denen Schweden gefangen gen Erffurt kam / ließ sie sich für einen Musquetirer unterhalten / dienete fünff Jahr redlich / hatte in etlichen Duellen mit dem Degen obsieget / wurde endlich durch eine Müllerin / wo sie im Quartier lag / verrathen / daß sie ein Weib wäre / da erzehlete sie der Commendantin allen Verlauff / die name sie zu einer Dienerin / kleidete sie / und schenckte ihr 100. Ducaten zum Heyrath-Guthe“. Weiter gibt es den Fall der Clara Oefelein, die schriftliche Aufzeichnungen über ihren Kriegsdienst hinterlassen haben soll. Allerdings heißt es schon bei Stanislaus Hohenspach (1577), zit. bei BAUMANN, Landsknechte, S. 77: „Gemeiniglich hat man 300 Mann unter dem Fenlein, ist 60 Glied alleda stellt man welsche Marketender, Huren und Buben in Landsknechtskleyder ein, muß alles gut seyn, gilt jedes ein Mann, wann schon das Ding, so in den Latz gehörig, zerspalten ist, gibet es doch einen Landsknecht“. Bei Bedarf wurden selbst Kinder schon als Musketiere eingesetzt (1632); so der Benediktiner-Abt Gaisser; STEMMLER, Tagebuch 1. Bd., S. 181f.; WALLHAUSEN, Kriegskunst zu Fuß, S. 43ff., über die Bedienung; BRNARDÍC, Imperial Armies I, S. 33ff.; Vgl. KEITH, Pike and Shot Tactics; EICKHOFF; SCHOPPER, 1636, S. 59ff.
[64] Bernhard Bender [ – ], schwedischer Obristleutnant.
[65] Rathenow [LK Havelland]; HHSD X, S. 333f.
[66] Joachim Friedrich v. der Osten [1618-1673], brandenburgischer Rittmeister, später Obrist.
[67] Brandschatzung: von der jeweiligen Armee bzw. den Kommandeuren willkürlich festgelegte Summe, die die Einwohner aufzubringen hatten, um das Abbrennen ihrer Stadt, Gemeinde etc. zu verhindern, die von den Offizieren möglichst hoch festgelegt wurde, um sich dann auf die von ihnen beabsichtigte Summe herunter handeln zu lassen. Bei den Armeen gab es seit dem Mittelalter sogenannte Brandmeister, Spezialisten im Schätzen und bei Nichtbezahlung der Brandschatzung im Feuerlegen. Erzherzog „Leopold Wilhelm musste bereits zwei Monate [20.11.1645; BW] nach seiner ersten Weisung mit einem neuerlichen Befehl die Einhaltung der Disziplin und Abstellung der Exzesse energisch einfordern: Er verhängte ein komplettes Ausgangsverbot in seiner Armee, um Delikte wie Kirchenplünderung, Mord, Brandschatzung und die schendung der weibsbilder zu verhinden“. REBITSCH, Gallas, S. 218.
[68] SCHRÖER, Das Havelland, S. 95.
[69] Wernigerode [LK Harz]; HHSD XI, S. 493ff.
[70] Sechsmänner: Beisitzer der Ratsherren. Als Kontrollorgan war die Einrichtung der „Sechsmänner“ in Wernigerode ins Leben gerufen worden. Sie waren ein Zugeständnis an die Forderungen der städtischen Mittel- und Unterschichten, der Unmäßigkeit des Patriziats einen Riegel vorzuschieben.
[71] Gemeint ist hier die so genannte „Lehnung“: alle zehn Tage zu entrichtender Sold für die schwedischen Truppen, z. B. Kapitän 12 Rt., Leutnant und Fähnrich 10 Rt., Sergeanten, Fourier, Führer, Musterschreiber und Rüstmeister zusammen 12 Rt., Trommelschläger, Pfeifer zusammen 6 Rt., Korporal 2 Rt., sowie den unteren Dienstchargen gestaffelte Beträge in Groschen. BURSCHEL, Sozialgeschichte, S. 975f.
[72] Halberstadt [LK Harz]; HHSD XI, S. 169ff.
[73] NÜCHTERLEIN, Wernigerode, S. 165.
[74] Valentin Meyer [ – ], schwedischer Obristleutnant, Obrist.
[75] Kleiderraub: Kleider gerade der Adligen waren relativ teuer, so dass man sich bei jeder Gelegenheit, bei Gefangennahmen, auf dem Schlachtfeld und oft auch auf offener Straße welche zu verschaffen suchte. Üblich war, dass einquartierte Soldaten den Bürgern die Kleider wegnahmen und sogar Frauenkleider anzogen. Nach einer Nachricht in den Akten des Staatsarchivs Bückeburg aus dem Jahr 1633 betrug nach der Schlacht bei Hessisch Oldendorf (1633) die Zahl der Gefallenen 6.534, die der Gefangenen zwischen 1.700 und 1.800 Mann; ZARETZKY, Flugschrift, S. 7, 3; darunter waren allein 1.000 Weiber; RIEZLER, Baiern Bd. 4, S. 170. Anscheinend hatten sich auch die Soldatenfrauen und Trossweiber der Konföderierten an dem Gemetzel an den Kaiserlich-Ligistischen beteiligt; Staatsarchiv Bamberg C 48/195-196, fol. 117 (Abschrift, PS): August Erich an Johann Ernst v. Sachsen-Eisenach, Kassel, 1633 VI 30 (a. St.): „Unter andern sagt mann auch, dz ein solcher eÿwer unter den soldaten weibern gewesen seÿ, daß die Heßische und Schwedische sambt andern soldaten weibern die Merodischen und Gronsfeldischen mit meßern unnd gewehr darnieder gestoßen, und ihnen ihre kleider sambt andern außgezogen und abgenommen“. ENGLUND, Verwüstung, S. 261f.: „Kleider waren kostspielig. […] Dies erklärt, warum man Gefangenen und Gefallenen in den Feldschlachten die Kleider auszog. In der schwedischen Armee versuchte man in der Regel, solche von Kugeln durchlöcherten und blutgetränkten Kleidungsstücke zu sammeln, die gewaschen und geflickt und nach Hause gesandt wurden, wo man die neu Ausgehobenen in sie hineinsteckte“. Vgl. auch KOLLER, Die Belagerung, S. 28, 34.
[76] ABEL, Sammlung rarer Chronicken, S. 466.
[77] SCHMIDT-BRÜCKEN; RICHTER, Der Erzgebirgschronist Christian Lehmann.
[78] Der Pressnitzer Pass stellt eine der ältesten Pfadanlagen dar, die aus dem Zentrum Mitteldeutschlands über den dichten Grenzwald nach Böhmen führte. Sein ursprünglicher Verlauf ging von Halle (Saale) kommend über Altenburg, Zwickau, Hartenstein, Grünhain und Zwönitz nach Schlettau. Hier wurde die obere Zschopau gequert. Anschließend führte der Weg über Kühberg am Blechhammer vorbei nach Weipert (Vejprty) und erreichte dann östlich schwenkend über Pleil (Černý Potok) mit Pressnitz (Přísečnice) die älteste Bergstadt des Erzgebirges. Von hier aus verlief der sogenannte Böhmische Steig vermutlich über Kaaden (Kadaň) und bis nach Saaz (Žatec). Die Passhöhe selbst befand sich auf böhmischer Seite nahe Pleil (Černý Potok) auf ca. 800 m ü. NN. Damit war der Pressnitzer Pass deutlich niedriger als die sich nach Westen hin anschließenden Pässe über Wiesenthal, Rittersgrün, Platten, Hirschenstand und Frühbuß. Dies war einer der Gründe für seine häufige Benutzung während des Dreißigjährigen Krieges. [wikipedia]
[79] LEHMANN, Kriegschronik, S. 113. Lehmann datiert nach dem alten Stil.
[80] MANKELL, Uppgifter, S. 263.
[81] Jämtland: historische Provinz (schwedisch landskap) in Schweden.
[82] Medelpad: historische Provinz (schwedisch landskap) im Landesteil Norrland.
[83] Ångermanland: Landschaft in der schwedischen Region Norrland. HUPEL, Materialien, S. 409f.
Veröffentlicht unter Miniaturen
|
Verschlagwortet mit S
|
Goldbach, Georg von; Amtshauptmann [ – ] Georg von Goldbach [ – ] stand 1642 als Statthalter und Amtshauptmann von Querfurt[1] in kursächsischen Diensten.
Der Habsburg-Anhänger und Historiograph Wassenberg berichtet in seinem 1647 erneut aufgelegten Florus: „Nach dem in dessen die Schwedischen vnterm General Major Königsmarck dem festen Hauß Querfurt mit allem ernst zugesetzet / vnd gleichwohl nichts fruchtbarliches mehr außrichten können; hat endlich besagter General Major noch mehr Fußvolck vnd allerhand nöthige Munition bringen lassen; worauff man angefangen / vnerachtet beschehener starcken Gegenwehr / den ort etliche Tage vnauffhörlich auß groben stücken zu beschiessen / vnd mit fewer einwerffen also zu ängstigen / daß es damit biß auffs äußerste kommen / gestalt dann zugleich 2. Minen verfertiget / welche als sie den Belägerten gewiesen worden / hat sich der darauffliegende Chur-Sächsische Statthalter vnd Ampts-Hauptman Georg von Goldbach den 12. diß auf gewissen vertrag ergeben. Die auff dem schloß gewesene 76. Mann biß auf 8. haben sich sämptlich bey den Schweden vnterhalten lassen“.[2] Im „Theatrum Europaeum“ heißt es dazu: „Welchem nach der von Königsmarck im Novemb. in 9. Regim. Reuter uñ Tragoner starck / Aschersleben[3] eingenommen / und sich hernacher / ehe dass er zur Schwed. Haupt-Armee gegangen / um Halberstatt[4] / darinnen der Obr. Heyster [Heister; BW] gelegen / bemühet hat. Ist aber noch nachmals bald wieder kom̃en / und hat das Schloß Querfurt / darinnen ein Chur-Sächsischer Amts-Hauptmañ Georg Goldbach / mit 69. Soldaten gelegen / den 23. Dec. nachdem ers zuvor mit Beschiessen und Feuereinwerffen hart bezwungen / und Goldbach sich zu keinem Accord verstehen wollen / erobert / den von Goldbach nach Dr[e]ßden[5] geschicket / und die Soldaten untergestellet: diesem nach hat er sein Volck meistens auß dem Halberstattischen abgeführet / zu Aschensleben Rendevous gehalten / und nur 12. Comp. Reuter unter dem Obristen Enten / und Obr. Leiut. [sic !] Pegau [Pege; BW] im Land gelassen / und ist den letzten Dec. mit übrigem seinem Volck dem Gen. Torstensohn nachgezogen“.[6]
[1] Querfurt [Kr. Querfurt]; HHSD XI, S. 380f.
[2] WASSENBERG, Florus, S. 503.
[3] Aschersleben [Salzlandkreis]; HHSD XI, S. 23ff.
[4] Halberstadt [LK Harz]; HHSD XI, S. 169ff.
[5] Dresden; HHSD VIII, S. 66ff.
[6] THEATRUM EUROPAEUM 4. Bd., S. 837.
Veröffentlicht unter Miniaturen
|
Verschlagwortet mit G
|
Rotenhan, Hans Georg von; Obrist [1595-1638 Strassburg] Hans Georg von Rotenhan [1595-1638 Strassburg] gehörte zu den protestantischen fränkischen Reichsrittern des Kanton Baunach, die sich erst dem Winterkönig Friedrich V. von der Pfalz[1] und dann Gustav II. Adolf anschlossen.
1617 diente er als Truchsess[2] Friedrichs V., 1618 als Fähnrich[3] bei Reinhard von Solms,[4] dann bei Christian d. J. v. Anhalt.[5] Er diente auch unter Herzog Ernst von Sachsen-Weimar.[6] 1630 war er Obrist[7] unter Bernhard von Sachsen-Weimar.[8] Im Oktober 1635 bemühte er sich aus Vicq[9] zusammen mit Wolf Dietrich Truchsess von Wetzhausen[10] bei Melchior von Hatzfeldt[11] um die Überführung des Leichnams des schwedischen Hofmarschalls von Crailsheim.[12]
Bei der langen Belagerung Breisachs[13] 1638 wurde er verwundet.
Das „Journal der Weymarischen Armee“ des Herzogs Bernhard von Sachsen-Weimar berichtet zum Juli 1638: „Ob nun wohl in allen Orthen Parteyen gestanden, hatten doch etliche Croaten[14] in Walte gehalten und vor Freyburg[15] unterschiedliche erwischt. Den 26. July wolte der Obriste Rotenhan, so bey J. F. G. gewesen, wiederumb nach seinen Quartier reiten, und als er seinen Wagen vorangehen lasen und nur mit 15 Reüter gefolget, fallen die Croaten jenen Wagen an und spannen die Pferd auß. Er aber fellt solche wieder an, schißt zwene todt und nimbt zwene gefangen,[16] die andern salvireten sich meistenstheils zu Fuß. Die Gefangenen berichteten, daß 26 mit einem Ritmeister[17] alda und ganz bei der Statt[18] gewesen, hetten sollen erkundigen, ob J. F. G. Armee marchire, denn sie von solchem etwas Nachricht erlanget hetten“.[19]
In der „Relation Oder gründlichen Erzehlung“ über die Schlacht bei Wittenweier[20] am 30.7./9.8.1638 heißt es: „Als Ihre Fürstl. Gn. Herr Bernhardt Herzog von Sachsen / etc. den 27 Julii (6 Augusti) zu Langendenzlingen[21] ohnfern Freyburg[22] im Preyßgaw / general Randevous gehalten / vnd folgenden Tags ihren Zug auff Kenzingen[23] gerichtet / sich auch nahe bey solchem Städtlein gelägert / vnd aber von den vorauß gehabten Partheyen Kundschafft erlangt / daß die Keyserisch- vnd Bäyrische Armeen mit einer grossen menge Wägen von Früchten / Meel / vnd andern Vivers beladen / nahe bey dem Kloster Schuttern[24] / angelangt seyen / so seyn Ihre Fürstl. Gn. noch selbigen Abend mit ihrer Armee wider auffgebrochen / vnd jenen entgegen / die ganze Nacht durch / biß an den Tag / marchirt / da sie dann Sontag Morgens / den 29 Julii (8 Augusti) die beede Herren General Feldmarschallen[25] / als den Signor Duca Savello,[26] vnd Herrn Graf Johan von Götzen[27] / mit ihrer ganzen Macht / nahend gedachtem Closter / bey dem Dorff Friesenheim[28] angetroffen / die vorauß gesetzte Reuterwacht alsbald angesprengt / den Leutenant[29] so dabey / neben noch 8 Reutern gefangen / vnd etliche nidergemacht / den Rest aber biß vnter die Armee verfolgt / zugleich auch vermittelst etlicher Com̃andirter Troupen zu fuß / sonderlich von Franzosen / zween besetzte Posten erobert / vnd biß in 60 Mann dariñ erschlagen; Deßwegen dañ die Keyserische gut befunden / gemeltes Dorff / zu verhinderung mehrern nachsetzens / an vnterschiedlichen Orten in brand zustecken / weiln hochernanter beeder Herren Feldmarschallen Excell. Excell. ohne das / so bald sie der ohnversehenen Ankunfft Ihr Fürstl. Gn. vnd gleich erfolgten ansprengens / verständigt worden / sich mit der ganzen Armada / der Artilleri[30] vnd allem / auff ein hohen sehr Vortheilhafftigen Berg / nechst dabey / mit guter manier zuziehen / vnd von dar / auff Ihr Fürstl. Gn. Volck / mit Stücken[31] gar starck vnd ohnablässig / jedoch weil dieselbe fast alle zuhoch gegangen / ohne sondern effect vnd schaden / zuspielen[32] angefangen; Denen nun ist von Ihr Fürstl. Gn. Stücken / vnterschiedlich / wiewol so starck vnd offtmals nicht / jedoch mit mehrem effect geantwortet / auch sonst durch die Mußquetirs gegen einander scharmüzirt[33] worden / also daß solchen Vormittag an Keyserisch: vnd Bäyrischer seyten / ihrer selbstbekantnuß nach / gleichwol über 120 Mann todt geblieben / von Ihr Fürstl. Gn. Volck aber / 20. erschossen / vnd bey 30. gequetscht worden; Obwol nun die zugegen gewesene Französische Trouppen / weil es ihnen anfangs wol geglückt / gar den Berg / vnd das Läger darauf / zu stürmen angewolt / so haben doch Ihre Fürstl. Gn. Herzog Bernhard / schon recognoscirt gehabt / daß allda / sonder grosse gfahr vnd schaden / nichts außzurichten war / vnd deßwegen rathsamer befunden / sich in das freye platte Feld dabey / vnd in ein rechte SchlachtOrdnung zustellen / der hoffnung / obgemelter Herren Feldmarschallen Excell. Excell. sich auch eins andern entschliessen / vnd auff Seine Fürstl. Gn. ankom̃en würden. Vorab / weil vermög aller ein zeither spargirter[34] Zeitungen / vnd von Herrn Graf Götzen selbst geführter discours, Ihr Excell. nichts anders / als dergleichen Gelegenheit sollen gewünscht haben. Weil aber beede Herren auß ihrem inhabenden Vortheil weiters vorzubrechen Bedenckens gehabt / vnd also / ausser was mit Canoniren vnd geringẽ scharmuzieren / gemelter massen vorgegangen / an Ihre Fürstl. Gn. ferner nicht gesetzt / haben dieselben sich vmb den Mittag wider etwas zurück nach Mohlburg[35] gezogen / vnd damit den beeden Herren Feldmarschallen desto mehr vrsach gelassen / von dem ingehabten Berg sich ebenmessig zuerheben. Die Nacht darauff / ward beederseyts ohne Alarm zugebracht / vnd liessen Ihre Fürstl. Gn. den folgenden Morgen / war der 30 Julii (9 Augusti) den Gottesdienst vnd die Predigt von den Threnen Christi über Jerusalem[36] / so wegen deß Verlauffs den Tag zuvor eingestelt verblieben / ordentlich verrichten; vnd als zum beschluß derselben / bewegliche außführung geschehen / wie der langmüthige Gott die Verächter vnd Verfolger seines heiligen Worts / wann sie sich schon eine Zeit lang mächtig vnd schröcklich seyen / doch zuletzt stürzen lasse: Haben Ihre Fürstl. Gn. die endliche resolution gefast / auch hernach den vmbstehenden Cavallirn[37] gleich gesagt / daß Sie ohne fernern Verzug an den Feind zugehen / entschlossen werẽ / mit versicherung / daß ihnen Gott noch denselben Tag Heyl verleyhen werde; haben darauff als gleich der ganzen Armee auffbruch befördern lassen / vnd seyn / so bald Sie was wenigs speiß zu sich genommen / stracks zu Pferdt gesessen / auch weiln Sie Kundschafft erlangt hatten / daß offtermelte beede Herrn FeldMarschallen mit all ihren Völckern vnd Proviant-Wägen vnten am Rhein auffwarts zugehen allbereit begriffen seyen / haben Ihre Fürstl. Gn. damit sie nicht vorbey kommen / noch ihr intention mit Proviantierung der Veste Preysach[38] / erlangen möchten / ihnen vorzubiegen / destomehr geeylet. Seyn darauff bald nach 12 Vhren Mittags / nahend Wittenweyher (allda Ihre Fürstl. Gn. nechst verwichenen Jahrs dero Schiffbrück vnd Schanzen[39] gehabt) an sie kommen; Es hatten aber Ihre Excellentien sich dessen schon versehen / vnd derenthalb das Feld mit der schönen SchlachtOrdnung / darein sie sich bald gestellt / wol in acht genommen. Dagegen Ihren Fürstl. Gn. beschwerlich gefallen / durch ein zimlichen Wald / über ein Werte vnd Brucken zwischen zweyen tieffen / vnd mit dicken Hecken überwachsenen Gräben zu filiren,[40] welches dann vermittelst etlicher 100 Mann von der Gegenpart / wo nicht gar verwehrt / jedoch ein geraume zeit hätte disputirt werden können; Weil aber Ihren Fürstl. Gn. darinn kein widersetzligkeit anbegegnet / haben sie dero übergebrachte Trouppen sampt der Artolleri noch vor dem außgang deß gemelten Walds gesetzt / vnd wol enge zusammen gehalten / biß sie zugleich außbrechen / vnd mit rechter Ordnung den angriff thun können; da dañ das Canoniren von beederseyt / bald angangen / mit grossem eyfer stätig continuirt / auch Ihr Fürstl. Gn. rechter flügel (so der Herr General Major[41] Tupadel[42] geführt), weil der Keyserisch vnd Bayrische lincke flügel / von derselben stärckstem Volck / als nemblich den Curaßiern[43] vnd andern besten Regimentern[44] erlesen gewest / gewaltiglich zurück getriben / vnd sich biß auff die reserve / welche der Obrist[45] Kanoffsky[46] gehalten / zu retiriren getrungen worden. Weil nun derselbe noch etwas fern zuruck gestanden / so seyn die Keyserische an solcher seyt / in hoffnung gerahten / schon viel gewonnen zu haben; aber es hat nicht lang gewärt. Dann so bald besagter Herr General Major gemelten Herrn Obristen erlangt / seyn sie in all müglicher eyl wider auff vorerwehnten linckẽ flügel ankommen / vnd haben demselben / so ernstlich zugesetzt / daß er sich nicht weniger als jene zuvorn / nach secundirung vmbsehen müssen. Vnter dessen hat der Obrist Rosa[47] so neben dem Herrn Grafen von Nassaw[48] vnd Freyherrn von Puttbuß[49] / deß Herzogen lincke seyten gehalten / den Savellischen vnd Götzischen rechten Flügel / sonder grosse resistenz über Kopff vnd Halß / in ihr eygen Fußvolck gejagt / vnd biß dahin verfolgt / da dann die Keyßerliche Parthei grossen schaden gelidten / vnd alsbald ein theil derselben Infanteri / außzureissen angefangen. Inmittelst aber / seyn die andere Brigaden[50] gar nahe auff einander kom̃en / vnd haben doch die Keyserische Mußquetirs[51] nicht eh Fewer geben wollen / biß der Herzog etlich keine Trouppen auß den seinigen gezogen / solche hart an sie geschickt / vnd das Kugelwechseln anfangen lassen / warüber die grosse hauffen aneinander kommen / vnd bald dieser: bald jener theil / von der Reuterey angesprengt / auch hingegen widerumb entsetzt worden. In welcher vermengung es so weit gelangt / daß sie endlich gar die Mußqueten[52] einander vmb die Köpff geschmissen / die Götzische von deß Herzogs Artolleri 3. zwölfpfündige[53] / vnd 4. der kleinen Regiments Stücklein[54] bekommen / hingegen Ihre Fürstl. Gn. all deß gegentheils Canon sampt darzu gehörigen Kugeln / in ihren gewalt gebracht / da sich dañ ein ieder theil / solcher seines Feinds Stücken nach vermögen: allein mit dieser mercklichen ohngleicheit / bedient / daß die Götzische / weil sie zu den erlangten 7. Stücken / mit tauglichen Kugeln nicht versehen / gar schlechten Vortheil davon gehabt / hingegen aber die Weymarische stetigs fort / vnd mit mercklichem effect schiessen können. Weil es nun zu lang gewärt / vnd das Artolleri Volck ganz darüber erlegen / so seynd theils von deß Herzogs Reutern abgesessen / haben der ermüdeten Constables[55] vnd Handlangere[56] Ampt versehen / vnd das Lob davon getragen / daß sie trefflich wol geschossen. Dessen aber ohnerachtet / weil die Keyserische immer mit mehrerm Volck nachsetzen können / lauter Alte / deß Handels verständige vnd wolgeübte Soldaten von beederseyt / mit einander zuthun gehabt / vnd bald nicht ein Squadron,[57] Er sey dann eusserst bemüssigt worden / das feldt raumen wollen / sondern sie sich so herzhafft mit einander herumb geschlagen / daß ein jeder theil zum zweyten mal auff deß andern vorige stell / zu stehen kommen / vnd also die Victori biß in die fünffte Stund wanckelmütig geblieben; So haben sie endlich nur Squadron: vnd Regimenter weiß auffeinander getroffen / vnd hat dern fast ein jedes absonderlich / auß dem Feld getrungen werden müssen / da dañ in der letzte die Götzische: vnd Savellische mit hauffen durchgegangen / einander nach in ihr eygen Bagage[58] gefallen / vnd solches selbst zu plündern angefangen / die Schwedische es ihnen aber nit gönnen wollen / sondern sie davon gejagt / vñ die guten Beuten[59] lieber vnter sich getheilt, damit aber sich also von einander gethan vnd getrennet / daß der Herzog auff sein meiste cavalleri kein Staat mehr machen können / sondern allein mit der Infanteri vnd etlich wenig Reutern stehen geblieben / vnd an dem Feld / auch all den andern Siegzeichen / so Gott ihren Fürstlichen Gn. zuerhalten gegönt / sich wol vnd Danckbarlich begnügt. Als es nun dahin gelangt / vnd Ihren Fürstl. Gn. die ihrige schon derenthalb glück zu wünschen angefangen / hat den Herrn General Major Tupadeln der eyfer getrieben / den Flüchtigen mit etlich wenig der seinigen ferner nachzuhawen / da Er dann seine Auffwärter vnd Diener hin vnd wider von sich geschickt / vnd als Er solcher gestalt allein wider zu rück gekehrt / in meynung / daß von den Kayserischen oder Bayerischen ganz niemand mehr zu gegen sey / ist Er von einer Troupp / so sich wider zusammen gefunden / ohngefähr angetroffen / vnd also gefangen mitgenommen worden: Wie sich dann auch auff der Wahlstatt / an einem Graben vñ Vortheilhafften Paß / noch endlich 5. Squadrons zu Pferd vnd 4. zu Fuß / widerumb befunden / welche sich ferner zu wehren zwar ansehen lasse / aber so bald die beynahende Nacht ihnen zu statten kommen / vnd ein wenig blinder alarm gemacht wurde/ in grosser dissordre durch: vnd auff Offenburg[60] gegangen / Allda Ihr Excell. Herr Graf Götz selbsten / nicht über ein halbe Stund geblieben / sondern mit 6 / seiner BagagiWägen / die Er von aller menge daselbst hinderlassen hatte / vnd von all den zusamen gefundnen Trouppen / sich noch dieselbe Nacht / beneben dem Herrn Gener. Wachtmeister[61] Schnettern[62] / Herr Obrist. Geyling[63] / Truckenmüllern[64] vnd Reynach[65] / auff Oberkirch[66] nach demselben Thal reterirt / allda Seine Excell. folgends etlich vnterschiedliche hohe Officirs / so todt auß der Schlacht mit abgeführt waren / oder doch vnterwegs noch / den Geist auffgeben / begraben: Inmittelst die verhawene Wege vber das hohe Gebürg / der Kniebis[67] genandt / durch das Landvolck eröffnen / den Rest Seiner Excell vnd deß Herrn Duca Savello Volcks / als biß in 1400. Reuter vnd 900. Mañ zu Fuß / doch alles in mercklicher confusion / darüber nach dem Würtenbergischen Land gehen / vñ besagte Weg gleich wider hinder sich stärcker als zuvor vergraben vñ verhauen lassen. I. F. G. Herzog Bernhart haben sich dagegen auff der Walstatt vnd eben an dem Orth / wo der Feind anfangs der Schlacht gestanden / vnter den Todten vnd gequetschten gelägert / vnd von dero denselben Tag gehabtẽ überauß grossen müh / mit frewden geruhet / dann Sie nahend alle Squadrons vnd Brigaden selbst angeführt / vnd sich zu mehrmaln mitten vnder der Feinde Trouppen befunden hatten / auch von theils derselben Officirs gekandt / vnd vmb ertheilung Quartiers mit namen angeruffen vnd gebetten worden. Aber der Allmächtige hat I. F. Gn. dermassen beschirmet / daß Sie ganz ohnverletzt geblieben / vnd allein auff dero Waffen 2. Schuß bekommen. Ihr Feldgeschrey in solch hitziger Schlacht / war abermalen / GOTT MIT VNS / aber bey den Franzos: vñ andern beywesenden Nationen / welche das Teutsche nicht wohl aussprechen kunden / Emanuel. Vnter der Götzischen vnd Savellischen aber / rufften sie / FERNANDUS.
Vnd ist im vbrigen der vollkom̃ene Sieg in deme bestanden I. Daß Ihre Fürstl. Gn. nicht allein dero von den Kays. in wehrendẽ Treffen / an sich gebrachte Stück / alle wider erlangt / sondern auch ihnen die ihrige / so viel sie gehabt / als nemlichen 2 halbe Carthaunen[68] / 2 schöne Böhler[69] auff 125. Pfund schiessend / 3 Falckonen[70] / 2 Falckonerlein[71] / vnd 4 Regiments stück / neben aller zugehör / von Kugeln / Granaten / Pulver vnnd Lundten in grosser anzahl / auch viel Wägen mit materialien / 2 Feld Schmitten / vnd aller nothwendigkeit eines wohlbestelten Artolleri Staats / sampt den darzu gehörigen Officiers vnnd anderm Volck / abgewonnen vnd erhalten. II. Daß Ihre Fürstl. Gn. all die Proviant vnd andere namhaffte Vivers / damit Preysach versorgt werden sollen / sampt darzu behörigen Wägen / deren in allem biß in 1000. gewest / erobert. III. Daß Sie neben deme / ihnen den Götzischen vnd Savellischen auch all ihr Bagage / so biß in 2000. Wägen vnd Kärch / vnd darunter viel hübsche Carotschen / mit manch guter Beut / Insonderheit aber der beeden / Herrn Generalen Canzleyen vnd Brieffe mit begriffen / aberhalten. IV. Daß Ihre Fürstl. Gn. ihnen 80 Cornet[72] vnnd Fähnlein[73] genommen / darunter allein von deß Herrn Feldmarschalckẽ Graf Götzens LeibRegiment[74] Curasiers / 7 schöne von Silber vnd Gold gestückte / von andern Regimentern Curasiers aber: auch etlich Cornet / sich befunden. V. Daß von den Keyserisch: vnd Ligistischen nicht allein über 1500 Mann auff dem Platz erschlagen / sondern ihrer auch ein grosse anzahl in den Rhein gejagt vnd ersäufft / viel zu Gnaden vnnd in Dienst auffgenommen / andere gefangen / vnd in Summa solch ansehnliches Corpus von lauter den ältesten Regimentern / zum wenigsten 12000 Mañ effectivè starck / also verringert vñ zerstrewet worden / daß wie obgesagt / dern nicht dritthalb Tausend mehr / zu Roß vnnd Fuß / bey ihrem General sich versamblet / Wie viel aber gequetschte / darunter seyn mögen / das weiß man noch nicht. Der Kayserisch Herr Feldmarschall Duca Savello ist in den Rucken geschossen / kümmerlich davon kommen. Herr Obrist Seneschal[75] ist gefangen / Herr Obrist Meusel[76] / Obrist Hagshausen[77] / Obrist Soles[78] / so das Prisigellisch:[79] Obr. Stefan Alber[80] / so das Tyllisch: vnd Obrist du Puis,[81] der das Eppische[82] Regiment hatte / deßgleichen der Obr. Limpach[83] / vnd wie man gewiß darvor hält / auch Herr Obr. Edelstett[84] / seyn Tod / 5 Obriste Leutenant seyn gefangen / vnd deren zum wenigsten 6. oder 7. gleichfals Todt. Von Obrist Wachtmeistern[85] seyn nur 3 gefangen / wie viel aber derselben / so dann auch von Rittmeistern[86] / Capitains[87] / Leutenanten[88] / Cornets[89] / Fenderichen[90] / vñ geringern Officirs eigentlich Todt geblieben / hat man noch der zeit nit allerdings wissen köñen / wiewol deren ein zimliche anzahl bekandt / vnd es auß obigem wohl abzunehmen ist. Obrist Wachtmeister Vivario,[91] ist neben andern zu Oberkirch erst begraben worden: Vnd seynd sonst von erstbenanten Officiers sehr viel: vnd allein bey dem Rosischen Regiment /über 100 gefangen / darunter die geringste / Quartiermeisters[92] seyn / daß man aber die gesampte anzahl von allen Regimentern / nicht zusammentragen tragen vnd hier benambsen können / ist die vrsach; weil die regimenter nicht mehr als einen ganzen Tag zu hauff geblieben / sondern von Ihrn Fürstl. Gn. theils vmb den Feind weiter zufolgen / mehrentheils aber vmb die Fütterung besser zu haben / hin vñ wider Commandirt: vnd auß einander gezogen worden. Gegen all oberzehltem haben Ihre Fürstl. Gn. in dem grossen vnnd ernsten gemenge ihr seyts verlohren / 14. Fähnlein vnd 8 Cornet / 2 Majors / als nemlich Major Weyerheim[93] von den Tupadelischen zu Pferdt / vnnd Major Vizdumb[94] von den Hattsteinischen[95] Regiment zu Fuß / beneben 8. oder 9 Rittmeistern vnd Capitains in allem / vnd etlich geringern Officirs / auch nicht über 500. gemeine Reuter vnd Knecht[96] / deren Zahl doch allgleich so reichlich ersetzt worden / daß (wie beweißlich) der grösser Theil Ihrer Fürstl. Gn. Regimenter zu Fuß / vmb etlich 100. Mann stärcker / ab: dann auff die Walstatt[97] gezogen: die gefangene gemeine Soldaten / so sich nicht alsbald gutwillig vntergestellt / vnd dern auch etlich viel 100 seyn / damit nicht eingezehlt. Sonsten aber / so seyn Ihren Fürstl. Gn. abgefangen / vnd in der retirada mit fortgebracht wordẽ / der General Major Tupadel / wie oberzelt / Obrist Leutenant Ruht[98] von dem Vorbußischen[99] Regiment / 4. Rittmeister / vnd 3. oder 4. Capitains / beneben etlich Leutenant / Cornets vnd Fendrichen / welche dann nechster Tagen sollen wider eingetauscht werden. Vnd seyn bey dieser ernsten occassion, Ihr Fürstl. Gn. seyts / am gefährlichsten gequetscht worden / Herr Obrist Rotenhan[100] / Herr Obrist Leutenant Rheingraf Johann Ludwig[101] / Obrist Leutenant Fleckenstein[102] / Major Rosa[103] / vnd Major Prestin[104] / aber nunmehr alle ausser lebensgefahr. Herr Obrist Rosa / vnd Herr Obrist Graf Wilhelm Otto von Nassaw seyn zwar gleichfalls vom schiessen beschädigt / haben doch einen Weg als den andern / immer mit fortzureiten / vnd ihre Dienst zuthun nicht vnterlassen. Dienstags den 31 Julii hernach / haben Ihre Fürstl. Gn. forderst die von dero Armee gebliebene Soldaten samptlich / vnd was man auch vom Feind für vorneme Officirs erkennen mögen / lassen ordentlich begrabẽ / weil auß mangl deß Volcks solches überal ins Werck zubringen / nicht möglich war, Ingleichem haben Seine Fürstl. Gn. Vorsehung gethan / daß die gequetschte versorgt / vnd hin vnd wider außgetheilt worden / hernach der Soldatesca zur ergetzlichkeit / die eroberte ProviantWägen / sampt allen Vivers[105] so darauff / zum besten gegeben / vnd zumahln dero Bagage von Mohlburg zu sich auf die Wahlstatt kommen lassen. Mitwochs den 1 (11) Augusti / frühe / ward zu Ehren deß Allmächtigen Gottes / welcher so ein reichen Sieg verliehen hatte / bey der ganzen Armee ein solenn Danckfest gehalten / da dann der Lobgesang / Gebet vnd Verkündigung der Wolthaten deß Allerhöchsten / bey jedem Regiment absonderlich / in dem ganzen Feld vmbher / erschallet / bey Ihren Fürstl. Gn. aber / sich alle Obristen vnd Vornehmbste Officiers befunden / vnd sampt denselben / Erstlichen den 124 Psalmen / Wer Gott nicht mit vns diese Zeit / etc. von Herzen gesungen / hernach auff anhörung der Predigt Göttlichen Worts sich vnter dem freyen Himmel vmbher / auf ihre Knie gelegt / vnd Gott durch sonderbahre Gebet / inniglich gedanckt / So dann auch das Te Deum Laudamus[106] etc. mit frewden intonirt, Vnnd hierauff so sein Ihren Fürstl. Gn. von dero Regimentern nacheinander / die eroberte Cornet vnd Fähnlein / vnterthäniglich præsentirt / vnd von dero Zelt plantirt[107] oder auffgesteckt worden / welches dann (weil sonderlich viel schön erneuerte Standarten vnd Fahnen darunter) sehr prächtig vnd magnifi. anzusehen gewest. Nach diesem haben Ihr Fürstl. Gn. erstlich so wol auß dero vorigen / als denen vom Feind new eroberten Stücken / hernach von der gesampten Cavallerie / vnnd so dann von den Mußquetirs zum zweyten mal / in hüpscher Ordnung Salve schiessen vnd also diß allgemeine Frewdenfest beschliessen lassen“.[108]
Rotenhan starb im selben Jahr in Strassburg,[109] vermutlich an den Folgen dieser Verletzung.
[1] Friedrich V. v. der Pfalz, Kurfürst der Pfalz (1620-1623), König v. Böhmen (1619-1620) [26.8.1596 Deinschwang bei Neumarkt/Oberpfalz-19.11.1632 Mainz]. Vgl. WOLF, Winterkönig; BILHÖFER, Nicht gegen Ehre und Gewissen; http://www.hdbg.de/winterkoenig/tilly.
[2] Truchsess: „Die Truchsessen, zu deren Erlangung auch erworbener inländischer Adel genügte, gehörten aber weiterhin zur „Tafelpartie“ und unterstanden als solche dem Obersthofmeister, von dem sie auch beeidigt wurden.Gehörte der Bewerber um die Truchsessenwürde dem Beamtenstand an, so musste er wenigstens kaiserlicher oder königlicher Rat oder Hof- (Ministerial-)Sekretär sein. War derselbe nicht angestellt, so musste er sonst eine ehrenvolle soziale Stellung einnehmen. Vor der Beeidigung hatte sich der ernannte Truchsess mit dem Erlage der vorgeschriebenen Taxe (Gebühr) auszuweisen, worauf ihm auch das Truchsessenehrenzeichen ausgefolgt wurde. Die Truchsessen waren gleich den Kämmerern Hofwürden. Sie waren zur Hoffolge verpflichtet, rangierten nach den Kämmerern, wurden „zur Tafel bedienung oder bey Festins zu Commissiarienstellen gebraucht“, hatten den Vorzug „den Hof zu Corteggiren“ und traten insbesondere bei der Zeremonie der „Speisung“ am Gründonnerstag in Funktion. Truchsess war demnach ebenso wenig wie Kämmerer ein bloßer Ehrentitel, sondern ein zu Dienstleistungen verpflichtendes und durch Eid bekräftigtes Dienstverhältnis, das im Taxpatent direkt als „Ehrenamt“ bezeichnet wurde. Andererseits war auch die Truchsessenwürde keine staatliche „Auszeichnung“, sondern eine dem Hofrecht angehörende Dienst- und Ehrenverleihung“. [WIKIPEDIA]
[3] Fähnrich [schwed. Fänrik]: Rangunterster der Oberoffiziere der Infanterie und Dragoner, der selbst bereits einige Knechte zum Musterplatz mitbrachte. Dem Fähnrich war die Fahne der Kompanie anvertraut, die er erst im Tod aus den Händen geben durfte. Der Fähnrich hatte die Pflicht, beim Eintreffen von Generalspersonen die Fahne fliegen zu lassen. Ihm oblagen zudem die Inspektion der Kompanie (des Fähnleins) und die Betreuung der Kranken. Der Fähnrich konnte stellvertretend für Hauptmann und Leutnant als Kommandeur der Kompanie fungieren. Bei der Kavallerie wurde er Kornett genannt. Zum Teil begannen junge Adelige ihre militärische Karriere als Fähnrich. Vgl. BLAU, Die deutschen Landsknechte, S. 45f. In der brandenburgischen Armee erhielt er monatlich 40 fl., nach der „Ordnung Wie es mit der verpflegung der Soldaten“ (1630) 50 fl.
[4] Reinhard Graf v. Solms-Braunfels-Hungen [1573-1630], 1604 kurpfälzischer Obrist, 1619-1621 Vizestatthalter in der Oberen Pfalz. Vgl. KRÜSSMANN, Ernst v. Mansfeld.
[5] Christian II. Fürst v. Anhalt-Bernburg [11.8.1599-21.9.1656 Bernburg]. Vgl. das verdienstvolle, in Arbeit befindliche Großprojekt der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, unter: http://diglib.hab.de/edoc/ed000228/start.htm: Digitale Edition und Kommentierung der Tagebücher des Fürsten Christian II. von Anhalt-Bernburg (1599-1656). in: Editiones Electronicae Guelferbytanae. Wolfenbüttel 2013.
[6] Ernst I. der Fromme, Herzog v. Sachsen-Gotha-Altenburg [25.12.1601 Altenburg-26.3.1675 Gotha]. Vgl. JACOBSEN; RUGE, Ernst der Fromme; KLINGER, Der Gothaer Fürstenstaat.
[7] Obrist [schwed. Överste]: I. Regimentskommandeur oder Regimentschef mit legislativer und exekutiver Gewalt, „Bandenführer unter besonderem Rechtstitel“ (ROECK, Als wollt die Welt, S. 265), der für Bewaffnung und Bezahlung seiner Soldaten und deren Disziplin sorgte, mit oberster Rechtsprechung und Befehlsgewalt über Leben und Tod. Dieses Vertragsverhältnis mit dem obersten Kriegsherrn wurde nach dem Krieg durch die Verstaatlichung der Armee in ein Dienstverhältnis umgewandelt. Voraussetzungen für die Beförderung waren (zumindest in der kurbayerischen Armee) richtige Religionszugehörigkeit (oder die Konversion), Kompetenz (Anciennität und Leistung), finanzielle Mittel (die Aufstellung eines Fußregiments verschlang 1631 in der Anlaufphase ca. 135.000 fl.) und Herkunft bzw. verwandtschaftliche Beziehungen (Protektion). Zum Teil wurden Kriegskommissare wie Johann Christoph Freiherr v. Ruepp zu Bachhausen zu Obristen befördert, ohne vorher im Heer gedient zu haben; Bayerisches Hauptstaatsarchiv München Kurbayern Äußeres Archiv 2398, fol. 577 (Ausfertigung): Ruepp an Maximilian I., Gunzenhausen, 1631 XI 25. Der Obrist ernannte die Offiziere. Als Chef eines Regiments übte er nicht nur das Straf- und Begnadigungsrecht über seine Regimentsangehörigen aus, sondern er war auch Inhaber einer besonderen Leibkompanie, die ein Kapitänleutnant als sein Stellvertreter führte. Ein Obrist erhielt in der Regel einen Monatssold von 500-800 fl. je nach Truppengattung, 500 fl. zu Fuß, 600 fl. zu Roß [nach der „Ordnung Wie es mit der verpflegung der Soldaten“ (1630)] in der kurbrandenburgischen Armee 1.000 fl. „Leibesbesoldung“ nebst 400 fl. Tafelgeld und 400 fl. für Aufwärter. Daneben bezog er Einkünfte aus der Vergabe von Offiziersstellen. Weitere Einnahmen kamen aus der Ausstellung von Heiratsbewilligungen, aus Ranzionsgeldern – 1/10 davon dürfte er als Kommandeur erhalten haben – , Verpflegungsgeldern, Kontributionen, Ausstellung von Salvagardia-Briefen – die er auch in gedruckter Form gegen entsprechende Gebühr ausstellen ließ – und auch aus den Summen, die dem jeweiligen Regiment für Instandhaltung und Beschaffung von Waffen, Bekleidung und Werbegeldern ausgezahlt wurden. Da der Sold teilweise über die Kommandeure ausbezahlt werden sollten, behielten diese einen Teil für sich selbst oder führten „Blinde“ oder Stellen auf, die aber nicht besetzt waren. Auch ersetzten sie zum Teil den gelieferten Sold durch eine schlechtere Münze. Zudem wurde der Sold unter dem Vorwand, Ausrüstung beschaffen zu müssen, gekürzt oder die Kontribution unterschlagen. Vgl. BELLINCKHAUSEN; TEGEDER; KREIENBRINK, der osnabrugischen handlung, S. 277: „Wir burger mußen alle wochen unse contribution zahlen, die obristen nehmmens geldt zu sich, und die gemeinen soldaten mußen hunger leyden“. Der Austausch altgedienter Soldaten durch neugeworbene diente dazu, ausstehende Soldansprüche in die eigene Tasche zu stecken. Zu diesen „Einkünften“ kamen noch die üblichen „Verehrungen“, die mit dem Rang stiegen und nicht anderes als eine Form von Erpressung darstellten, und die Zuwendungen für abgeführte oder nicht eingelegte Regimenter („Handsalben“) und nicht in Anspruch genommene Musterplätze; abzüglich allerdings der monatlichen „schwarzen“ Abgabe, die jeder Regimentskommandeur unter der Hand an den Generalleutnant oder Feldmarschall abzuführen hatte; Praktiken, die die obersten Kriegsherrn durchschauten. Zudem erbte er den Nachlass eines ohne Erben und Testament verstorbenen Offiziers. Häufig stellte der Obrist das Regiment in Klientelbeziehung zu seinem Oberkommandierenden auf, der seinerseits für diese Aufstellung vom Kriegsherrn das Patent erhalten hatte. Der Obrist war der militärische ‚Unternehmer‘, die eigentlich militärischen Dienste wurden vom Major geführt. Das einträgliche Amt – auch wenn er manchmal „Gläubiger“-Obrist seines Kriegsherrn wurde – führte dazu, dass begüterte Obristen mehrere Regimenter zu errichten versuchten (so verfügte Werth zeitweise sogar über 3 Regimenter), was Maximilian I. von Bayern nur selten zuließ oder die Investition eigener Geldmittel von seiner Genehmigung abhängig machte. Im April 1634 erging die kaiserliche Verfügung, dass kein Obrist mehr als ein Regiment innehaben dürfe; ALLMAYER-BECK; LESSING, Kaiserliche Kriegsvölker, S. 72. Die Möglichkeiten des Obristenamts führten des Öfteren zu Misshelligkeiten und offenkundigen Spannungen zwischen den Obristen, ihren karrierewilligen Obristleutnanten (die z. T. für minderjährige Regimentsinhaber das Kommando führten; KELLER, Drangsale, S. 388) und den intertenierten Obristen, die auf Zeit in Wartegeld gehalten wurden und auf ein neues Kommando warteten. Zumindest im schwedischen Armeekorps war die Nobilitierung mit dem Aufstieg zum Obristen sicher. Zur finanziell bedrängten Situation mancher Obristen vgl. dagegen OMPTEDA, Die von Kronberg, S. 555. Da der Obrist auch militärischer Unternehmer war, war ein Wechsel in die besser bezahlten Dienste des Kaisers oder des Gegners relativ häufig. Der Regimentsinhaber besaß meist noch eine eigene Kompanie, so dass er Obrist und Hauptmann war. Auf der Hauptmannsstelle ließ er sich durch einen anderen Offizier vertreten. Ein Teil des Hauptmannssoldes floss in seine eigenen Taschen. Dazu beanspruchte er auch die Verpflegung. Ertragreich waren auch Spekulationen mit Grundbesitz oder der Handel mit (gestohlenem) Wein (vgl. BENTELE, Protokolle, S. 195), Holz, Fleisch oder Getreide. Zum Teil führte er auch seine Familie mit sich, so dass bei Einquartierungen wie etwa in Schweinfurt schon einmal drei Häuser „durch- und zusammen gebrochen“ wurden, um Raum zu schaffen; MÜHLICH; HAHN, Chronik 3. Bd., S. 504. II. Manchmal meint die Bezeichnung „Obrist“ in den Zeugnissen nicht den faktischen militärischen Rang, sondern wird als Synonym für „Befehlshaber“ verwandt. Vgl. KAPSER, Heeresorganisation, S. 101ff.; REDLICH, German military enterpriser; DAMBOER, Krise; WINKELBAUER, Österreichische Geschichte Bd. 1, S. 413ff.
[8] Bernhard Herzog v. Sachsen-Weimar [16.8.1604 Weimar-18.7.1639 Neuenburg am Rhein], schwedischer, dann französischer General. Vgl. JENDRE, Diplomatie und Feldherrnkunst; RÖSE, Herzog Bernhard der Große.
[9] Vicq [Herzogtum Lothringen].
[10] Wolf Dietrich v. Truchsess v. Wetzhausen auf Weißendorf u. Weisenbach [ -3.8.1645 bei Alerheim ?], schwedischer Obrist.
[11] Melchior Reichsgraf Hatzfeldt v. Gleichen [20.10.1593 Crottorf-9.11.1658 Schloss Powitzko bei Trachenberg/Schlesien], kaiserlicher Feldmarschall.
[12] ENGELBERT, Hatzfeldt, Nr. 155. – Bernholf [Bernulf] v. Crailsheim [Kreilßheim] [1595-16.11.1635 bei Wallerfangen], schwedischer Obristleutnant, Hofmarschall.
[13] Breisach am Rhein [LK Breisgau-Hochschwarzwald]; HHSD VI, S. 110ff.
[14] Kroaten: kroatische Regimenter in kaiserlichen und kurbayerischen Diensten, des „Teufels neuer Adel“, wie sie Gustav II. Adolf genannt hatte (GULDESCU, Croatian-Slavonian Kingdom, S. 130). Mit der (älteren) Bezeichnung „Crabaten“ (Crawaten = Halstücher) wurden die kroatischen Soldaten, die auf ihren Fahnen einen Wolf mit aufgesperrtem Rachen führten [vgl. REDLICH, De Praeda Militari, S. 21], mit Grausamkeiten in Verbindung gebracht, die von „Freireutern“ verübt wurden. „Freireuter“ waren zum einen Soldaten beweglicher Reiterverbände, die die Aufgabe hatten, über Stärke und Stellung des Gegners sowie über günstige Marschkorridore und Quartierräume aufzuklären. Diese Soldaten wurden außerdem zur Verfolgung fliehender, versprengter oder in Auflösung begriffener feindlicher Truppen eingesetzt. Diese Aufgabe verhinderte eine Überwachung und Disziplinierung dieser „Streifparteien“ und wurde von diesen vielfach dazu genutzt, auf eigene Rechnung Krieg zu führen. Vgl. GOTTFRIED, ARMA SVEVICA, S. 85 (1630): „Die Crabaten litten dieser Zeit von den Schwedischen viel schaden / weil es bey ihnen viel stattliche Beuten gab. Dann sie hatten theils Gürtel voller Gold und Silber vmb den Leib / auch gantze Blatten von Gold vnd Silber geschlagen vor der Brust“. Zudem war „Kroaten“ ein zeitgenössischer Sammelbegriff für alle aus dem Osten oder Südosten stammenden Soldaten. Ihre Bewaffnung bestand aus Arkebuse, Säbel (angeblich „vergiftet“; PUSCH, Episcopali, S. 137; MITTAG, Chronik, S. 359, wahrscheinlich jedoch Sepsis durch den Hieb) und Dolch sowie meist 2 Reiterpistolen. Jeder fünfte dieser „kahlen Schelme Ungarns“ war zudem mit einer Lanze bewaffnet. SCHUCKELT, Kroatische Reiter; GULDESCU, Croatian-Slavonian Kingdom. Meist griffen sie Städte nur mit Überzahl an. Die Hamburger „Post Zeitung“ berichtete im März 1633: „Die Stadt Hoff haben an vergangenen Donnerstag in 1400. Crabaten in Grundt außgeplündert / vnnd in 18000 Thaller werth schaden gethan / haben noch sollen 1500. fl. geben / dass sie der Kirchen verschonet / deßwegen etliche da gelassen / die andern seind mit dem Raub darvon gemacht“. MINTZEL, Stadt Hof, S. 101. Zur Grausamkeit dieser Kroatenregimenter vgl. den Überfall der Kroaten Isolanis am 21.8.1634 auf Höchstädt (bei Dillingen) THEATRUM EUROPAEUM Bd. 3, S. 331f.; bzw. den Überfall auf Reinheim (Landgrafschaft Hessen-Darmstadt) durch die Kroaten des bayerischen Generalfeldzeugmeisters Jost Maximilian von Gronsfelds im Mai 1635: HERRMANN, Aus tiefer Not, S. 148ff.; den Überfall auf Reichensachsen 1635: GROMES, Sontra, S. 39: „1634 Christag ist von uns (Reichensächsern) hier gehalten, aber weil die Croaten in der Christnacht die Stadt Sontra überfallen und in Brand gestecket, sind wir wieder ausgewichen. Etliche haben sich gewagt hierzubleiben, bis auf Sonnabend vor Jubilate, da die Croaten mit tausend Pferden stark vor Eschwege gerückt, morgens von 7-11 Uhr mittags mit den unsrigen gefochten, bis die Croaten gewichen, in welchem Zurückweichen die Croaten alles in Brand gestecket. Um 10 Uhr hats in Reichensachsen angefangen zu brennen, den ganzen Tag bis an den Sonntags Morgen in vollem Brande gestanden und 130 Wohnhäuser samt Scheuern und Ställen eingeäschert. Von denen, die sich zu bleiben gewaget, sind etliche todtgestoßen, etlichen die Köpfe auf den Gaßen abgehauen, etliche mit Äxten totgeschlagen, etliche verbrannt, etliche in Kellern erstickt, etliche gefangen weggeführet, die elender gewesen als die auf der Stelle todt blieben, denn sie sind jämmerlich tractirt, bis man sie mit Geld ablösen konnte“. LEHMANN, Kriegschronik, S. 61, anlässlich des 2. Einfall Holks in Sachsen (1632): „In Elterlein haben die Crabaten unmanbare Töchter geschendet und auf den Pferden mit sich geführet, in und umb das gedreid, brod, auf die Bibel und bücher ihren mist auß dem hindern gesezt, In der Schletta [Schlettau] 21 bürger beschediget, weiber und Jungfern geschendet“. LANDAU, Beschreibung, S. 302f. (Eschwege 1637). Auf dem Höhepunkt des Krieges sollen über 20.000 Kroaten in kaiserlichen Diensten gestanden haben. In einem Kirchturmknopf in Ostheim v. d. Rhön von 1657 fand sich ein als bedeutsam erachteter Bericht für die Nachgeborenen über den Einfall kroatischer Truppen 1634; ZEITEL, Die kirchlichen Urkunden, S. 219-282, hier S. 233-239 [Frdl. Hinweis von Hans Medick, s. a. dessen Aufsatz: Der Dreißigjährige Krieg]. Vgl. BAUER, Glanz und Tragik; neuerdings KOSSERT, „daß der rothe Safft hernach gieng…“, S. 75: „In einer Supplik der niederhessischen Stände an Landgraf Wilhelm V. von Hessen-Kassel aus dem Jahr 1637 heißt es beispielsweise, die „unchristlichen Croaten“ hätten ‚den Leute[n] die Zungen, Nasen und Ohren abgeschnitten, die augen außgestochen, Nägel in die Köpff und Füsse geschlagen, heis Blech, Zinn und allerhand Unflat, durch die Ohren, Nasen und den Mund, in den Leib gegossen [und] etzliche durch allerhand Instrumenta schmertzlich gemartert’ “. http://home.arcor.de/sprengel-schoenhagen/2index/30jaehrigekrieg.htm: „Am grauenhaftesten hatte in dieser Zeit von allen Städten der Prignitz Perleberg zu leiden. Die Kaiserlichen waren von den Schweden aus Pommern und Mecklenburg gedrängt worden und befanden sich auf ungeordnetem Rückzug nach Sachsen und Böhmen. Es ist nicht möglich, alle Leiden der Stadt hier zu beschreiben.
Am ehesten kann man sich das Leid vorstellen, wenn man den Bericht des Chronisten Beckmann über den 15. November 1638 liest: ‚… Mit der Kirche aber hat es auch nicht lange gewähret, sondern ist an allen Ecken erstiegen, geöffnet und ganz und gar, nicht allein was der Bürger und Privatpersonen Güter gewesen, besonders aber auch aller Kirchenschmuck an Kelchen und was dazu gehöret, unter gotteslästerlichen Spottreden ausgeplündert und weggeraubet, auch ein Bürger an dem untersten Knauf der Kanzel aufgeknüpfet, die Gräber eröffnet, auch abermals ganz grausam und viel schlimmer, als je zuvor mit den Leuten umgegangen worden, indem sie der abscheulichen und selbst in den Kirchen frevelhafter und widernatürlicher Weise verübten Schändung des weiblichen Geschlechts, selbst 11- und 12-jähriger Kinder, nicht zu gedenken – was sie nur mächtig (haben) werden können, ohne Unterschied angegriffen, nackt ausgezogen, allerlei faules Wasser von Kot und Mist aus den Schweinetrögen, oder was sie am unreinsten und nächsten (haben) bekommen können, ganze Eimer voll zusammen gesammelt und den Leuten zum Maul, (zu) Nase und Ohren eingeschüttet und solch einen ‚Schwedischen Trunk oder Branntwein’ geheißen, welches auch dem damaligen Archidiakonus… widerfahren. Andern haben sie mit Daumschrauben und eisernen Stöcken die Finger und Hände wund gerieben, andern Mannspersonen die Bärte abgebrannt und noch dazu an Kopf und Armen wund geschlagen, einige alte Frauen und Mannsleute in Backöfen gesteckt und so getötet, eine andere Frau aus dem Pfarrhause in den Rauch gehängt, hernach wieder losgemacht und durch einen Brunnenschwengel in das Wasser bis über den Kopf versenket; andere an Stricken, andere bei ihren Haaren aufgehängt und so lange, bis sie schwarz gewesen, sich quälen lassen, hernach wieder losgemacht und andere Arten von Peinigung mit Schwedischen Tränken und sonsten ihnen angeleget. Und wenn sie gar nichts bekennen oder etwas (haben) nachweisen können, Füße und Hände zusammen oder die Hände auf den Rücken gebunden und also liegen lassen, wieder gesucht, und soviel sie immer tragen und fortbringen können, auf sie geladen und sie damit auf Cumlosen und andere Dörfer hinausgeführt, worüber dann viele ihr Leben (haben) zusetzen müssen, daß auch der Rittmeister der Salvegarde und andere bei ihm Seiende gesagt: Sie wären mit bei letzter Eroberung von Magdeburg gewesen, (es) wäre aber des Orts so tyrannisch und gottlos mit den Leuten, die doch ihre Feinde gewesen, nicht umgegangen worden, wie dieses Orts geschehen’ „. METEREN, Newer Niederländischen Historien Vierdter Theil, S. 41: „Diese [Kroaten; BW] nach dem sie die Thor deß Stättleins [Penkun (LK Vorpmmern-Greifswald); BW] zerbrochen / haben sie mit grossem Grimm auff dem Schloß / in der Kirche / in der Pfarr / in den Häusern / Ja auch unerhörter Weise in den Todtengräbern gesuchet: Das Korn theils außgetroschen vnnd hinweg geführet / theils auch zertretten / die Inwohner hefftig geschlagen vnnd biß auff den Todt gemartert / daß sie solten sagen / on sie Gelt vergraben hetten / vnder denselben haben sie auch deß Pastorn nicht verschonet / der ihnen doch vor diesem alle Ehr vnnd Freundschafft erwiesen: Vnnd welches das allerärgste / haben sie Weibspersonen genothzüchtiget vnd geschändet / vnnd so sich etliche im Wasser vnder dem Rohr / oder sonst verborgen / haben die Crabaten / als deß Teuffels rechte Spürhund / solche auffgesucht / vnd wie das Vieh zur Vnzucht vor sich hergetrieben / auch ein theils Mannspersonen / so ihre Weiber vnnd Kinder wider solchen Teufflischen Muthwillen vnnd Gewalt vertheidigen wollen / jämmerlich erschossen vnd nidergehawen. Vnd dergleichen Vnzucht haben sie auch an Mägdelein von acht vnnd zehen Jahren zu treiben vnd am hellen Tag auff den Kirchhöfen / öfffentlichen Gassen vnd Gärten zu begehen / sich nicht geschewet“. Vgl. auch die Beschreibung des Kroateneinfalls in Neustadt a. d. Aisch am 18.7.1632 => Kehraus [Kerauß, Kehrauß], Andreas Matthias in den „Miniaturen“, bzw. die Aufzeichnungen des Pfarrers Lucas, Trusen (Anfang Januar 1635); LEHMANN, Leben und Sterben, S. 129: „[…] die Dorfschaften sind nacheinander alle ausgeplündert, die Leute übel geschlagen und beraubt worden, einige tot geblieben, Elmenthal und Laudenbach und Heßles sind ganz ledig [menschenleer] diese Zeit über gestanden, alles an Heu, Stroh, Holz hinweg ist geführt worden, das Getreide in den Scheunen ist ausgedroschen oder sonst verdorben worden, die Häuser sind zerschlagen, das Eisenwerk an Türen und Läden, Bratkacheln, Ofenblasen sind ausgebrochen und hinweg genommen worden [ …] sind über 300 Kroaten zu Elmenthal und Laudenbach gewesen, dort geplündert und folgenden Tag nach Brotterode gezogen und dort auch großen Schaden verübt, indem sie allein 100 Pferde allhier weggenommen, des anderen Viehs zu geschweigen, mancher Mensch ist übel traktiert worden, viele sind in großen Schaden gekommen, zu Herges sind alle Pferde hinweg genommen, desgleichen mehrentheils auch die Schafe und jungen Lämmer, in der Auwallenburg sind über 3 Kühe nicht verblieben, sondern alle hinweg genommen worden […]“. WERTHER, Chronik der Stadt Suhl 1. Bd., S. 226f. (1634): „In einem Umlaufschreiben wies die gemeinschaftliche Regierung und das Consistorium zu Meiningen darauf hin: ‚Es gehen viele und große Sünden wider das sechste und siebente Gebot im Schwange, da die Weibspersonen sich leichtfertig an die Croaten gehänget“. Gefangene Kroaten wurden schon unter Gustav II. Adolf von den Schweden in ihre Kupferbergwerke verbracht; THEATRUM EUROPAEUM 2. Bd., S. 349; METEREN, Newer Niederländischen Historien Vierdter Theil, S. 87.
[15] Freiburg im Breisgau; HHSD VI, S. 215ff.
[16] Kriegsgefangene: Zur Gefangennahme vgl. die Reflexionen bei MAHR, Monro, S. 46: „Es ist für einen Mann besser, tüchtig zu kämpfen und sich rechtzeitig zurückzuziehen, als sich gefangennehmen zu lassen, wie es am Morgen nach unserem Rückzug vielen geschah. Und im Kampf möchte ich lieber ehrenvoll sterben als leben und Gefangener eines hartherzigen Burschen sein, der mich vielleicht in dauernder Haft hält, so wie viele tapfere Männer gehalten werden. Noch viel schlimmer ist es, bei Gefangennahme, wie es in gemeiner Weise immer wieder geübt wird, von einem Schurken nackt ausgezogen zu werden, um dann, wenn ich kein Geld bei mir habe, niedergeschlagen und zerhauen, ja am Ende jämmerlich getötet zu werden: und dann bin ich nackt und ohne Waffen und kann mich nicht verteidigen. Mein Rat für den, der sich nicht entschließen kann, gut zu kämpfen, geht dahin, daß er sich dann wenigstens je nach seinem Rang gut mit Geld versehen soll, nicht nur um stets selbst etwas bei sich zu haben, sondern um es an einem sicheren Ort in sicheren Händen zu hinterlegen, damit man ihm, wenn er gefangen ist, beistehen und sein Lösegeld zahlen kann. Sonst bleibt ihm nichts anderes übrig, als sich zu entschließen, in dauernder Gefangenschaft zu bleiben, es sei denn, einige edle Freunde oder andere haben mit ihm Mitleid“. Nach Lavater, Kriegs-Büchlein, S. 65, hatten folgende Soldaten bei Gefangennahme keinerlei Anspruch auf Quartier (Pardon): „wann ein Soldat ein eysen, zinne, in speck gegossen, gekäuete, gehauene oder gevierte Kugel schiesset, alle die gezogene Rohr und französische Füse [Steinschloßflinten] führen, haben das Quartier verwirkt. Item alle die jenigen, die von eysen geschrotete, viereckige und andere Geschröt vnd Stahel schiessen, oder geflammte Dägen, sollt du todt schlagen“. Leider reduziert die Forschung die Problematik der de facto rechtlosen Kriegsgefangenen noch immer zu einseitig auf die Alternative „unterstecken“ oder „ranzionieren“. Der Ratsherr Dr. Plummern berichtet (1633); SEMLER, Tagebücher, S. 65: „Eodem alß die von Pfullendorff avisirt, daß ein schwedischer reütter bei ihnen sich befinnde, hatt vnser rittmaister Gintfeld fünf seiner reütter dahin geschickht sollen reütter abzuholen, welliche ihne biß nach Menßlißhausen gebracht, allda in dem wald spolirt vnd hernach zu todt geschoßen, auch den bauren daselbst befohlen in den wald zu vergraben, wie beschehen. Zu gleicher zeit haben ettlich andere gintfeldische reütter zu Langen-Enßlingen zwo schwedische salvaguardien aufgehebt vnd naher Veberlingen gebracht, deren einer auß Pommern gebürtig vnd adenlichen geschlächts sein sollen, dahero weiln rittmaister Gintfeld ein gůtte ranzion zu erheben verhofft, er bei leben gelassen wird“. Der Benediktiner-Abt Gaisser berichtet zu 1633; STEMMLER, Tagebuch Bd. 1, S. 415: „Der Bürger August Diem sei sein Mitgefangener gewesen, für den er, falls er nicht auch in dieser Nacht entkommen sei, fürchte, daß er heute durch Aufhängen umkomme. Dieser sei, schon vorher verwundet, von den Franzosen an den Füßen in einem Kamin aufgehängt und so lange durch Hängen und Rauch gequält worden, bis das Seil wieder abgeschnitten worden sei und er gerade auf den Kopf habe herabfallen dürfen“. Soldaten mussten sich mit einem Monatssold freikaufen, für Offiziere gab es je nach Rang besondere Vereinbarungen zwischen den Kriegsparteien. Das Einsperren in besondere Käfige, die Massenhinrichtungen, das Vorantreiben als Kugelfang in der ersten Schlachtreihe, die Folterungen, um Auskünfte über Stärke und Bewegung des Gegners zu erfahren, die Hungerkuren, um die „Untersteckung“ zu erzwingen etc., werden nicht berücksichtigt. Frauen, deren Männer in Gefangenschaft gerieten, erhielten, wenn sie Glück hatten, einen halben Monatssold bis zwei Monatssolde ausgezahlt und wurden samt ihren Kindern fortgeschickt. KAISER, Kriegsgefangene; KROENER, Soldat als Ware. Die Auslösung konnte das eigene Leben retten; SEMLER, Tagebücher, S. 65: „Zu gleicher zeitt [August 1630] haben ettlich andere gintfeldische reütter zu Langen-Enßlingen zwo schwedische salvaguardien aufgehebt vnd nacher Veberlingen gebracht, deren einer auß Pommern gebürtig vnd adenlichen geschlächte sein sollen, dahero weiln rittmeister Gintfeld eine gůtte ranzion zu erheben verhofft, er bei leben gelassen worden“. Teilweise beschaffte man über sie Informationen; SEMLER, Tagebücher, S. 70 (1633): „Wie beschehen vnd seyn nahendt bei der statt [Überlingen; BW] vier schwedische reütter, so auf dem straiff geweßt, von vnsern tragonern betretten [angetroffen; BW], zwen darvon alsbald nidergemacht, zwen aber, so vmb quartier gebeten, gefangen in die statt herein gebracht worden. Deren der eine seines angebens Christian Schultheß von Friedland [S. 57] auß dem hertzogthumb Mechelburg gebürtig vnder der kayßerlichen armada siben jahr gedient vnd diesen sommer zu Newmarckht gefangen vnd vndergestoßen [am 30.6.1633; BW] worden: der ander aber von Saltzburg, vnderm obrist König geritten vnd zu Aichen [Aichach; BW] in Bayern vom feind gefangen vnd zum dienen genötiget worden. Vnd sagte der erste bei hoher betheurung vnd verpfändung leib vnd lebens, dass die schwedische vmb Pfullendorff ankomne vnd noch erwartende armada 24 regimenter starck, vnd werde alternis diebus von dem Horn vnd hertzogen Bernhard commandirt; führen 4 halb carthaunen mit sich vnd ettlich klainere veld stückhlin. Der ander vermainte, daß die armada 10.000 pferdt vnd 6.000 zu fůß starckh vnd der so geschwinde aufbruch von Tonawerd [Donauwörth; BW] in diese land beschehen seye, weiln man vernommen, dass die kayserische 8000 starckh in Würtemberg eingefallen“. Auf Gefangenenbefreiung standen harte Strafen. Pflummern hält in seinem Tagebuch fest: „Martij 24 [1638; BW] ist duca Federico di Savelli, so in dem letzsten vnglückhseeligen treffen von Rheinfelden den 3 Martij neben dem General von Wert, Enckefort vnd andern obristen vnd officiern gefangen vnd bis dahin zu Lauffenburg enthallten worden, durch hilff eines weibs auß: vnd den bemellten 24 Martij zu Baden [Kanton Aargau] ankommen, volgenden morgen nach Lucern geritten vnd von dannen nach Costantz vnd seinem vermellden nach fürter zu dem general Götzen ihne zu fürderlichem fortzug gegen den feind zu animirn passirt. Nach seinem außkommen seyn ein officier sambt noch einem soldaten wegen vnfleißiger wacht vnd der pfarherr zu Laufenburg neben seinem capellan auß verdacht, daß sie von deß duca vorhabender flucht waß gewüßt, gefänglich eingezogen, die gaistliche, wie verlautt, hart torquirt [gefoltert; BW], vnd obwoln sie vnschuldig geweßt, offentlich enthauptet; die ihenige fraw aber, durch deren hauß der duca sambt seinem camerdiener außkommen, vnd noch zwo personen mit růthen hart gestrichen worden“. Der Benediktoner-Abt Gaisser berichtet über die Verschiffung schwedischer Gefangener des Obristen John Forbes de Corse von Villingen nach Lindau (1633); STEMMLER, Tagebücher Bd. 1, S. 319: „Abschreckend war das Aussehen der meisten gemeinen Soldaten, da sie von Wunden entkräftet, mit eigenem oder fremdem Blute besudelt, von Schlägen geschwächt, der Kleider und Hüte beraubt, viele auch ohne Schuhe, mit zerrissenen Decken behängt, zu den Schiffen mehr getragen als geführt wurden, mit harter, aber ihren Taten angemessener Strafe belegt“. Gefangene waren je nach Vermögen darauf angewiesen, in den Städten ihren Unterhalt durch Betteln zu bestreiten. Sie wurden auch unter Offizieren als Geschenk gebraucht; KAISER, Wohin mit den Gefangenen ?, in: http://dkblog.hypotheses.org/108: „Im Frühsommer 1623 hatte Christian von Braunschweig, bekannt vor allem als ‚toller Halberstädter’, mit seinen Truppen in der Nähe Göttingens, also im Territorium seines älteren Bruders Herzog Friedrich Ulrich, Quartier genommen. In Scharmützeln mit Einheiten der Armee der Liga, die damals im Hessischen operierte, hatte er einige Gefangene gemacht. Was sollte nun mit diesen geschehen? Am 1. Juli a. St. wies er die Stadt Göttingen an, die gefangenen Kriegsknechte nicht freizulassen; vielmehr sollte die Stadt sie weiterhin ‚mit nottürfftigem vnterhalt’ versorgen, bis andere Anweisungen kämen. Genau das geschah wenige Tage später: Am 7. Juli a. St. erteilte Christian seinem Generalgewaltiger (d. h. der frühmodernen Militärpolizei) den Befehl, daß er ‚noch heutt vor der Sonnen vntergangk, viertzig dero zu Göttingen entthaltenen gefangenen Soldaten vom feinde, den Lieutenantt vnd Officiers außsgenommen, Laße auffhencken’. Um den Ernst der Anweisung zu unterstreichen, fügte er hinzu, daß dies ‚bei vermeidung vnser hochsten vngnad’ geschehen solle. Der Generalgewaltiger präsentierte daraufhin der Stadt Göttingen diesen Befehl; bei der dort überlieferten Abschrift findet sich auf der Rückseite die Notiz vom Folgetag: ‚Vff diesen Schein seindt dem Gewalthiger 20 Gefangene vff sein darneben mundtlich andeuten ausgevolgtt worden’. Der Vollzug fand also offenbar doch nicht mehr am 7. Juli, am Tag der Ausfertigung des Befehls, statt. Aber es besteht kaum ein Zweifel, daß zwanzig Kriegsgefangene mit dem Strang hingerichtet wurden. (StA Göttingen, Altes Aktenarchiv, Nr. 5774 fol. 2 Kopie; der Befehl an die Stadt Göttingen vom 1.7.1623 a.St. ebd. fol. 32 Ausf.)“. Bericht aus Stettin vom 8.4.1631; Relation Oder Bericht Auß Pommern. o. O. 1631: „Den 27. Martii sind alhier 108 gefangene eingebracht deren nach mehr folgen sollen / die werden alle in Schweden ins bergwerck gesand / das sie etwas redliches arbeiten lernen“. Teilweise wurden Gefangene auch unter den Offizieren verkauft; MÜHLICH; HAHN, Chronik 3. Bd., S. 607 (Schweinfurt 1645). Zur Problematik vgl. KAISER, Kriegsgefangene in der Frühen Neuzeit, S. 11-14. 1633 kostete die Auslösung bei der Kavallerie: Obrist 600 Rt. aufwärts, Obristleutnant 400 Rt., Obristwachtmeister 300 Rt., Rittmeister 200 Rt., Kapitänleutnant 70 Rt., Leutnant 60 Rt. bis 10 Rt. für einen Marketender, nach der Schlacht bei Jankau (1645) Obrist 500 Rt., Obristwachtmeister 300 Rt., Hauptmann 75 Rt., Kapitänleutnant und Leutnant 50 Rt.; GANTZER, Archivalien, S. 40f.
[17] Rittmeister [schwed. Ryttmåstere]: Oberbefehlshaber eines Kornetts (später Esquadron) der Kavallerie. Sein Rang entspricht dem eines Hauptmannes der Infanterie (vgl. Hauptmann). Wie dieser war er verantwortlich für Werbung und Soldzahlung, für Disziplin, Ausrüstung und Verpflegung sowie für die Ernennung der untergebenen Führer. Oft war er in erster Linie für die materielle Versorgung der Truppe zuständig, und die eigentlich militärischen Aufgaben wurden von seinem Stellvertreter, dem Leutnant, übernommen. Bei den kaiserlichen Truppen standen unter ihm Leutnant, Kornett, Wachtmeister, 2 oder 3 Korporale, 1 Fourier oder Quartiermeister, 1 Musterschreiber, 1 Feldscher, 2 Trompeter, 1 Schmied, 1 Plattner. Bei den schwedischen Truppen fehlten dagegen Sattler und Plattner, bei den Nationalschweden gab es statt Sattler und Plattner 1 Feldkaplan und 1 Profos, was zeigt, dass man sich um das Seelenheil als auch die Marsch- und Lagerdisziplin zu kümmern gedachte. Der Rittmeister beanspruchte in einer Kompanie Kürassiere 150 fl. Monatssold, d. h. 1.800 fl. jährlich, während ein bayerischer Kriegsrat 1637 jährlich 792 fl. erhielt, 1620 war er in der brandenburgischen Armee als Rittmeister über 50 Pferde nur mit 25 fl. monatlich datiert gewesen. Bei seiner Bestallung wurde er in der Regel durch den Obristen mit Werbe- und Laufgeld zur Errichtung neuer Kompanien ausgestattet. Junge Adlige traten oft als Rittmeister in die Armee ein.
[18] Freiburg im Breisgau; HHSD VI, S. 215ff.
[19] LEUPOLD, Journal, S. 337.
[20] Wittenweier [Kr. Lahr].
[21] Denzlingen [LK Emmendingen].
[22] Freiburg im Breisgau, HHSD VI, S. 215ff.
[23] Kenzingen [LK Emmendingen]; HHSD VI, S. 397f.
[24] Schuttern [Gem. Friesenheim, Ortenaukr.]; HHSD VI, S. 718f.
[25] Feldmarschall [schwed. fältmarskalk]: Stellvertreter des obersten Befehlshabers mit richterlichen Befugnissen und Zuständigkeit für Ordnung und Disziplin auf dem Marsch und im Lager. Dazu gehörte auch die Organisation der Seelsorge im Heer. Die nächsten Rangstufen waren Generalleutnant bzw. Generalissimus bei der kaiserlichen Armee. Der Feldmarschall war zudem oberster Quartier- und Proviantmeister. In der bayerischen Armee erhielt er 1.500 fl. pro Monat, in der kaiserlichen 2.000 fl. [nach der „Ordnung Wie es mit der verpflegung der Soldaten“ (1630)], die umfangreichen Nebeneinkünfte nicht mitgerechnet, war er doch an allen Einkünften wie Ranzionsgeldern, den Abgaben seiner Offiziere bis hin zu seinem Anteil an den Einkünften der Stabsmarketender beteiligt.
[26] Federigo Duca di Savelli, Signore di Poggio, Principe d’Albano, (auch Friedrich Herzog v. Savelli) [Rom vor 1600-
19.12.1649], kaiserlicher Feldmarschall.
[27] Johann Graf v. Götz [Götzen, Götze] [1599 Zehlendorf-6.3.1645 bei Jankau gefallen], kaiserlicher Feldmarschall. Vgl. ANGERER, Aus dem Leben des Feldmarschalls Johann Graf von Götz.
[28] Friesenheim [Ortenaukr.]; HHSD VI, S. 718f.
[29] Leutnant: Der Leutnant war der Stellvertreter eines Befehlshabers, insbesondere des Rittmeisters oder des Hauptmanns. Wenn auch nicht ohne Mitwissen des Hauptmannes oder Rittmeisters, hatte der Leutnant den unmittelbarsten Kontakt zur Kompanie. Er verdiente je nach Truppengattung monatlich 35-60 fl.
[30] Artillerie: Zur Wirksamkeit der Artillerie vgl. ENGLUND, Verwüstung Deutschlands, S. 424f.: „Sowohl bei sogenannten Kernschüssen als auch bei Visierschüssen zielte man mit dem Geschützrohr in mehr oder weniger waagrechter Position. Ein in dieser Position eingestellter Neunpfünder hatte eine Reichweite von etwas über 350 Metern. Dann schlug die Kugel zum erstenmal auf dem Boden auf, wonach sie regelmäßig einen Sprung machte und noch einmal 350 bis 360 Meter flog, bevor sie kraftlos erneut aufprallte – acht von zehn Kugeln sprangen mindestens dreimal auf. (Der Abprall hing davon ab, ob der Boden eben oder buckelig und uneben war.) Die Kugel flog die ganze Zeit in Mannshöhe. Sie konnte also auf ihrer gesamten Bahn töten und verwunden, und wenn sie im rechten Winkel durch eine dünne Linie von Männern schlug, pflegte sie im Durchschnitt drei Mann zu töten und vier oder fünf zu verwunden, aber es kam auch vor, daß eine einzige Kugel 40 Menschen auf einen Schlag tötete. Menschen und Tiere wurden meistens mit einem hohen und entsetzlichen Reißgeräusch zerfetzt. Es gibt Beschreibungen von Schlachten dieses Typs – wie es aussah, wenn brummende Vollkugeln in die von Pulverdampf eingehüllten und dicht gestaffelten Reihen aufrecht stehender Männer einschlugen: In der Luft über den Verbänden sah man dann eine kleine Kaskade von Waffenteilen, Rucksäcken, Kleidern, abgerissenen Köpfen, Händen, Beinen und schwer identifizierbaren menschlichen Körperteilen. Der tatsächliche Effekt beruhte in hohem Grade auf der Größe der Kugel. Leichte wie schwere Geschütze schossen im großen und ganzen ihre Kugeln mit der gleichen Anfangsgeschwindigkeit ab, etwas unter 500 Meter in der Sekunde, doch je größer die Kugel war – das Kaliber in Pfund bezeichnet das Kugelgewicht – , desto höhere Geschwindigkeit und Durchschlagskraft hatte sie, wenn sie ihr Ziel erreichte: die Beine und Muskeln und Zähne und Augäpfel eines Menschen auf der anderen Seite des Feldes“. Der technische Aufwand war beträchtlich bei 60-Pfündern rechnete man für 8 Tage à 30 Schuss 3 Ztr. Pulver, 13 Wagen mit 99 Pferden, dazu 3 Knechte u. 2 Büchsenmeister sowie deren Zubehör. „Vom Nürnberger Stückegießer Leonhard Loewe ist die Rechnung für die Herstellung zweier jeweils 75 Zentner schwerer Belagerungsgeschütze erhalten, die auf den heutigen Wert hochgerechnet werden kann. An Material- und Lohnkosten verlangte Loewe 2.643 Gulden, das sind ca. 105.000 bis 132.000 Euro. Das Material und der Feuerwerker-Lohn für den Abschuss einer einzigen 24-pfündigen Eisenkugel aus den „Halben Kartaunen“ kostete fünf Reichstaler – mehr als die monatliche Besoldung eines Fußsoldaten“. EICKHOFF; SCHOPPER, 1636, S. 81. Vgl. ENGERISSER, Von Kronach, S. 575ff.
[31] Stück: Man unterschied Kartaunen [Belagerungsgeschütz mit einer Rohrlänge des 18-19-fachen Rohrkalibers [17,5 – 19 cm], verschoss 40 oder 48 Pfund Eisen, Rohrgewicht: 60-70 Zentner, Gesamtgewicht: 95-105 Zentner, zum Vorspann nötig waren bis zu 32 Pferde: 20-24 Pferde zogen auf einem Rüstwagen das Rohr, 4-8 Pferde die Lafette]; Dreiviertelkartaune: langläufiges Geschütz mit großer Reichweite, Rohrlänge 16-17faches Kaliber, schoss 36 Pfund Eisen. Vgl. MIETH, Artilleria Recentior Praxis; halbe Kartaunen [langläufiges Geschütz mit großer Reichweite, Rohrlänge 32-34-faches Kaliber (10,5-11,5 cm), schoss 8-10 Pfund Eisen. Das Rohrgewicht betrug 22-30 Zentner, das Gesamtgewicht 34-48 Zentner. Als Vorspann wurden 10-16 Pferde benötigt].
Viertelkartaune: „ein stück, welches 12 pfund eisen treibt, 36 zentner wiegt, und 24 kaliber lang ist. man hält diese stücke in den vestungen für die allerbequemste“ [DWB]. Meist als Feldschlange bezeichnet wurde auch die „Halbe Schlange“: langläufiges Geschütz mit großer Reichweite, Rohrlänge 32-34-faches Kaliber (10,5-11,5 cm), schoss 8-10 Pfund Eisen. Das Rohrgewicht betrug 22-30 Zentner, das Gesamtgewicht 34-48 Zentner. Als Vorspann wurden 10-16 Pferde benötigt; die „Quartierschlange“: 40-36-faches Kaliber (6,5-9 cm), Rohrgewicht: 12-24 Zentner, Gesamtgewicht: 18-36 Zentner, Vorspann: 6-12 Pferde; Falkone: 39-faches Kaliber Rohrgewicht: 14-20 Zentner, Gesamtgewicht: 22-30 Zentner, Vorspann: 6-8 Pferde; Haubitze als Steilfeuergeschütz, 10-faches Kaliber (12-15 cm), zumeist zum Verschießen von gehacktem Blei, Eisenstücken („Hagel“) bzw. Nägeln verwendet; Mörser als Steilfeuergeschütz zum Werfen von Brand- und Sprengkugeln (Bomben). Angaben nach ENGERISSER, Von Kronach nach Nördlingen, S. 575ff. Pro Tag konnten etwa 50 Schuss abgegeben werden. „Vom Nürnberger Stückegießer Leonhard Loewe ist die Rechnung für die Herstellung zweier jeweils 75 Zentner schwerer Belagerungsgeschütze erhalten, die auf den heutigen Wert hochgerechnet werden kann. An Material- und Lohnkosten verlangte Loewe 2.643 Gulden, das sind ca. 105.000 bis 132.000 Euro. Das Material und der Feuerwerker-Lohn für den Abschuss einer einzigen 24-pfündigen Eisenkugel aus diesen ‚Halben [?; BW] Kartaunen’ kosteten fünf Reichstaler – mehr als die monatliche Besoldung eines Fußsoldaten“. EICKHOFF; SCHOPPER, 1636, S. 81; SCHREIBER, Beschreibung, bzw. Anleitung, 3. Kapitel.
[32] spielen [mit den Stücken]: Einsatz, Abfeuern (der Feldgeschütze) als Terminus technicus: „mit den Geschützen spielen“, um die Moral des Gegners zu schwächen.
[33] Scharmützel: Unter Scharmützel (ital. „scaramuccia“, Geplänkel, Plänkelei, Treffen) verstand man eines der vielen kleineren Gefechte oder Handgemenge, aus denen dieser Krieg bestand. Kleinere Armeeeinheiten oder Streifkorps, z. T. auch größere Verbände von bewaffneten Bauern (vgl. Harzschützen), traten hier in einen zeitlich wie örtlich begrenzten Kampf ein. Auch Schlachten wurden zumeist mit Scharmützeln oder Plänkeleien eröffnet. Scharmützel waren in der Regel gekennzeichnet durch äußerste Brutalität. Allerdings konnten sie auch Auslöser eines größeren Treffens, einer Schlacht oder eines Krieges werden. Oft wurden Vor- oder Nachhut von Heeren durch Kroaten angegriffen, die in diesem kleinen Krieg bevorzugt eingesetzt wurden. Zum Teil kam es auch wegen der fehlenden Uniformierung zu verlustreichen Kämpfen mit eigenen Einheiten. oder „neutralen“ Einheiten. Am 15.1.1648 traf die kursächsische Besatzung Annabergs auf eine kaiserliche Streifschar, die man für Schweden hielt: „Beym Stillstand im Lande und instehenden Frieden ist doch im Gebürge beym Städtlein Thum ein seltzamer Scharmützel vorgegangen / indem dem 15. Jan. der in Annaberg liegende Obrist-Wachtmeister / Rudolph von Neitschütz / mit seinen zwo Compagnien auff den so genannten blinden Valentin / einen Kayserl. Rittmeister / welcher eine Raub-Parthie geführet / getroffen / daß bey diesem verwegenen Unternehmen unterderschiedliche geblieben und viel blessiret worden / auch in dieser scharffen Rencontre noch mehr auffgerieben werden sollen / wo nicht angeregter blinder Valten und Rittmeister Hanß Ernst einander erkennet und darauff beyderseits Partheyen von einander abgeführet hätten […]. Und dieser Thumische Scharmützel heisset catachrestice [seit der antiken Rhetorik unlogischer Gebrauch eines verwandten statt des nicht vorhandenen Ausdrucks] die Thumer Schlacht / wie Ihn weyland der gemeine Mann genennet hat“. MELTZER, Historia, S. 1363; ARNOLD, Annaberg, S. 283f.; GROHMANN, Obererzgebirge, S. 208. Der Erzgebirgschronist LEHMANN, Kriegschronik, S. 169f., datiert diesen Vorgang allerdings auf 1647: „Bey dem armistitio zwischen Chur-Saxen und denen Schwedischen wahr auch außbedinget worden, daß der Churfürst die streiffende rotten einfangen und sie verfolgen solte; das befahle der Churfürst allen Seinen regiementern in lande, und musten auch die 2 Compagnien, so auf den Annenberg, die Straßen bereiten und denen Mausparthien wehren. Nun wahr der keyßerliche leutenandt, insgemein der blinde Valtin [Valten Hanke; BW] genandt, mit 80 Pferden, meist Freyreutern auß Lignitz nach Erfurt und Eisenach gegangen den 12. Januarii, hatte bey Eckersberg die leipziger Fuhrleute, welche eine wagenburg gemacht und sich gewehret, theils uberwaltiget, 10 Personen todt geschoßen und 20 beschedigt, dargegen 2 tode gelaßen und ezliche beschedigte mitgenommen, darmit kam er biß nach Burckersdorf ins gebirg, griff do wieder die Leipziger fuhr an auß den gebirg. Alß solches die 2 Compagnien uff den Annenberg untter den Obrist-Wachmeister Rudolph von Neidschiz gehöret, sindt sie Churfürstlichen Befehl zue folge ihm entgegengezogen, derselben auf freyen felde bey den Städtlein Thum auf einer höhe angetroffen. Rittmeister Landtmann [Langmann] nimmt einen Cornet mit 20 Pferden zu sich, jagt voran und fragt, warumb er als freundt in Meißen so raube und streiffe, und weil der Valten kein gut word giebet, greyffen Sie beyde zum gewehr, Landtmann trift den Valten in arm, Valten aber schießt Landtmann auch wundt und den Cornet todt, seine reuter schneiden die beuten und Säcke voll sammet und seiden von Pferden und schoßen Sich mit den Churfürstlichen eine Virtelstunde herumb, daß von Churfürstlichen der Ritmeister (bekam 3 schöße), 1 leutenandt, 1 Cornet und 5 reuter tödtlich, 7 beschedigt. Der blinde Valten hatte 16 beschedigte, ließ 5 reuter und seine beute hinder sich und ging eilendt in Böhmen. Das ist geschehen den 15. Januar Freytag nach den 1. Sontag Epiphanias. Die keyßerlichen waren meist feste [durch magische Praktiken kugelfest, BW] sonst würden sie mehr eingebüst haben. Der Cornet wurde den 3. Februar zum Annenberg in die kirche begraben“.
[34] spargiert: verbreitet.
[35] Mahlberg [Ortenau-Kr.]; HHSD VI, S. 496f.
[36] Lukas 19, 41-44.
[37] Kavallier: I. Bezeichnung für einen Ritterbruder des Deutschen Ordens. Jeder zum Ritter geschlagene Mann konnte in der Anfangszeit mit dem Profess unter dem Beistand eines glaubwürdigen Bürgen zum Ordensritter avancieren. Später war die Würde eines Ritters allerdings Adligen vorbehalten. II. ursprünglich für Reiter, später für einen Ritter oder einen Mann ritterlicher, d. h. adliger Herkunft verwendet, dann mehr Höflichkeitsfloskel.
[38] Breisach am Rhein [LK Breisgau-Hochschwarzwald]; HHSD VI, S. 110ff.
[39] Schanze: geschlossenes, auf dem Feld angelegtes Erdwerk, zur Belagerung und zur Verteidigung. Schanzgräber waren für die Anlage von Belagerungs- und Verteidigungswerken zuständige Arbeiter (Schanzbauern), die im Tross des Heeres mitzogen und dem Schanzmeister unterstanden. Sie waren weitgehend verachtete Menschen, die in der sozialen Hierarchie der Heere nur wenig über den Prostituierten standen und schlecht bezahlt wurden. Auch verurteilte Straftäter wurden zu Schanzarbeiten herangezogen. Diese „Condemnatio ad opera publica“, die Verurteilung zu Schanzarbeiten, war als Todesstrafe in absehbarer Zeit gedacht. Bürger und Geistliche der besetzten Städte sowie Klosteruntertanen, die zu diesen Arbeiten verpflichtet bzw. dafür ausgelost wurden, empfanden diese schwere Arbeit als ehrenrührig und entzogen sich ihr durch die Flucht. Zum Teil wurden Kinder ab 12 Jahren zu dieser harten Arbeit eingesetzt, ganze Schulklassen dazu getrieben. Vgl. auch die Beschreibung der Drangsalierung der Bürger Iglaus 1647 bei STERLY, Drangsale, S. 64f.. Um seine eigenen Truppen zu schonen, zwang Johann von Götz bei der Belagerung der Feste Marienberg (Würzburg) eine große Anzahl von Bauern der Umgebung, Schanzarbeiten zu verrichten, ‚vnd die Stücke, die Er mit Pferden nicht dahin bringen konnte, hinauffzuziehen: Worüber dan viele todt geblieben, vnd daher die Bauren aller orten sich häuffig absentiret vnd verlauffen‘ (CHEMNITZ, Königlich Schwedichen […] II, S. 581). Auch eingeflüchtete Bauern wurden zu diesen schweren Arbeiten gezwungen. Im schwedischen Heer wurden dazu bevorzugt die ohnehin sozial deklassierten Finnen eingesetzt (vgl. auch TOEPPEN, Hoppes Chronik, S. 77). Reichskanzler Oxenstierna hatte auch den Frankfurtern die Verpflichtung der Bettler zum Festungs- bzw. Schanzenbau empfohlen. Im 17. Jahrhundert wurden zunehmend auch Soldaten durch die Aufnahme der Schanzpflicht in die Artikelbriefe für Schanzarbeiten herangezogen; ein Versuch der Fürsten, ein bisher ungenutztes Reservoir an billigen Arbeitskräften zu erschließen, eine Reaktion auf die neuen militärischen Erfordernisse (Belagerungs- und Grabenkrieg, Ausbreitung der Festungen) und Ausdruck des fürstlichen Willens, die Soldaten körperlich, geistig und sittlich zu disziplinieren (vgl. BURSCHEL, Söldner, S. 138, 255). Bei den Schweden wurden bevorzugt die Finnen zu diesen schweren Arbeiten herangezogen. Aus Iglau wird unter 1647 berichtet, wie der schwedische Kommandant Österling die nur noch 299 [von ehemals 13.000) Einwohner fassende Stadt während der Belagerung durch die Kaiserlichen zur Schanzarbeit trieb; STERLY, Drangsale, S. 64f.: „In das kaiserliche Lager langte immer mehr und mehr schweres Geschütz an; als dieses der Kommandant erfuhr; ließ er er voll Grimm die Einwohner wie das mit aller Gewalt auf die Schanzarbeit treiben, und erließ das strengste Verboth, daß außer dieser Arbeit sich keine Manns- noch Weibsperson sehen lasse. Was war dieses für ein Trübsal unter den armen Bürgern ! dieselben hatten ihren geringen Vorrath an den nothwendigsten Lebensmitteln bereits aufgezehrt, und konnten sich bei dem bestehenden strengsten Verbothe, nicht auszugehen, keine andere beischaffen; vom Hunger und Durst gequält, und daher ganz erschöpft, mussten sie sich dennoch den schwersten Arbeiten unterziehen. Der Kommandant war taub gegen alles Bitten und Flehen; verlangten einige die Erlaubniß, sich aus der Stadt zu entfernen, so ließ er sie in den Zwinger einschließen, ihnen des Tags ein bischen Brot und ein wenig Wasser reichen, dafür aber unter Schlägen zur Arbeit anhalten. Als der Kommandant die Deserzion zweier seiner Leute am vorhergehenden Tage erfuhr, und besorgte, daß Mehrere diesem Beispiele folgen dürften, so ließ er den Arbeitenden Fußeisen anlegen“.
[40] filiren: einzeln hintereinander gehen oder reiten.
[41] Generalmajor: Der Generalmajor nahm die Aufgaben eines Generalwachtmeisters in der kaiserlichen oder bayerischen Armee war. Er stand rangmäßig bei den Schweden zwischen dem Obristen und dem General der Kavallerie, bei den Kaiserlichen zwischen dem Obristen und dem Feldmarschallleutnant.
[42] Georg Christoph v. Taupadel [Tupadel, Tupadell, Taubadel, Toupadel, Tubal, Taubald, Thobadel, Dupadel, Dubald, Dubadell, Dubalt, „Raupartl“, Teupold] [um 1600 Fichtenberg-12.3.1647 Basel], schwedischer Generalleutnant.
[43] Kürassier: Kürisser, Kyrisser, Corazzen (franz. Cuirasse für Lederpanzer (cuir = Leder). Die Kürassiere waren die älteste, vornehmste – ein gerade daher unter Adligen bevorzugtes Regiment – und am besten besoldete Waffengattung. Sie gehörten zu den Eliteregimentern, der schweren Reiterei, deren Aufgabe im Gefecht es war, die feindlichen Linien zu durchbrechen, die Feinde zur Flucht zu nötigen und damit die Schlacht zu entscheiden. Sie trugen einen geschwärzten Trabharnisch (Brust- und Rückenharnisch, den „Kürass“), Ober- und Unterarmzeug, eiserne Stulphandschuhe, Beinschienen und Stulpstiefel mit Sporen, Schwert oder Säbel und zwei lange Reiterpistolen, die vor dem Aufsitzen gespannt wurden. Im späten 16. Jahrhundert wurde es in der schweren Reiterei üblich, einen knielangen Küriss ohne Unterbeinzeug zu tragen. Der Kürass wurde mit 15 Rt. veranschlagt. SKALA, Kürassiere; WALLHAUSEN, Kriegs-Kunst zu Pferd. Nach LICHTENSTEIN, Schlacht, S. 42f., musste ein dänischer Kürassier mit einem mindestens16 „Palmen“ [1 Palme = 8, 86 cm] hohen Pferd, Degen u. Pistolen antreten. Der Kürass kostete ihn 15 Rt. Er durfte ein kleineres Gepäckpferd u. einen Jungen mitbringen. Der Arkebusier hatte ebenfalls Pferd, Degen u. Pistolen mitzubringen, durfte aber ein 2. Pferd nur halten, wenn er v. Adel war. Für Brust- u. Rückenschild musste er 11 Rt. zahlen. Der Infanterist brachte den Degen mit u. ließ sich für das gelieferte Gewehr einen Monatssold im ersten halben Jahr seines Dienstes abziehen. Bei der Auflösung des Regiments erhielten die Soldaten sämtl. Waffen mit einem Drittel des Ankaufspreises vergütet, falls der Infanterist noch nicht 6 Monate, der Kavallerist noch nicht 10 Monate gedient hatte; andernfalls mussten sie die Waffen ohne jede Vergütung abliefern. Der Kürassier erhielt für sich u. seinen Jungen täglich 2 Pfd. Fleisch, 2 Pfd. Brot, 1/8 Pfd. Butter oder Käse u. 3 „Pott“ [1 Pott = 4 Glas = 0, 96 Liter] Bier. Arkebusier u. Infanterist bekamen die Hälfte. Die tägliche Ration betrug 12 Pfd. Heu, Gerste oder Hafer je nach den Vorräten. An das Kommissariat musste der Kürassier für Portion u. Ration monatlich 7 Rt., an den Wirt im eigenen oder kontribuierenden Land musste der Kürassier 5, der Unteroffizier 4, der Sergeant 3, Arkebusier u. Infanterist 2 1/2 Rt. zahlen. Im besetzten Land, das keine Kontributionen aufbrachte, wurde ohne Bezahlung requiriert. Ein Teil des Handgeldes wurde bis zum Abschied zurückbehalten, um Desertionen zu verhüten, beim Tode wurde der Teil an die Erben ausbezahlt. Kinder u. Witwen bezogen einen sechsmonatlichen Sold. Zu den schwedischen Kürassierregimentern vgl. die Bestimmungen in der Kapitulation für Efferen, Adolf Theodor [Dietrich], genannt Hall => „Miniaturen“. Des Öfteren wurden Arkebusierregimenter in Kürassierregimenter umgewandelt, falls die notwendigen Mittel vorhanden waren.
[44] Regiment: Größte Einheit im Heer: Für die Aufstellung eines Regiments waren allein für Werbegelder, Laufgelder, den ersten Sold und die Ausrüstung 1631 bereits ca. 135.000 fl. notwendig. Zum Teil wurden die Kosten dadurch aufgebracht, dass der Obrist Verträge mit Hauptleuten abschloss, die ihrerseits unter Androhung einer Geldstrafe eine bestimmte Anzahl von Söldnern aufbringen mussten. Die Hauptleute warben daher Fähnriche, Kornetts und Unteroffiziere an, die Söldner mitbrachten. Adlige Hauptleute oder Rittmeister brachten zudem Eigenleute von ihren Besitzungen mit. Wegen der z. T. immensen Aufstellungskosten kam es vor, dass Obristen die Teilnahme an den Kämpfen mitten in der Schlacht verweigerten, um ihr Regiment nicht aufs Spiel zu setzen. Der jährliche Unterhalt eines Fußregiments von 3.000 Mann Soll-Stärke wurde mit 400- 450.000 fl., eines Reiterregiments von 1.200 Mann mit 260.-300.000 fl. angesetzt. Zu den Soldaufwendungen für die bayerischen Regimenter vgl. GOETZ, Kriegskosten Bayerns, S. 120ff.; KAPSER, Kriegsorganisation, S. 277ff. Ein Regiment zu Fuß umfasste de facto bei den Kaiserlichen zwischen 650 und 1.100, ein Regiment zu Pferd zwischen 320 und 440, bei den Schweden ein Regiment zu Fuß zwischen 480 und 1.000 (offiziell 1.200 Mann), zu Pferd zwischen 400 und 580 Mann, bei den Bayerischen 1 Regiment zu Fuß zwischen 1.250 und 2.350, 1 Regiment zu Roß zwischen 460 und 875 Mann. Das Regiment wurde vom Obristen aufgestellt, von dem Vorgänger übernommen und oft vom seinem Obrist-Leutnant geführt. Über die Ist-Stärke eines Regiments lassen sich selten genaue Angaben finden. Das kurbrandenburgische Regiment Carl Joachim von Karberg [Kerberg] sollte 1638 sollte auf 600 Mann gebracht werden, es kam aber nie auf 200. Karberg wurde der Prozess gemacht, er wurde verhaftet und kassiert; OELSNITZ, Geschichte, S. 64. Als 1644 der kaiserliche Generalwachtmeister Johann Wilhelm von Hunolstein die Stärke der in Böhmen stehenden Regimenter feststellen sollte, zählte er 3.950 Mann, die Obristen hatten 6.685 Mann angegeben. REBITSCH, Gallas, S. 211; BOCKHORST, Westfälische Adlige.
[45] Obrist: I. Regimentskommandeur oder Regimentschef mit legislativer und exekutiver Gewalt, „Bandenführer unter besonderem Rechtstitel“ (ROECK, Als wollt die Welt, S. 265), der für Bewaffnung und Bezahlung seiner Soldaten und deren Disziplin sorgte, mit oberster Rechtsprechung und Befehlsgewalt über Leben und Tod. Dieses Vertragsverhältnis mit dem obersten Kriegsherrn wurde nach dem Krieg durch die Verstaatlichung der Armee in ein Dienstverhältnis umgewandelt. Voraussetzungen für die Beförderung waren (zumindest in der kurbayerischen Armee) richtige Religionszugehörigkeit (oder die Konversion), Kompetenz (Anciennität und Leistung), finanzielle Mittel (die Aufstellung eines Fußregiments verschlang 1631 in der Anlaufphase ca. 135.000 fl.) und Herkunft bzw. verwandtschaftliche Beziehungen (Protektion). Der Obrist ernannte die Offiziere. Als Chef eines Regiments übte er nicht nur das Straf- und Begnadigungsrecht über seine Regimentsangehörigen aus, sondern er war auch Inhaber einer besonderen Leibkompanie, die ein Kapitänleutnant als sein Stellvertreter führte. Ein Obrist erhielt in der Regel einen Monatssold von 500-800 fl. je nach Truppengattung. Daneben bezog er Einkünfte aus der Vergabe von Offiziersstellen. Weitere Einnahmen kamen aus der Ausstellung von Heiratsbewilligungen, aus Ranzionsgeldern – 1/10 davon dürfte er als Kommandeur erhalten haben – , Verpflegungsgeldern, Kontributionen, Ausstellung von Salvagardia-Briefen – die er auch in gedruckter Form gegen entsprechende Gebühr ausstellen ließ – und auch aus den Summen, die dem jeweiligen Regiment für Instandhaltung und Beschaffung von Waffen, Bekleidung und Werbegeldern ausgezahlt wurden. Da der Sold teilweise über die Kommandeure ausbezahlt werden sollten, behielten diese einen Teil für sich selbst oder führten „Blinde“ oder Stellen auf, die aber nicht besetzt waren. Auch ersetzten sie zum Teil den gelieferten Sold durch eine schlechtere Münze. Zudem wurde der Sold unter dem Vorwand, Ausrüstung beschaffen zu müssen, gekürzt oder die Kontribution unterschlagen. Vgl. BELLINCKHAUSEN; TEGEDER; KREIENBRINK, der osnabrugischen handlung, S. 277: „Wir burger mußen alle wochen unse contribution zahlen, die obristen nehmmens geldt zu sich, und die gemeinen soldaten mußen hunger leyden“. Der Austausch altgedienter Soldaten durch neugeworbene diente dazu, ausstehende Soldansprüche in die eigene Tasche zu stecken. Zu diesen „Einkünften“ kamen noch die üblichen „Verehrungen“, die mit dem Rang stiegen und nicht anderes als eine Form von Erpressung darstellten, und die Zuwendungen für abgeführte oder nicht eingelegte Regimenter („Handsalben“) und nicht in Anspruch genommene Musterplätze; abzüglich allerdings der monatlichen „schwarzen“ Abgabe, die jeder Regimentskommandeur unter der Hand an den Generalleutnant oder Feldmarschall abzuführen hatte; Praktiken, die die obersten Kriegsherrn durchschauten. Zudem erbte er den Nachlass eines ohne Erben und Testament verstorbenen Offiziers. Häufig stellte der Obrist das Regiment in Klientelbeziehung zu seinem Oberkommandierenden auf, der seinerseits für diese Aufstellung vom Kriegsherrn das Patent erhalten hatte. Der Obrist war der militärische ‚Unternehmer‘, die eigentlich militärischen Dienste wurden vom Major geführt. Das einträgliche Amt – auch wenn er manchmal „Gläubiger“-Obrist seines Kriegsherrn wurde – führte dazu, dass begüterte Obristen mehrere Regimenter zu errichten versuchten (so verfügte Werth zeitweise sogar über 3 Regimenter), was Maximilian I. von Bayern nur selten zuließ oder die Investition eigener Geldmittel von seiner Genehmigung abhängig machte. Im April 1634 erging die kaiserliche Verfügung, dass kein Obrist mehr als ein Regiment innehaben dürfe; ALLMAYER-BECK; LESSING, Kaiserliche Kriegsvölker, S. 72. Die Möglichkeiten des Obristenamts führten des Öfteren zu Misshelligkeiten und offenkundigen Spannungen zwischen den Obristen, ihren karrierewilligen Obristleutnanten (die z. T. für minderjährige Regimentsinhaber das Kommando führten; KELLER, Drangsale, S.388) und den intertenierten Obristen, die auf Zeit in Wartegeld gehalten wurden und auf ein neues Kommando warteten. Zumindest im schwedischen Armeekorps war die Nobilitierung mit dem Aufstieg zum Obristen sicher. Zur finanziell bedrängten Situation mancher Obristen vgl. dagegen OMPTEDA, Die von Kronberg, S. 555. Da der Obrist auch militärischer Unternehmer war, war ein Wechsel in die besser bezahlten Dienste des Kaisers oder des Gegners relativ häufig. Der Regimentsinhaber besaß meist noch eine eigene Kompanie, so dass er Obrist und Hauptmann war. Auf der Hauptmannsstelle ließ er sich durch einen anderen Offizier vertreten. Ein Teil des Hauptmannssoldes floss in seine eigenen Taschen. Ertragreich waren auch Spekulationen mit Grundbesitz oder der Handel mit (gestohlenem) Wein (vgl. BENTELE, Protokolle, S. 195), Holz, Fleisch oder Getreide. II. Manchmal meint die Bezeichnung „Obrist“ in den Zeugnissen nicht den faktischen militärischen Rang, sondern wird als Synonym für „Befehlshaber“ verwandt. Vgl. KAPSER, Heeresorganisation, S. 101ff.; REDLICH, German military enterpriser; DAMBOER, Krise; WINKELBAUER, Österreichische Geschichte Bd. 1, S. 413ff.
[46] Friedrich Ludwig Chanovsky [Chanowsky, Canoffsky, Canofski, Canoski, Canoffsgi, Conofsgy, Kanofsky, Kanofski, Kanofzgi, Kohafzi] v. Langendorf [2.2.1592 Heidelberg-24.11.1645 Strasbourg], schwedisch-weimarischer Obrist.
[47] Reinhold v. Rosen [Rosa, Rosau, Roß], der „Gute“, Herr v. Bollweiler u. Herrenstein [nach 1595, um 1604 Ninigall, Livland – 8./18.12.1667 Schloss Dettweiler, Kr. Zabern; Elsass], schwedisch-französischer Obrist, Generalmajor.
[48] Wilhelm Graf v. Nassau-Siegen [13.8.1592 Dillenburg-18.7.1642 Orsoy], kaiserlicher Feldmarschall.
[49] N [Moritz ?] Freiherr v. Putbus [Puttbuß] [ – ], weimarischer Obrist.
[50] Brigade: Anfangs bestand die schwedische Brigade aus 4 Schwadronen (Squadrons) oder Halbregimentern, also 2016 Mann und 256 Offizieren, ab 1631 nur noch aus 3 Schwadronen Fußvolk zu je 504 Mann und 64 Offizieren. Die insgesamt 1512 Mann waren in 648 Pikeniere und 864 Musketiere eingeteilt, die in Rotten zu je 6 Mann aufgestellt waren.
[51] Musketier: Fußsoldat, der die Muskete führte. Für den Nahkampf trug er ein Seitengewehr – Kurzsäbel oder Degen – und schlug mit dem Kolben seiner Muskete zu. In aller Regel kämpfte er jedoch als Schütze aus der Ferne. Deshalb trug er keine Panzerung, schon ein leichter Helm war selten. Eine einfache Muskete kostete etwa 3 ¼ Gulden, die qualitativ besseren Suhler Waffen das Doppelte, so dass seine Ausrüstung nicht so kostenintensiv war. Im Notfall wurden die Musketiere auch als Dragoner verwendet, die aber zum Kampf absaßen. Der Hildesheimer Arzt und Chronist Dr. Jordan berichtet den einzigen bisher bekannten Fall (1634), dass sich unter den Gefallenen eines Scharmützels auch ein weiblicher Musketier in Männerkleidern gefunden habe. SCHLOTTER; SCHNEIDER; UBBELOHDE, Acta, S. 194. Allerdings heißt es schon bei Stanislaus Hohenspach (1577), zit. bei BAUMANN, Landsknechte, S. 77: „Gemeiniglich hat man 300 Mann unter dem Fenlein, ist 60 Glied alleda stellt man welsche Marketender, Huren und Buben in Landsknechtskleyder ein, muß alles gut seyn, gilt jedes ein Mann, wann schon das Ding, so in den Latz gehörig, zerspalten ist, gibet es doch einen Landsknecht“. Bei Bedarf wurden selbst Kinder schon als Musketiere eingesetzt (1632); so der Benediktiner-Abt Gaisser; STEMMLER, Tagebuch Bd. 1, S. 181f.; WALLHAUSEN, Kriegskunst zu Fuß; BRNARDÍC, Imperial Armies I, S. 33ff.; Vgl. KEITH, Pike and Shot Tactics; EICKHOFF; SCHOPPER, 1636, S. 59ff.
[52] Muskete: Die 1, 5 – 2 mm dicken Brustharnische der Pikeniere boten keinen ausreichenden Schutz gegen Musketenkugeln, die mit 300 m/sec noch auf 40 Meter den Harnisch und seinen Träger durchschlugen und ihm meist tödliche Verletzungen zufügten. EICKHOFF; SCHOPPER, 1636, S. 79, 156. Bei einer Schussentfernung von 100 m wird der Brustpanzer noch durchschlagen, in der Regel blieb aber die Kugel im Körper zurück und fügt dem Getroffenen schwere Verletzungen zu. Bei einer Entfernung von 200 m wird der Panzer zwar nicht mehr durchschlagen, der Getroffene erleidet aber schwere Prellungen. EICKHOFF; SCHOPPER, 1636, S. 79f. Vgl. auch EICKHOFF; SCHOPPER, 1636, S. 59ff.
[53] Viertelkartaune: „ein stück, welches 12 pfund eisen treibt, 36 zentner wiegt, und 24 kaliber lang ist. man hält diese stücke in den vestungen für die allerbequemste“ [GRIMM; GRIMM, DWB].
[54] Regimentsstück: leichtes Feldgeschütz, durch Gustav II. Adolf eingeführt, indem er jedem Infanterie-Regiment ständig zwei leichte Geschütze zuordnete. Die Bedienung übernahmen erstmals besonders eingeteilte Soldaten. Die Regimentsstücke waren meist 3-Pfünder-Kanonen. Sie wurden durch eine Protze im meist zweispännigen Zug, gefahren vom Bock. d. h. der Fahrer saß auf der Protze, beweglich gemacht. [wikipedia]
[55] Konstabel: Geschützmeister (Schütze), Kriegshandwerker, der auch für schwere Festungs- und Belagerungsartillerie Rohre und Geschosse herstellte. Er musste Richten und Laden, Instandhaltung und Reparatur beherrschen. Stückgießer und Büchsenschmiede wie Pulvermacher arbeiteten unter seiner Anleitung. Gut bezahlte Büchsenmeister nahmen an Kriegszügen teil und genossen eine bessere Verpflegung als Soldaten. Der Büchsenmeister unterstand dem Zeugmeister, der sie auch anwarb, im Gefecht hatte der (General)Feldzeugmeister den Befehl.
[56] Handlanger („handlangere“): Bezeichnung für den Assistenten des Geschützmeisters („konstapel“) in der schwedischen Armee.
[57] Schwadron: Im 16. Jahrhundert bezeichnete Escadre (von lateinisch exquadra Gevierthaufen, Geschwader) eine Stellungsform des Fußvolks und der Reiterei, aus welcher im 17. Jahrhundert für letztere die Eskadron, für ersteres das Bataillon hervorging. Ca. 210 Pikeniere sollten eine Schwadron bilden, 3 eine Brigade. Die Schwadron der Reiterei entsprach der Kompanie der Fußtruppen. Die schwedische Kompanie (Fußtruppen) bestand nach Lorenz TROUPITZ, Kriegs-Kunst / nach Königlich Schwedischer Manier eine Compagny zu richten, Franckfurt 1638, aus drei Schwadronen (zu Korporalschaften, eine Schwadron entsprach daher dem späteren Zug).
[58] Bagage: Gepäck; Tross. „Bagage“ war die Bezeichnung für den Gepäcktrain des Heeres, mit dem die Soldaten wie Offiziere neben dem Hausrat auch ihre gesamte Beute abtransportierten, so dass die Bagage während oder nach der Schlacht gern vom Feind oder von der eigenen Mannschaft geplündert wurde. Auch war man deshalb darauf aus, dass in den Bedingungen bei der freiwilligen Übergabe einer Stadt oder Festung die gesamte Bagage ungehindert abziehen durfte. Manchmal wurde „Bagage“ jedoch auch abwertend für den Tross überhaupt verwendet, die Begleitmannschaft des Heeres oder Heeresteils, die allerdings keinen Anspruch auf Verpflegungsrationen hatte; etwa 1, 5 mal (im Anfang des Krieges) bis 3-4mal (am Ende des Krieges) so stark wie die kämpfende Truppe: Soldatenfrauen, Kinder, Prostituierte 1.-4. Klasse („Mätresse“, „Concubine“, „Metze“, „Hure“), Trossjungen, Gefangene, zum Dienst bei der Artillerie verurteilte Straftäter, Feldprediger, Zigeuner als Kundschafter und Heilkundige, Feldchirurg, Feldscherer, Handwerker, Sudelköche, Krämer, Marketender, -innen, Juden als Marketender, Soldatenwitwen, invalide Soldaten, mitlaufende Zivilisten aus den Hungergebieten, ehemalige Studenten, Bauern und Bauernknechte, die während der schlechten Jahreszeit zum Heer gingen, im Frühjahr aber wieder entliefen, Glücksspieler, vor der Strafverfolgung durch Behörden Davongelaufene, Kriegswaisen etc. KROENER, „ … und ist der jammer nit zu beschreiben“; LANGER, Hortus, S. 96ff.
[59] Beute: Beute war im allgemeinen Verständnis das Recht des Soldaten auf Entschädigung für die ständige Lebensgefahr, in der er sich befand und das Hauptmotiv für den Eintritt in die Armee. BURSCHEL, Söldner, S. 206ff. Für den lutherischen Theologen Scherertz galten allerdings nur der Bestand der Christenheit, die Reinheit des Glaubens und der Erhalt der Gerechtigkeit aus hinreichender Grund; BITZEL, Sigmund Scherertz, S. 153. Dabei war Beute ein sehr weit gefasster Begriff, von Beutekunst wie sakralen Gegenständen, Altarbildern, Bildern, Büchern (wie etwa in der Mainzer Universitätsbibliothek; FABIAN u. a., Handbuch Bd. 6, S. 172), bis hin zu den Wertgegenständen der Bürger. STEGMANN, Grafschaft Lippe, S. 63: Interessant ist auch die Auflistung der von staatischen Truppen bei einem Überfall erbeuteten Wertsachen des ligistischen Generalproviantmeisters Münch von Steinach, darunter augenscheinlich auch Beutegut: „Ein gantz gülden Khetten mit zweyen Strengen. Daran ist gewesen ein gantz güldens Agnus Dei. Aber ein kleins auch güldens Agnus Dei Gefeß. Wieder eins von Silber und vergolt. Ein schönes Malekhidt-Hertz mit Goldt eingefast. Ein Goldtstückh mit einem Crucifix. Aber ein Goldstückh mit einem Kreutz. Aber ein Hertz von Jaspis vom Goldt eingefast, so für den bösen Jammer gebraucht wirdt. Ein großer Petschafftring von Goldt. Ein von Silber und vergolts Palsambüchsel. Ein Paternoster an silbern Tradt gefast. Ein Pethbuch. Dan an Geldt, so Herr General-Proviantmeister bey sich gehabt, 7 Thlr. 18 Gr. Von der Handt ein gülden verfachen Denckhring. Aber ein Petschafftring von Goldt, daß Wappen in Jaspisstein geschnidten. Ein gestickt Paar Handtschuch. Ein Paar von silberfarb Daffent Hosenbänder mit lang seiden Spitzen“. In Askola, einer Gemeinde in Südfinnland, nördlich der Hafenstadt Porvoo, befindet sich noch heute in der Holzkirche eine reich verzierte barocke Kanzel, die von finnischen Söldnern als Kriegsbeute mitgebracht wurde. Die Beutezüge wurden zum Teil mit Wissen der Offiziere unternommen, denen dafür ein Teil der Beute überlassen werden musste. Besonders wertvolle Stücke nahmen die Kommandierenden (oder auch die Marketender) den oft verschuldeten Soldaten gegen einen Bruchteil des Wertes ab. Auch Offiziersfrauen handelten mit Beute oder trieben damit Tauschhandel. Vgl. die Schadensliste vom März 1634 bei BARNEKAMP, Sie hausen uebell, S. 58ff.; HERRMANN, Aus tiefer Not, S. 32ff.; REDLICH, De Praeda; ZIEGLER, Beute; KAISER, „ … aber ich muß erst Beute machen“. Der Superintendent Braun (1589-1651), zit. bei ROTH, Oberfranken, S. 303f.: „Die Ursache dieses Übels wird jeder leicht verstehen, wenn er die völlig aufgelöste Disziplin der Armee näher bedenkt. Die Fürsten selber und die Heerführer bringen ihr Militär ohne Geld zusammen; das muß von schnödem Raub sich selbst erhalten. Sie öffnen ihnen damit die Tür zu aller Nichtswürdigkeit und Grausamkeit, und müssen zu allen abscheulichen Freveln die Augen zudrücken. Pünktlich bezahlte Löhnung erhält den Soldaten, auch den sehr unguten, durch die Furcht vor dem Kriegsrecht bei seiner Pflicht und hindert ihn an Übergriffen. Enthält man ihm hingegen die Löhnung vor, so verwildert er und ist zu jeder Schandtat bereit. Dazu kommt die schon erwähnte Lässigkeit der Führer beim Anwerben der Soldaten. Denen liegt ja an der reinen Lehre und an der Gottesfurcht gar nichts; sondern die blinde Beutegier treibt sie zum Kriegsdienst; dadurch geht alles zu grunde. Wird eine Stadt oder eine Festung eingenommen, so schenkt der Sieger den Mannschaften der Besatzung, wenn sie auch noch so sehr dem päpstlichen Aberglauben ergeben sind, ihr Leben und reiht die Feinde in seine Truppen ein, nicht ohne gewaltigen Schaden der evangelischen Verbündeten. Denn um ihre Niederlage gründlich zu rächen, speien diese Scheusäler unter dem Deckmantel der militärischen Freiheit alles Gift ihrer Seele aus gegen die Bekenner des evangelischen Glaubens und wüten auf alle Weise in unsäglicher Grausamkeit, Raub und Wegelagerei, zünden die Dörfer an, plündern die Häuser, zwingen die Bewohner mit Schlägen, zu tun, was sie verlangen und stehen in keiner Weise auch hinter den grimmigsten Feinden zurück. Wie viel unserer Sache durch den Zuwachs dieser ehrlosen Räuber gedient ist, sieht jedermann leicht ein“.
Bei der Plünderung Magdeburgs hatten die Söldner 10 % des Nominalwertes auf Schmuck und Silbergeschirr erhalten; KOHL, Die Belagerung, Eroberung und Zerstörung, S. 82. Profitiert hatten nur die Regimentskommandeure bzw. die Stabsmarketender. WÜRDIG; HEESE, Dessauer Chronik, S. 222: „Wie demoralisierend der Krieg auch auf die Landeskinder wirkte, ergibt sich aus einem fürstlichen Erlaß mit Datum Dessau, 6. März 1637, in dem es heißt: ‚Nachdem die Erfahrung ergeben hat, daß viele eigennützige Leute den Soldaten Pferde, Vieh, Kupfer und anderes Hausgerät für ein Spottgeld abkaufen, dadurch die Soldaten ohne Not ins Land ziehen und zur Verübung weiterer Plünderungen und Brandstiftungen auf den Dörfern, zum mindesten aber zur Schädigung der Felder Anlaß geben; sie auch oft zu ihrem eigenen Schaden die erkauften Sachen wieder hergeben müssen und dadurch das ganze Land dem Verderben ausgesetzt wird, befehlen wir (die Fürsten) hierdurch allen unseren Beamten und obrigkeitlichen Stellen, daß sie allen Einwohnern und Untertanen alles Ernstes auferlegen, Pferde, Vieh und sonstige Dinge von den Soldaten nicht zu kaufen“ ’. Gehandelt wurde mit allem, was nur einigermaßen verkäuflich war. Erbeutete Waffen wurden zu Spottpreisen an Städte und Privatleute verkauft; SEMLER, Tagebücher, S. 27f. Der Überlinger Pflummern berichtet in seinem Tagebuch unter dem 4.5.1635; SEMLER, Tagebücher, S. 199: „Vmb dise zeitt daß rauben, stehlen vnd plündern auff dem landt, sonderlich vmb die statt Veberlingen daß tägliche handwerckh geweßt, dan nirgendts ein remedium, kein zucht noch kriegsdisciplin, vnd hatt obrist von Ossa zu Lindaw selbst denen, so vmb abstellung diser straßenraubereyen bei ihme angehalten (der jedoch auf dieses landts defension vom kayßer patenten empfangen) sollche abzustellen nicht möglich, dan wie er discurrirt, müeße der kayßer knecht haben, die knecht müeßen geessen haben, müeßen auch wol gemundirt seyn, vnd müeßen noch darzu fir andere ihr notturfft ein stuckh gellt im peüttel haben, ergo sollen vnd mögen sie stehlen, rauben vnd plündern, waß vnd wa sie finden“.
[60] Offenburg [Ortenaukr.]; HHSD VI, S. 607ff.
[61] General(feld)wachtmeister: Bei den hohen Offizierschargen gab es in der Rangfolge „Generalissimus“, „Generalleutnant“, „Feldmarschall“, „Generalfeldzeugmeister“, auch den „General(feld)wachtmeister“, den untersten Generalsrang im ligistischen Heer („Generalmajor“ bei den Schweden). In der Regel wurden Obristen wegen ihrer Verdienste, ihrer finanziellen Möglichkeiten und verwandtschaftlichen und sonstigen Beziehungen zu Generalwachtmeistern befördert, was natürlich auch zusätzliche Einnahmen verschaffte. Der Generalwachtmeister übte nicht nur militärische Funktionen aus, sondern war je nach Gewandtheit auch in diplomatischen Aufträgen tätig. Der Generalfeldwachtmeister entsprach rangmäßig dem Generalmajor. Der Generalmajor nahm die Aufgaben eines Generalwachtmeisters in der kaiserlichen oder bayerischen Armee war. Er stand rangmäßig bei den Schweden zwischen dem Obristen und dem General der Kavallerie, bei den Kaiserlichen zwischen dem Obristen und dem Feldmarschallleutnant. Die Bezeichnung ergab sich aus seiner ursprünglichen Aufgabe, der Inspektion der Feldwachen und dem Überwachen der Aufstellung der Brigaden und Regimenter im Felde und beim Marsch.
[62] Caspar Freiherr v. Schnetter [Schmetter, Schnitter, Schneder] [ -Oktober ? 1644], kaiserlicher Generalfeldwachtmeister.
[63] Heinrich Christoph Gayling [Gehling, Geiling] v. Altheim [1604-20.12.1654], kurbayerischer General.
[64] Georg Druckmüller [Truckmüller, Truckmiller] v. Mühlburg, Freiherr zu Prunn, Herr zu Roggenstein [ -27.4.1659], kurbayerischer Feldmarschallleutnant.
[65] Hans Heinrich IX. Freiherr v. Reinach [22.8.1589-4.8.1645], kaiserlicher Feldzeugmeister.
[66] Oberkirch [Ortenaukr.]; HHSD VI, S. 587f.
[67] Kniebis [LK Freudenstadt]; HHSD VI, S. 412.
[68] Kartaune, halbe: langläufiges Geschütz mit großer Reichweite, Rohrlänge 22-faches Kaliber (15 cm), schoß 24 Pfund Eisen. Das Rohrgewicht betrug 40-45 Zentner, das Gesamtgewicht 70-74 Zentner. Als Vorspann wurden 20-25 Pferde benötigt. ENGERISSER, Von Nördlingen, S. 579. Das Material und der Feuerwerker-Lohn für den Abschuss einer einzigen 24-pfündigen Eisenkugel aus den „Halben Kartaunen“ kostete fünf Reichstaler – mehr als die monatliche Besoldung eines Fußsoldaten“. EICKHOFF; SCHOPPER, 1636, S. 81.
[69] Böller: kleiner Mörser; GRIMM; GRIMM, DWB Bd. 2, Sp. 233: „boler, doch heute im sinne von mörser, aus dem feuerkugeln geworfen werden, auch kleiner kanonen. Man schreibt auch pöller“.
[70] Falkone: vergleichbar mit der halben Schlange, hatte ein 30faches Kaliber und daher auch ein leichteres Rohr von ca. 14-20 Zentnern und ein Gesamtgewicht von 22-30 Zentnern. Als Vorspann benötigte man 6-8 Pferde.
[71] Falkonett: leichtes Feldgeschütz, das von einem Pferd gezogen werden konnte. Das Falkonett verschoss 3-pfündige Eisengeschosse bei einem Kaliber von 7, 2 cm. Es wurde bevorzugt gegen lebende Ziele eingesetzt.
[72] Cornet: Fahne der kleinsten Einheit der Reiterei: „bei den soldaten ist das cornet dasjenige zeichen, so die helden bei frewd und mut erhaltet, darnach sie alle sehen, und wo dieses verloren, so ist herz und mut und die ganze compagni, das ganze regiment, das feld verloren. Philand. 2, 327“ [DWB].
[73] Fahne: Fahne einer Kompanie; metonymisch die ganze Kompanie. Als Feldzeichen war die Fahne zur Unterscheidung von Freund und Feind unverzichtbar, da es im Dreißigjährigen Krieg kaum einheitliche Uniformen gab. Sieg und Niederlage wurden nach der Zahl der eroberten und verlorenen Fahnen ermittelt. Die Fahne wurde geradezu kultisch verehrt, Soldaten legten ihren Eid auf die Fahne, nicht auf den Kriegsherrn ab. BRNARDÍC, Imperial Armies 1, S. 38ff.
[74] Leibregiment: Als Leibregiment wurde im 17.Jahrhundert im Heiligen Römischen Reich, in Dänemark und in Schweden diejenigen Regimenter bezeichnet, deren Inhaber der regierende Landesherr war. Ihm standen zudem die sich daraus im Rahmen der Regiments- bzw. Kompaniewirtschaft ergebenden Einnahmen zu. Ein Leibregiment hatte daher eine grundsätzlich andere Funktion als die Leibkompanie eines Obristen.
[75] Johann [Jan] Seneschal [„Schönschal“] [ – ], kaiserlicher Obristleutnant, Obrist.
[76] N Meusel [ -9.8.1638 bei Wittenweier], kaiserlicher Obrist.
[77] Moritz v. Haxthausen [ –9.8.1638 bei Wittenweier], kaiserlicher Obrist.
[78] Gottfried v. Salis [Sales] [ -9.8.1638 bei Wittenweier], kaiserlicher Obristleutnant.
[79] Johann Thomas [Giovanni Tommaso] Freiherr v. Brisigello [Brisighell, Brisigell, Brüsegell, Brüßigäll, Bleisiegel, Presigiel, Prisingell] [ca. 1600-1652], kaiserlicher Obrist.
[80] Stephan v. Alber [Albrecht, Albers] [ -9.8.1638 bei Wittenweier], ligistischer Obrist.
[81] [Johann] Ferdinand Freiherr von Puech [du Puich (Puck), du Puis, Pucher, Pais; Obrist [zwischen 1610 und 1612-19.11.1685], kurbayerischer Obrist.
[82] Ferdinand v. Oepp [Opp, Oeppe, Oep] [ -Juni 1637], ligistischer, dann kaiserlicher Obrist.
[83] Carl Freiherr v. Limbach [Limpach] [ – 9.8.1638 bei Wittenweier gefallen], kaiserlicher Obrist.
[84] Hans Jakob v. Edelstetten [Edlinstetten, Edlinstett] [ -23.2.1647 Memmingen], kurbayerischer Obrist.
[85] Obristwachtmeister: Der Obristwachtmeister mit einem monatlichen Sold von 50 fl. entsprach vom Rang her dem Major in der schwedischen Armee. Er sorgte für die Ausführung der Anordnungen und Befehle des Obristen und Obristleutnants. Im Frieden leitete er die Ausbildung der Soldaten und war verantwortlich für die Regimentsverwaltung. Im Krieg sorgte er für Ordnung auf dem Marsch und im Lager, beaufsichtigte die Wach- und Patrouillendienste und stellte die Regimenter in Schlachtordnung. Zudem hatte er den Vorsitz im Kriegs- und Standgericht.
[86] Rittmeister (Capitaine de Cavallerie): Oberbefehlshaber eines Kornetts (später Esquadron) der Kavallerie. Sein Rang entspricht dem eines Hauptmannes der Infanterie (vgl. Hauptmann). Wie dieser war er verantwortlich für Werbung und Soldzahlung, für Disziplin, Ausrüstung und Verpflegung sowie für die Ernennung der untergebenen Führer. Oft war er in erster Linie für die materielle Versorgung der Truppe zuständig, und die eigentlich militärischen Aufgaben wurden von seinem Stellvertreter, dem Leutnant, übernommen. Bei den kaiserlichen Truppen standen unter ihm Leutnant, Kornett, Wachtmeister, 2 oder 3 Korporale, 1 Fourier oder Quartiermeister, 1 Musterschreiber, 1 Feldscherer, 2 Trompeter, 1 Schmied, 1 Plattner. Bei den schwedischen Truppen fehlten dagegen Sattler und Plattner, bei den Nationalschweden gab es statt Sattler und Plattner 1 Feldkaplan und 1 Profos, was zeigt, dass man sich um das Seelenheil als auch die Marsch- und Lagerdisziplin zu kümmern gedachte. Zudem wurde der Rittmeister, der in einer Kompanie Kürassiere 150 fl. Monatssold beanspruchte, bei seiner Bestallung in der Regel durch den Obristen mit Werbe- und Laufgeld zur Errichtung neuer Kompanien ausgestattet. Junge Adlige traten oft als Rittmeister in die Armee ein.
[87] Kapitän (schwed. Kapten): Der Hauptmann war ein vom Obristen eingesetzter Oberbefehlshaber eines Fähnleins der Infanterie, das er meist unter Androhung einer Geldstrafe auf eigene Kosten geworben und ausgerüstet hatte. Der Hauptmann warb daher Fähnriche, Kornetts und Unteroffiziere an, die Söldner mitbrachten. Adlige Hauptleute oder Rittmeister brachten zudem Eigenleute von ihren Besitzungen mit. In der Kompanie-Stärke wurden sogenannte „Passevolants“ mitgerechnet, nichtexistente Söldner, deren Sold ihm zustand, wenn er Deserteure und verstorbene Soldaten ersetzen musste. Der monatliche Sold eines Hauptmanns betrug 160 fl. (Nach der Umbenennung des Fähnleins in Kompanie wurde er als Kapitän bezeichnet.) Der Hauptmann war verantwortlich für Werbung und Soldzahlung, für Disziplin, Ausrüstung und Verpflegung sowie für die Ernennung der untergebenen Führer. Er musste die standesgemäße Heirat seiner Untergebenen bewilligen. Oft war er in erster Linie für die materielle Versorgung der Truppe zuständig, und die eigentlich militärischen Aufgaben wurden von seinem Stellvertreter, dem Kapitänleutnant, übernommen. Der Hauptmann marschierte an der Spitze des Fähnleins, im Zug abwechselnd an der Spitze bzw. am Ende. Bei Eilmärschen hatte er zusammen mit einem Leutnant am Ende zu marschieren, um die Soldaten nachzutreiben und auch Desertionen zu verhindern. Er kontrollierte auch die Feldscher und die Feldapotheke. Er besaß Rechenschafts- und Meldepflicht gegenüber dem Obristen, dem Obristleutnant und dem Major. Dem Hauptmann der Infanterie entsprach der Rittmeister der Kavallerie. Junge Adlige traten oft als Hauptleute in die Armee ein.
[88] Leutnant: Der Leutnant war der Stellvertreter eines Befehlshabers, insbesondere des Rittmeisters oder des Hauptmanns. Wenn auch nicht ohne Mitwissen des Hauptmannes oder Rittmeisters, hatte der Leutnant den unmittelbarsten Kontakt zur Kompanie. Er verdiente je nach Truppengattung monatlich 35-60 fl.
[89] Kornett: Ein Kornett war die kleinste Einheit der Reiterei mit eigenen Feldzeichen, entspricht der Kompanie; 1 berittene Kompanie hatte in der kursächsischen Armee ca. 125 Pferde, 1 schwedische Reiterkompanie umfasste in der Regel 80 Mann. Der Kornett erhielt ca. 50 fl. Monatssold. => Fähnrich; Fahne.
[90] Fähnrich: Rangunterster der Oberoffiziere der Infanterie und Dragoner, der selbst bereits einige Knechte zum Musterplatz mitbrachte. Dem Fähnrich war die Fahne der Kompanie anvertraut, die er erst im Tod aus den Händen geben durfte. Der Fähnrich hatte die Pflicht, beim Eintreffen von Generalspersonen die Fahne fliegen zu lassen. Ihm oblagen zudem die Inspektion der Kompanie (des Fähnleins) und die Betreuung der Kranken. Der Fähnrich konnte stellvertretend für Hauptmann und Leutnant als Kommandeur der Kompanie fungieren. Bei der Kavallerie wurde er Kornett genannt. Vgl. BLAU, Die deutschen Landsknechte, S. 45f.
[91] N Vivario [ -9.8.1638 bei Wittenweier gefallen] kaiserlicher Obristwachtmeister.
[92] Quartiermeister: Bei Einquartierungen in Dörfern und Städten besorgte der Quartiermeister, in Abstimmung mit den lokalen Obrigkeiten, von den Bewohnern Unterkunft und Verpflegung für die Kompanie. Zunächst wurde der Stab einlogiert, dann wurden die Quartiere für die Hauptleute bestimmt. Die Kompanie des Obristen hatte die weitere Wahl, dann die des Obristleutnants, darauf die des Obristwachtmeisters. Die restlichen Kompanien spielten die übrig gebliebenen Quartiere unter sich aus. Das führte bei engen Quartieren teils zur Überbelegung bei den einzelnen „Wirten“, teils zum Kampieren unter freiem Himmel auf dem Markt, was zu Unruhen führen konnte. Dem Quartiermeister, der je nach Truppengattung zwischen 40 und 60 fl. Monatssold erhielt, war die Kriegskasse anvertraut. Dazu kamen allerdings erhebliche Nebeneinkünfte der meist korrupten Quartiermeister, die dieser mit dem Obristquartiermeister teilte.
[93] N Weyerheim [ -9.8.1638 bei Wittenweier gefallen], schwedischer Major.
[94] N Vitzthum v. Eckstädt [ – ], weimarischer Hauptmann.
[95] Philipp Eustachius Freiherr v. u. zu Hattstein [Hatstein, Hatzstein, Hedtstein] [ -3.8.1644], weimarischer Obrist.
[96] Knecht, gemeiner: dienstgradloser einfacher Soldat. Er hatte 1630 monatlich Anspruch auf 6 fl. 40 kr. Ein Bauernknecht im bayerischen Raum wurde mit etwa 12 fl. pro Jahr (bei Arbeitskräftemangel, etwa 1645, wurden auch 18 bis 24 fl. verlangt) entlohnt. Doch schon 1625 wurde festgehalten; NEUWÖHNER, Im Zeichen des Mars, S. 92: „Ihme folgete der obrist Blanckhardt, welcher mit seinem gantzen regiment von 3000 fueßknechte sechß wochen lang still gelegen, da dann die stath demselben reichlich besolden muste, wovon aber der gemeine knecht nicht einen pfennig bekommen hatt“. In einem Bericht des Obristleutnants des Regiments Kaspar von Hohenems (25.8.1632) heißt es; SCHENNACH, Tiroler Landesverteidigung, S. 336: „daß sie knecht gleichsam gannz nackhent und ploß auf die wachten ziehen und mit dem schlechten commißbroth vorlieb nemmen müessen, und sonderlichen bey dieser kelte, so dieser orten erscheint, da mich, als ich an ainem morgen die wachten und posti visitiert, in meinem mantl und guetem klaidt geforn hat, geschweigen die armen knecht, so übel beklaidt, die ganze nacht auf den wachten verpleiben müessen. So haben sie auch gar kain gelt, das sie nur ain warme suppen kauffen khönnen, müessen also, wegen mangl der klaiser und gelt, mit gwalt verschmachten und erkhranken, es sollte ainen harten stain erbarmen, daß die Graf hohenembsische Regiment gleich von anfang und biß dato so übel, und gleichsam die armen knecht erger alß die hundt gehalten werden. Es were gleich so guet, man käme und thete die armen knecht […] mit messern die gurgel abschneiden, alß das man sie also lenger abmatten und gleichsam minder als einen hundt achten thuett“. => Verpflegung.
[97] Walstatt: ursprünglich „von Leichen bedecktes Schlachtfeld‘ oder überhaupt ‚Ort, wo gekämpft worden ist‘; Schlachtfeld, Kampfplatz.
[98] Carl Didriksson [Karl Dirichson] Ruuth [Rat, Ratt, Rutt, Rutten, Rust, Rueth, Rhut, Rut, Roth, Rotten] [24.6.1592 Hornhatt – 3.2.1656 Elbing], finnischer Obrist.
[99] John Forbus [um 1600- ], weimarischer Obrist ?
[100] Hans Georg v. Rotenhan [1595-1638 Strassburg], weimarischer Obrist.
[101] Johann Ludwig Wild- u. Rheingraf v. Salm-Kyrburg [1611- 24.5.1641 bei Quedlinburg gefallen], weimarischer Obristleutnant, nach Bernhards v. Weimar Tod unter Taupadel. Vgl. http://www.portraitindex.de/documents/obj/34800079.
[102] Friedrich Wolfgang v. Fleck[h]enstein [ -15.6.1674], französischer Generalmajor.
[103] Johann v. Rosen, genannt der „Lahme“ [ -15.12.1650], schwedisch-französischer Obristleutnant, Obrist.
[104] N Prestin [ – ], weimarischer Major.
[105] Vivers: Lebensmittel.
[106] Te Deum laudamus: Ambrosianische Lobgesang, an Festtagen zum Schluss der Matutin gesungen, in Luthers Fassung „Herr Gott, Dich loben wir“.
[107] plantiert: aufgepflanzt.
[108] Relation oder gründliche Erzehlung / Wie die Ernstliche Feldt=Schlacht / so den 30 Julii Alten Calenders / dieses 1638 Jahrs / nahend dem Dorff Wittenweyher in dem Preißgaw am Rheinstrom / vorgegangen / sich Erstlich zugetragen / vnd endlich nach Gottes Willen geendet. Gedruckt im Jahr 1638 [Stadtbibliothek Ulm 1880].
[109] Straßburg [Strasbourg, Dép. Bas-Rhin; Frankreich].
Veröffentlicht unter Miniaturen
|
Verschlagwortet mit R
|
Glymes [Grimberghe, Grimberg, Grimberger, Grimperger], Godefroid de, Comte de Grimberghe; Obrist [ca. 1580-1635 ?] Glymes stand als Obrist[1] in kaiserlichen Diensten und tauchte 1633 in der Grafschaft Diez[2] auf.
„Zu allem Überfluß kamen zur gleichen Zeit noch einige Fälle von Plünderungen spanischer Truppen hinzu, die aus dem kölnischen Gebiet heraus das Land unsicher machten. So überfielen am 11. Juni 1633 spanische Soldaten den Ort Hirschberg[3] und nahmen den Einwohnern die Lebensmittel ab. Wenn sich Naurath[4] auch sofort an den Kurfürsten von Köln[5] mit einer Beschwerde wegen dieses Vorgehens gewandt und um Rückgabe des geraubten Gutes gebeten hatte, blieb seine Klage zunächst doch ohne Erfolg, da der Oberst Grimberger, der Führer dieser Truppen, bereits nach Andernach[6] weitergerückt war und nun von hier aus seine Raubzüge fortsetzte. So erfolgte schon am 26. Juni ein weiterer Überfall auf die Orte Gückingen[7] und Heistenbach.[8] Hier aber setzten sich die Bauern zur Wehr[9] und nahmen drei der Raubgesellen gefangen, die sie dann im Diezer Schloß ablieferten, wo sie Naurath in den Turm werfen ließ. Dieses entschlossene Vorgehen erzürnte jedoch Grimberger derart, daß er Naurath drohte, Diez zu überfallen und ihn bei Nacht aus dem Bett holen zu lassen, wenn er nicht sofort die Gefangenen auf freien Fuß setzen würde. Es blieb also dem geplagten Mann kaum etwas anderes übrig, als dem Ansinnen Grimbergers zu entsprechen und die Gefangenen freizugeben.
Da auch für die Zukunft nach dem bisherigen Vorgehen der Grimbergerschen mit weiteren Überfällen gerechnet werden mußte, setzte Naurath den Ausschuß in Alarmbereitschaft und wandte sich zugleich in einem beweglichen Schreiben an den Grafen Ludwig Heinrich von Nassau-Dillenburg,[10] in dem er schrieb: ‚Inmittels sitzen wir hier ohne Hülff in großer Lebensgefahr, denn Grimberger sehr auff uns verbittert, daß, wo unß Gott nicht beystehett, es umb uns gethan sein würde‘. – Auf Nauraths dringende Vorstellungen hatte dann endlich auch der Kurfürst von Köln einzugreifen versucht und am 26. August 1633 dem Obersten Grimberger jede weitere Bedrückung der Diezer Lande untersagt. Dieser aber kehrte sich in keiner Weise an den Befehl, sondern setzte seine Raubzüge ungehindert fort. Wir entnehmen dies einem Schreiben, daß Naurath unterm 22. August 1633 dem kurtrierischen Keller[11] zu Montabaur[12] übersandte und in dem er diesem mitteilt, daß das Dorf Gückingen nunmehr schon zum zweitenmal überfallen worden und die Rotte Plünderer[13] aus dem Amt Montabaur gekommen sei. Sie hätten ‚ettliche hunde bey sich gehabt undt den armen Dietzischen Underthanen zu Gückingen all ihr Rindt-, Schaff- und Schweineviehe im Felde mit den Hirten hinweg getrieben‘. Da ‚dieses Unwesens aus oder durch daß Ampt Montabaur täglich fast‘ geschehe, sähen sich nunmehr die bedrängten Dorfbewohner gezwungen, zur Selbsthilfe zu greifen, wie dies bereits bei dem zweiten Einfall der Grimbergerschen geschehen war. Die so getroffenen Abwehrmaßnahmen machten sich bald bemerkbar, wie aus einem Schreiben Nauraths an seinen Schwager Sohn am 18./28. Juli 1633 hervorgeht. Dort schreibt er u. a.: ‚Seithero wir wiederumb einen Nachtlermen gehapt, es waren Trouppen nach Niederneisen[14] gefallen, hatten die gantze herde Schaf weg getrieben, die Nachbarn schlugen alle Glocken undt ihre Mannschaften jagten denen nach undt fielen etliche Schüss‘, das man es alles hier hören konntte undt in der Nacht etlich Doppelhacken[15] lössten, das die Räuber besorgt, sie würden abgeschnitten, undt sich darvon gemacht‘.
Alle diese kleinen Plackereien beanspruchten den Diezer Amtmann über Gebühr. Es war ihm kaum möglich, seinen dringendsten Amtsgeschäften nachzukommen, was sich besonders störend auf die Wahrung der nassau-diezischen Belange bei den Entschädigungsverhandlungen im schwedischen Hauptquartier zu Frankfurt[16] bemerkbar machte. So schreibt er im August 1633 an seinen bereits dort weilenden Schwager Sprenger: ‚Ich habe noch nicht so viel Zeitt vor stündtlichem Anlauf undt unaufhaltlich andern Geschefften haben können, das mein Bewußt vor zu Papir bringen mögen, laborir noch daran, undt soll, gönts Gott, balt folgen‘. – Im gleichen Schreiben teilt er ferner seinem Schwager mit, daß er zuverlässsige Meldungen aus Koblenz[17] und Andernach erhalten habe, daß Grimberger nach Köln[18] zurückgerufen und ihm ein anderer Bezirk ‚in die Nase gelegt‘ worden sei“.[19]
„Jedem Localcommandanten war indessen wohl anzurathen, wachsam zu sein und sich vor plötzlichen Überfällen zu sichern, denn unerwartet sprengten Katholische Commando’s herbei, um die Sorglosen zu überraschen und sie in Gewahrsam zu nehmen. So war von des Grafen Ludwig Heinrich Regiment zu Roß unter dem Grafen Wilhelm dem Jüngeren von Solms-Greifenstein[20] zur Vertheidigung des Westerwaldes nach Mengerskirchen[21] verlegt. Der junge Graf war indessen zu sicher geworden und hatte vergessen, bei der Nähe der Kaiserlichen seine Feldposten auszusetzen und seine Patrouillen gehörig umhergehen zu lassen. Am 1. Oktober [1633; BW], Morgens vor Tages Anbruch, sieht man von Soldaten, in denen man alsbald Kaiserliche erkannte, Leitern aus den vor Mengerskirchen stehenden Scheunen holen, die auch sogleich zum Stürmen an die Mauern angesetzt werden. Jetzt werden die Sorglosen unsanft aus ihrem Schlummer erweckt. Graf Wilhelm ließ nun zwar die Thore fest zuhalten und seine Reiter aufsitzen. Aber die Kaiserlichen Soldaten erstiegen unter Anführung eines Hadamarischen[22] Einwohners die Stadtmauern und alsbald wurden die Thore von dem Obristen Grimberger aufgesprengt. Nun drang derselbe mit seinen Soldaten zu Roß und zu Fuß in den Flecken, in welchem sich Graf Wilhelm zwar tapfer wehrte, aber sich doch nach Verlust von 4 Mann mit 70 Reitern und allen Dienstpferden ergeben musste, da bereits alle Ausgänge von den Kaiserlichen besetzt waren, Die Gefangenen wurden nach Andernach abgeführt. Graf Wilhelm hatte auf diese Weise seine ersten Sporen schlecht verdient. Er wurde zwar bald mit seiner Compagnie[23] wieder ausgelöst, aber dem Grafen Ludwig Heinrich war es jedoch höchst unangenehm, daß sein Regiment[24] gleich Anfangs einen solchen Schaden erlitten hatte. Leider mussten nur die Bewohner der Grafschaft Hadamar die Verrätherei eines ihrer Mitbürger hart büßen. Auch Mengerskirchen hatte bei diesem Überfall viel zu leiden, denn der Flecken wurde von den Kaiserlichen ganz ausgeplündert, dem Landschultheisen Hungrighausen 200 Rthlr. abgenommen und sein sämmtliches Hausgeräthe zerschlagen“.[25]
Der schwedische Hofhistoriograph Bogislaw Philipp von Chemnitz [9.5.1605 Stettin-19.5.1678 Hallsta, Gem. Västerås] berichtet über den Dezember 1633: „Am vnter Rheinstrom gieng dieser zeit her / bis zum ende des jahres / nichts schrifftwürdiges vor / nur das der Obriste Grimberger / so zu Andernach gelegen sich wol gehalten / vnd nicht allein mit parteyen[26] ziemlichen schaden gethan / vnter andern eine Compagni von des Graffen von Nassaw Regiment / vnterm Graffen von Solms / Greiffenstein / im Hadamarischen Lande zu Mengers Kirchen überfallen / auch sambt dem Rittmeister über siebentzig reuter / so dabey todt geblieben / gefänglich nach Andernach geführet; Sondern auch die Königl. Schwedische / welche einen anschlag auf gemeldte Stadt gemachet gehabt / tapfer zurück geschlagen“.[27] Chemnitz [9.5.1605 Stettin-19.5.1678 Hallsta, Gem. Västerås] berichtet weiter über den Dezember 1633: „Von Andernach hatt man nachricht / das daselbst nichts newes gebawet / ausserhalb das die vorige löcher wieder ausgemauret / die eine pforte gegen dem Rhein zu ziemlich schlecht versehen / das forderste wie eine Hammée[28] / das andere wieder durchsichtig / das dritte in der Mauren ein gantz thor / ausserhalb keine brustwehre[29] noch stacket[30] / sondern nur ein weinig erde etwan knies hoch aufgeworffen / auch der ort zum meisten mit viertzig pferden / vnd etwan fünfzig zu besetzt were: Vermeinten also die Königl-Schwedische[31] zu wasser solches zuüberrumpeln. Es hette auch der anschlag / so den fünfften ChristMonats in der nacht / eben da der Commendant / weil der Keyserliche OberCommissarius, vnd Obrister Vellbrück[32] mit weinig dienern aus seinem qvartier Brisach[33] dahin zu gast kommen / vnd bey ihm gewesen / einen guten trunck gethan gehabt / wol angestellet war / seinen effect vnzweifentlich erreichet / wo die Königl. Schwedische nicht zu langsamb gegen den tag / vnd nur zwo stunden ehe angelanget. Dan obzwar der Commendant / Obriste Grimberger / des tags zuvor schreiben empfangen / das von Franckfurt / Mäyntz[35] / vnd andern orten volck in schiffen den Rhein herabkeme / so zu Bacharach[36] ausgestiegen vnd still liegen thete / daher er sich etwas gedancken gemachet / darauff alsbald noch selbigen abend nacher Bonn[37] gesandt / solches avisiret / vnd das man ihm seiner Compagni übrige Soldaten zuschicken möchte / begehret / hatte man es doch zu Bonn nicht glauben wollen / auch er / der Grimberger / diesen abend es so hoch nicht geachtet. Als aber den fünften früh nach vier vhren von oben herab zween bauren vor Andernach wieder angelangt / vnd ihm zeitung gebracht / das gemeldte Soldaten von Bacharach auf NiederLohnstein[38] kommen / vnd also vermuthlich herunter einen anschlag vorhetten / ward er erst recht alert.[39] Setzte in aller eil zween Bürger in einen kleinen nachen / vnd lies Sie eilends auf Bonn fahren: Brachte seine weinig Soldaten / vnd Bürger ins gewehr / befahl das eis vor der Stadt entzwey zuhawen / schickte / weil es wegen des Monscheins sehr helle / einen trompetter[40] das wasser hinauff / mit ordre / das er / so bald Er etwas von volcke merckte / mit der trompetten ein gewis zeichen geben solte; Wie auch geschehen. Immittelst lies Er die inwendige thore verschütten / vnd wol verbollwercken. Als Er nun der Königl-Schwedischen gar spät nach 6 vhren mit des tages anbruch / von weitem gewar worden / hielt Er sich sambt den Soldaten vnd Bürgern gar stille / bis jenne recht angefallen; Da er erst von allen ecken fewr auf Sie geben lassen. Gleichwol giengen die Königl-Schwedische mit solcher tapfferkeit fort / das Sie hetten durchdringen würden / wo Sie vnter die schusgatter[41] etwas gestellet / vnd ihre leitern[42] länger gewesen. Musten also vnverrichteter dinge wieder abweichen: Welches dan mit verlust des Obriste Lieutenant Storchs[43] vom alten Roten Regiment[44] / vnd etlicher andern todten / auch einer ziemlichen anzahl geqvetschter geschehen“.[45]
„Wahrscheinlich durch den ausgewanderten Convent angereizt, faßten die Ligisten[46] den Plan, Hachenburg[47] wegzunehmen. Der ligistische Oberst von Grimberger rückte nämlich am 3. Januar 1634 mit einigen Bönninghausischen[48] Soldaten von Andernach her auf Hachenburg los und forderte die Stadt durch einen Trompeter zur Übergabe auf. Die Besatzung hielt sich vier und zwanzig Stunden Bedenkzeit aus, die ihr auch zugestanden wurden. Diese Zeit benutzten aber die Soldaten, alle Thore zu verschütten und nachdem sie sich in zugehörigen Vertheidigungsstand gesetzt, ließen sie dem Obersten entbieten, er solle nun kommen, indem sie zu seinem Empfange bereit seien. Das hat ‚vielgedachten Obersten heftig erzürnet und ist die Besatzung zum dritten- und viertenmale stark angefallen, aber jedes Mal durch tapfere Gegenwehr abgetrieben worden, also daß sie sich unverrichteter Sache zurückziehen mussten !’ Auf dem Rückwege wurden Altenwied[49] und andere Orte ausgeplündert“.[50]
Die „Relationis Historicæ Semestralis Continuatio“ berichtet unter dem Januar 1634: „AUch sind die Keyerische auß Münster[51] in 2000. starck außgefallen / vnd das Hauß Steinfurt[52] / den Herrn von Bentheimb zuständig / eingenommen. Ingleichem hat vmb diese Zeit der Obriste Grimperger Commendant in Andernach einen Anschlag auf Hachenburg gemacht / so aber nicht glücken wollen: hat also vnverrichteter Dingen / nach dem jhme drey Anfäll abgeschlagen worden / wider abziehen müssen. Dieser Grimperger ist kurtz hernach / nach dem er noch einen vergeblichen Anschlag auff Ruhrort[53] vorgenommen / tods verfahren“.[54]
Um weitere Hinweise unter Bernd.Warlich@gmx.de wird gebeten !
[1] Obrist [schwed. överste, dän. oberst]: I. Regimentskommandeur oder Regimentschef mit legislativer u. exekutiver Gewalt, „Bandenführer unter besonderem Rechtstitel“ (ROECK, Als wollt die Welt, S. 265), der für Bewaffnung u. Bezahlung seiner Soldaten u. deren Disziplin sorgte, mit oberster Rechtsprechung u. Befehlsgewalt über Leben u. Tod. Dieses Vertragsverhältnis mit dem obersten Kriegsherrn wurde nach dem Krieg durch die Verstaatlichung der Armee in ein Dienstverhältnis umgewandelt. Voraussetzungen für die Beförderung waren (zumindest in der kurbayerischen Armee) richtige Religionszugehörigkeit (oder die Konversion), Kompetenz (Anciennität u. Leistung), finanzielle Mittel (die Aufstellung eines Fußregiments verschlang 1631 in der Anlaufphase ca. 135.000 fl.) u. Herkunft bzw. verwandtschaftliche Beziehungen (Protektion). Zum Teil wurden Kriegskommissare wie Johann Christoph Freiherr v. Ruepp zu Bachhausen zu Obristen befördert, ohne vorher im Heer gedient zu haben; Bayerisches Hauptstaatsarchiv München Kurbayern Äußeres Archiv 2398, fol. 577 (Ausfertigung): Ruepp an Maximilian I., Gunzenhausen, 1631 XI 25. Der Obrist ernannte die Offiziere. Als Chef eines Regiments übte er nicht nur das Straf- u. Begnadigungsrecht über seine Regimentsangehörigen aus, sondern er war auch Inhaber einer besonderen Leibkompanie, die ein Kapitänleutnant als sein Stellvertreter führte. Ein Obrist erhielt in der Regel einen Monatssold v. 500-800 fl. je nach Truppengattung, 500 fl. zu Fuß, 600 fl. zu Roß [nach der „Ordnung Wie es mit der verpflegung der Soldaten“ (1630)] in der kurbrandenburgischen Armee 1.000 fl. „Leibesbesoldung“ nebst 400 fl. Tafelgeld u. 400 fl. für Aufwärter. In besetzten Städten (1626) wurden z. T. 920 Rt. erpresst (HEIMATMUSEUM SCHWEDT, Die Uckermark, S. 15). Nach Wallensteins Verpflegungsordnung (1629) standen ihm als Obrist u. Hauptmann der Infanterie 800 Rt. monatlich zu; KRAUSE, Urkunden 1. Bd., S. 460. Daneben bezog er Einkünfte aus der Vergabe v. Offiziersstellen. Weitere Einnahmen kamen aus der Ausstellung v. Heiratsbewilligungen, aus der Beute – hier standen ihm 27 Rt. 39 Albus pro 1.000 Rt. Beute zu; HOFMANN, Peter Melander, S. 156 – u. aus Ranzionsgeldern, Verpflegungsgeldern, Kontributionen, Ausstellung v. Salvagardia-Briefen – die er auch in gedruckter Form gegen entsprechende Gebühr ausstellen ließ, im Schnitt für 5 Rt., – u. auch aus den Summen, die dem jeweiligen Regiment für Instandhaltung u. Beschaffung von Waffen, Bekleidung u. Werbegeldern ausgezahlt wurden. Da der Sold teilweise über die Kommandeure ausbezahlt werden sollten, behielten diese einen Teil für sich selbst oder führten „Blinde“ oder Stellen auf, die aber nicht besetzt waren. Auch ersetzten sie zum Teil den gelieferten Sold durch eine schlechtere Münze. Zudem wurde der Sold unter dem Vorwand, Ausrüstung beschaffen zu müssen – Obristen belieferten ihr Regiment mit Kleidung, Waffen u. Munition – , gekürzt oder die Kontribution unterschlagen. BELLINCKHAUSEN; TEGEDER; KREIENBRINK, der osnabrugischenn handlung, S. 277 (1634) zur schwedischen Garnison: „Am gemelten dingstage sein 2 Soldaten bey mir hergangen bey r[atsherr] Joh[ann] Fischers hause. Der ein sagt zum andern: In 3 Wochen habe ich nur 12 ß [Schilling = 6 Heller = 12 Pfennig; das entsprach insgesamt dem Tageslohn eines Maurers; BW]. Ich wol, das der donner und der blytz inn der statt schlüge, das es bränte und kein hauß stehen bliebe. Muß das nicht Gott erbarmen. Wir burger mußen alle wochen unse contribution zahlen, die obristen nehmmens geldt zu sich, und die gemeinen soldaten mußen hunger leyden“. Zur brandenburgischen Armee heißt es; OELSNITZ, Geschichte, S. 64: „Fälle, daß die Obersten mit ihren Werbegeldern durchgingen, gehörten nicht zu den größten Seltenheiten; auch stimmte bei den Musterungen die Anzahl der anwesenden Mannschaften außerordentlich selten mit den in der Kapitulation bedingten. So sollte das Kehrberg’sche [Carl Joachim v. Karberg; BW] Regiment 1638 auf 600 Mann gebracht werden, es kam aber nie auf 200. Es wurde dem Obersten der Proceß gemacht, derselbe verhaftet und kassirt. Aehnlich machte es der Oberst Rüdiger v. Waldow [Rüdiger [Rötcher] v. Waldow; BW] und es ließen sich noch viele ähnliche Beispiele aufführen“. Vgl. BELLINCKHAUSEN; TEGEDER; KREIENBRINK, der osnabrugischen handlung, S. 277: „Wir burger mußen alle wochen unse contribution zahlen, die obristen nehmmens geldt zu sich, und die gemeinen soldaten mußen hunger leyden“. Der Austausch altgedienter Soldaten durch neugeworbene diente dazu, ausstehende Soldansprüche in die eigene Tasche zu stecken. Zu diesen „Einkünften“ kamen noch die üblichen „Verehrungen“, die mit dem Rang stiegen u. nichts anderes als eine Form von Erpressung darstellten, u. die Zuwendungen für abgeführte oder nicht eingelegte Regimenter („Handsalben“) u. nicht in Anspruch genommene Musterplätze; abzüglich allerdings der monatlichen „schwarzen“ Abgabe, die jeder Regimentskommandeur unter der Hand an den Generalleutnant oder Feldmarschall abzuführen hatte; Praktiken, die die obersten Kriegsherrn durchschauten. Zudem erbte er den Nachlass eines ohne Erben u. Testament verstorbenen Offiziers. Häufig stellte der Obrist das Regiment in Klientelbeziehung zu seinem Oberkommandierenden auf, der seinerseits für diese Aufstellung vom Kriegsherrn das Patent erhalten hatte. Der Obrist war der militärische ‚Unternehmer‘, die eigentlich militärischen Dienste wurden vom Major geführt. Das einträgliche Amt – auch wenn er manchmal „Gläubiger“-Obrist seines Kriegsherrn wurde – führte dazu, dass begüterte Obristen mehrere Regimenter zu errichten versuchten (so verfügte Werth zeitweise sogar über drei Regimenter), was Maximilian I. v. Bayern nur selten zuließ oder die Investition eigener Geldmittel v. seiner Genehmigung abhängig machte. Im April 1634 erging die kaiserliche Verfügung, dass kein Obrist mehr als ein Regiment innehaben dürfe; ALLMAYER-BECK; LESSING, Kaiserliche Kriegsvölker, S. 72. Die Möglichkeiten des Obristenamts führten des Öfteren zu Misshelligkeiten und offenkundigen Spannungen zwischen den Obristen, ihren karrierewilligen Obristleutnanten (die z. T. für minderjährige Regimentsinhaber das Kommando führten; KELLER, Drangsale, S. 388) u. den intertenierten Obristen, die auf Zeit in Wartegeld gehalten wurden u. auf ein neues Kommando warteten. Zumindest im schwedischen Armeekorps war die Nobilitierung mit dem Aufstieg zum Obristen sicher. Zur finanziell bedrängten Situation mancher Obristen vgl. dagegen OMPTEDA, Die von Kronberg, S. 555. Da der Obrist auch militärischer Unternehmer war, war ein Wechsel in die besser bezahlten Dienste des Kaisers oder des Gegners relativ häufig. Der Regimentsinhaber besaß meist noch eine eigene Kompanie, so dass er Obrist u. Hauptmann war. Auf der Hauptmannsstelle ließ er sich durch einen anderen Offizier vertreten. Ein Teil des Hauptmannssoldes floss in seine eigenen Taschen. Dazu beanspruchte er auch die Verpflegung. OELSNITZ, Geschichte, S. 64f.: Der kurbrandenburgische Geheime Rat Adam Graf zu „Schwarzenberg spricht sich in einem eigenhändigen Briefe (22. August 1638) an den Geheimen Rath etc. v. Blumenthal [Joachim Friedrich Freiherr v. Blumenthal; BW] sehr nachtheilig über mehrere Obersten aus und sagt: ‚weil die officierer insgemein zu geitzig sein und zuviel prosperiren wollen, so haben noch auf die heutige stunde sehr viele Soldaten kein qvartier Aber vnter dem schein als ob Sie salvaguardien sein oder aber alte reste einfodern sollen im landt herumb vagiren vnd schaffen ihren Obristen nur etwas in den beutel vnd in die küch, Es gehöret zu solchen dantz mehr als ein paar weißer schue, das man dem General Klitzingk [Hans Kaspar [Caspar] v. Klitzing; BW] die dispositiones vom Gelde und vonn proviant laßen sollte, würde, wan Churt borxtorff [Konrad [Kurt] Alexander Magnus v. Burgsdorff; BW] Pfennigmeister vnd darvber custos wehre der katzen die kehle befohlen sein, wir haben vnd wissen das allbereit 23 Stäbe in Sr. Churf. Drchl. Dienst vnd doch ist kein einsiger ohne der alte Obrister Kracht [Hildebrand [Hillebrandt] v. Kracht; BW] der nit auß vollem halse klaget als ob Man Ihme ungerecht wehre, ob Sie In schaden gerieten, Man sol sie vornemen Insonderheit die, welche 2000 zu lievern versprochen vnd sich nit 300 befinden vndt sol also exempel statuiren – aber wer sol Recht sprechen, die höchste Im kriegsrath sein selber intressirt vnd mit einer suppen begossen“. Ertragreich waren auch Spekulationen mit Grundbesitz oder der Handel mit (gestohlenem) Wein (vgl. BENTELE, Protokolle, S. 195), Holz, Fleisch oder Getreide. Meist führte er auch seine Familie mit sich, so dass bei Einquartierungen wie etwa in Schweinfurt schon einmal drei Häuser „durch- und zusammen gebrochen“ wurden, um Raum zu schaffen; MÜHLICH; HAHN, Chronik 3. Bd., S. 504. Die z. T. für den gesamten Dreißigjährigen Krieg angenommene Anzahl v. rund 1.500 Kriegsunternehmern, von denen ca. 100 bis 300 gleichzeitig agiert hätten, ist nicht haltbar, fast alle Regimentsinhaber waren zugleich auch Kriegs- bzw. Heeresunternehmer. Moritz Heinrich v. Nassau-Hadamar [1626-1679] erhielt 1640 bereits mit 13 Jahren in Anerkennung der Verdienste seines Vaters Johann Ludwig ein Kürassierregiment u. den Sold eines Obristen; Dillenburgische Intelligenz-Nachrichten des Jahres 1779. Dillenburg 1779, Sp. 422. II. Manchmal meint die Bezeichnung „Obrist“ in den Zeugnissen nicht den faktischen militärischen Rang, sondern wird als Synonym für „Befehlshaber“ verwandt. Vgl. KAPSER, Heeresorganisation, S. 101ff.; BOCKHORST, Westfälische Adelige, S. 15ff., REDLICH, German military enterpriser; DAMBOER, Krise; WINKELBAUER, Österreichische Geschichte 1. Bd., S. 413ff.
[2] Diez [Rhein-Lahnkreis], HHSD V, S. 75f.
[3] Hirschberg [Rhein-Lahn-Kreis].
[4] Dr. jur. utr. Martin Naurath [1575-1637], nassau-diezischer Amtmann. Vgl. HECK, Hermann, Der nassau-diezische Amtmann Dr. Martin Naurath, S. 106-119.
[5] Ferdinand v. Bayern, Kurfürst v. Köln [7.10.1577-13.9.1650 Arnsberg]. Vgl. FOERSTER, Kurfürst Ferdinand von Köln. [Abb. A]
[6] Andernach [LK Mayen-Koblenz]; HHSD V, S. 12f
[7] Gückingen [Rhein-Lahn-Kreis].
[8] Heistenbach [Rhein-Lahn-Kreis].
[9] Widerstand, bäuerlicher: SCHMIDT, Der Aischgrund, S. 16 (nach SCHHNIZZER, Chronica): „Am 27. April [7.5.1632; BW] sind drei Soldaten zu Fuss, Brandenburgischen Regiments, unter den Kompanie[n ?; BW] des Obristleutnants Winkler, in Baudenbach begraben worden. Sie wurden von den Kürrnhöchstettern und ihren benachbarten Anhängern im Schlosshof ‚nicht allein jämmerlich geschlagen und übel zerlästert, sondern gänzlich entleibt und tod geschlagen’ “. SCHMIDT, Der Aischgrund, S. 16 (nach SCHHNIZZER, Chronica): „Der schwedische Reiter Matthäus Bücher, der in Baudenbach und Hambühl zur Salva Quardia einquartiert war, ist ‚auf Ausreißen mit andern Reitern’ entleibt, und von den Hirten im Holz tot aufgefunden worden. (Sch.)“. SEMLER, Tagebücher, S. 59: „Vast vmb gleiche zeitt [Ende Juli 1633; BW] sein auch 9 Frantzosen welliche hievor vnder den Schwedischen geritten, von den vnsrigen aber gefangen vnd vnder herrn obrist König sich vnderhallten laßen), von Ravenspurg ausgerißen, vnd alß die nach Schönaw kommen, haben sie den veberlingen vnderthonen daselbst ihre roß vnd anders hinwegg nemmen vnd sich darmit zum feind begeben wollen. Deren aber die bauren maister worden vnd haben selbige gefänglich nach Veberlingen gebracht, von dannen sie in einem schiff herrn obrist König nach Lindaw zugeschickt und nach schleunigem proceß alle neun mit dem strang hingericht worden. Welliche strenge sie mit ihrem selbst (!) maul verschuldt, in deme sie den bauren, so sie gefangen, vnder augen antrowen dörffen, wan sie wider auf freyen fůß gestellt (wie sie ihnen in tam corrupta disciplina militari [in einer solch verdorbenen militärischen Disziplin] die rechnung ohnfehlbar gemacht) daß sie derselben bauren häußern einen rothen haanen aufstöcken wollen. Daran sie aber sancta iustitia [die heilige Justiz] gehindert“. SEMLER, Tagebücher, S. 76 (1633): „Die bauren, so ab dem Land herein salvirt vnd thailß die zaichen an dem leib mitgebracht, haben bericht, dass hin vnd wider vil todte bauren, welliche der feind ermördt vnd hinwiderumb auch nit wenig Schwedische, die auf dem straiff von den bauren erschlagen worden, ligen, vnd in den wälden ettliche ledige roß vmblauffen“. METERANI novi […] 3. Teil, S. 581 (1628): „Zu anfang dieses Jahrs hatten etliche Böhmische Bawren im KönigCrätzer Crayß / vnder des Herren Terzky Iurisdiktion, einē Auffstand erreget / sich auch sehr trutzig vnd halßstarrig so wol gegen wolgedachten jhren Herrn / als auch die Kayserliche Commissarien erzeiget. Derohalben sind etliche Soldaten wider sie geschickt worden solchen auffstand zu stillen / welche 500. Bawren erlegt / vnd viel gefangen gen Prag gebracht haben / deren etliche den 4. May der Gestalt gestrafft worden / daß man jhnen die Naß abgeschnitten / ein Mahlzeichen auff den Rücken gebrent / vnd sie also wider heimgeschickt hat“. GOTTFRIED, ARMA SVEVICA, S. 64 (1630): „Als der König von Stralsund weg zoge / filen etliche Crabaten auß Grypswald / streifften bey Anklam in ein Dorff. Demnach nun ein Schwedischer Capitein / so on Anklam commandirte, von solchem Kundschafft empfieng / schickete er etliche Dragoner vnd Reuter auß / welche die Crabaten / deren bey 60. waren / meistentheils niderhaueten: die übrigen so sich salvirten, wurden hernach von den Bawern auffgesucht vnd erschlagen“. GOTTFRIED, ARMA SVEVICA, S. 64f. (1630): „Vmb selbe Zeit streifften in 300. Schwedische Dragoner / neben 150 Reutern in die VckerMarck biß an Brenßlaw / 6. Meilen von Stättin / trieben auß dreissig Dörffern alles Viehe hinweg. Wie nun hierauff ein Priester zu Melchaw von den Käyserischen vmb Hülff bate / wurden alsbald von 200. so allda in Besatzung lagen / die Helffte auß commandiret, immittels kamen auch bey 400. Bawren durch den Glockenschlag zusammen / da die Schwedischen solches innen wurden / eyleten die Reuter mit dem Vieh nach dem nechsten Holtz / die Dragoner aber versteckten sich im Hinderhalt / vnd wie die Käyserische vnd Bawren ankamen / brachen sie herfür / umbringeten sie / vnd haweten alles nider / was sich zur Wehr stellete / also dass nur vier Mußquetierern in Brenslaw wider kamen / das Viehe aber vnd die übrige Bawren trieben die Schwedische nach Uckermünde“. LATOMUS, Relatio Historicæ Semestralis Continuatio, S. 66f.: „VMb diese Zeit [Januar 1631; BW] hat sich bey dem Dorff Bischoffroda / vngefähr eine Viertelstunde von Eißleben gelegen / nachfolgendes begeben: Es wurde eine zimbliche Anzahl Bawersweiber / darbey auch etliche Manspersonen waren / welche zu Eißleben auff dem Marckt gewesen / von 6. Reuttern angegriffen: Als sie sich nun zur Wehr gestellet / sind zwo Manspersonen von ihnen erschossen worden / dessen aber vngeachtet / wehreten sich die andern hefftig / vnd risse das Weibsvolck die Reuter / weil sie sich verschossen / von den Pferden / richteten sie mit Messern / Parten vnd Prügeln vbel zu / namen ihnen auch die Pferdt / Pistolen / Dägen / Mäntel / also daß vier von den Reutern darvnder ein Edelmann / todt blieben / die andern aber sehr verwundet in das nechst darbey gelegene Holtz gekrochen. Es hat sich eine Fraw also vnder den Reutern hervmb gerissen / vnd vnder ihnen mit einem Messer also gehauset / daß sie außgesehen / als wann sie sich im Blut gewaschen hette / hat doch keinen schaden an ihrem Leib bekommen“. WEECH, Sebastian Bürsters Beschreibung, S. 98 (1636): „Interim begibt sich, daß ettliche Vitzthumbische soldaten oder reuter von den compagnien, so vor Hohentwiel gelegen, ohne verlaubnuß außgerißen, oder auf die beit und raub geridten, der waren uff die 7 oder 8, die hierumben und biß auff Weingarten oder Waldsee alle straßen gar unsicher machten, sonderlich an dem Bodensee hetten ihren ihren uffenthalt mehrern thails zue Mimmenhaußen und Urnow. Unangesehen manß allhie zue Salem ungern gesehen, haben ettliche closterdiener und auch pauren solches in die harr länger nit kenden zuesehen noch gedulden, haben uff sie gespannen, selbe bekomen zue Mimmenhaußen in einer behaußung, hinaußgefüert gegen ainen weyher, schröcklich ermördt und nidergemacht; aber übel übersehen, dan ainer ihnen außgerißen, darvonkomen und entrunnen; darauß dan, wie volgen wird, groß übel ervolgt und erstanden“.
Continuatio VI. Der Historischen Relation (1632), S. 43, zum Mai 1632: „Die Bawren in NiderBeyern samlen sich starck / vnnd wo sie der Schwedischen können mächtig werden / vngeacht das sie vor kurtz verschiener Zeit Ihr Kön. May. gehuldigt haben daß sie trew vnd bestendig bleiben wollen / so schneiden sie doch den Soldaten Nasen und Ohren ab / vnd stechen ihnen die Augen auß / daher die Schwedischen viel Dörffer abbrennen / auch vergifften die Bawren Wein Brodt vnd andere Speisen / so bald I. Kön. Mayest. Soldaten drüber kommen vnd davon essen oder trincken wollen / von stund an vmbfallen vnd sterben“.WEECH, Sebastian Bürsters Beschreibung, S. 134 (1641): „Item in vigilia assumptionis vel Bernardi hat sich begeben, alß 5 oder 6 Zellerische am Undersee, stattlich und wohlmundierte reütter underm obristen und commendanten Rost, zwar nit uff beit zue reuten ihr intent gewesen, in unsern hof zue Bachopten ihr nachtquatier in einem stall zue nähmen begerten, so guotwillig verlaubt, vermainten nur rüebig und, weil sie sich wohl vermacht, sicher zue sein, seyen sie von underschidlichen herrschaften zue Osterach erfahren (weil eß gar viel dieser orten zuovor rauber und roßbeuter abgeben, [81.] deren sie müesten ergelten) sich uffmachten, sie alldort in unserm hof und stall, unwüssend deß hofmaisters diß orts, uberfallen,ainen nach dem anderen herauß uff die müste gezogen, half darfür kain büdten noch quatier, unangesehen solche unschuldig, wie die schwein oder oxen erschlagen und ermordt, (dass dan unß zum großen nachthail, weilß in unserm hof, darbei auch der unsrigen underthonen zwen oder 3 gewe0en, gerathen) ihnen ihr pferd, pistolen und waß sie hatten, verkauft und abgenohmen“. Der Zeitzeuge Hanns Kahn aus Klings/Rhön; LEHMANN, Leben und Sterben, S. 212.: „Man war seines Lebens nicht sicher. Nicht sicher auf Feldern und Straßen, deswegen die Ackerleute immer ihr Gewehr bei sich führten. War daran Mangel, wurden die Sensen an lange Stangen gemacht, die zuvor am hinteren Ende gerade geschmiedet [wurden], daß sie wie Spieße standen. Manche Partei haben wir, gleich ob schwedisch oder kaiserlich, so von unserem Dörflein verscheucht […] Es war eine verderbte Zeit. Jeder trug im Wald das Gewehr, lauerte Soldaten auf, die man totschoss oder abknickte, wenn man einen erwischte. Der Drangsale wegen lag immer das Rohr [Gewehr] versteckt und so wüst es zuvor nur den Bauern [erging], so erging es den Soldaten, so von uns gefangen wurden. Es war fast kein ehrbares Volk mehr auf Erden“. Das „Theatrum Europaeum“ berichtet zum März 1636 über Sachsen, 3. Bd., S. 637: „So haben die Bawren hin vnd wider ex desperatione alles was sie angetroffen / darnieder vnd Todt geschlagen / dann ihnen Freund vnd Feind das Vieh abgenommen / sie darnieder massacrirt / den Feldbaw gesperrt / vnd alle Excessen verübt“. THEATRUM EUROPAEUM 4. Bd., S. 839 (1642) über den bäuerlichen Widerstand im Drömling (1642), einer Niedermoorlandschaft an der Grenze von Niedersachsen u. Sachsen-Anhalt: „Es grentzet mit Chur-Brandenburg bey Garleben / der alten Marck / auch mit dem Lüneburgischen und Magdeburgischen ein Ort im Tremling oder Trommeling genant / mit Gehöltze und Morast umgeben / welchen böse Bauren bewohnen / die hatten von den Schwedischen und andern von Jahren hero viel Schaden erlitten. Als nun General Königsmarck im Eingang Februar. sich daselbsten herum mit 12. Regimentern legte / auff der Käiserl. Anzug Achtung zu geben / so legten sich diese Bauren an ihrem Paß mit Weib und Kindern / und allem ihrem Vermögen / fielen der Soldatesque ein / und thaten ziemlichen Schaden. Es wurde ein Trommelschläger zu ihnen geschicket / ob sie Freunde oder Feynde seyn wollten: Weil sie nun gewust / daß ihnen so leichtlich nicht beyzukommen / schnitten sie ihm Ohren / Nasen / und Finger ab / und schaffeten ihn von sich. Sie hatten sich nahend auff 1500. verstärcket / und schickten auß ihrem Mittel zum Ertzhertzog [Leopold Wilhelm; BW] / mit Bitte ihnen zu vergönnen / daß sie darauff schlagen möchten. Wie nun die Nachricht geloffen / so solle sie Ihre Hochfürstl. Durchl. mit Geld beschencket / und ihnen Officirer mitgegeben haben / ihre Gelegenheit / Ort und Pässe zu recognosciren.
Sie hatten einen Hauptmann unter sich selbsten gemacht / und zu Ihrer Durchl. nach Tangermünd ferners geschicket / der sich erbotten hatte die Schwedischen zu verfolgen / diesen sollen nun Ihre Hochfürstl. Durchl. eine güldene Ketten samt 1000. Ducaten / und einen Beltz mit Sammet überzogen / geben lassen / wie er aber dieses Gnaden-Präsent verdienet habe / ist weiter nicht erfahren worden“. Vgl. auch ZAHN, Der Drömling, S. 2f., ZAHN, Die Altmark, S. 47. SCHNEIDER, Saxonia vetus et magna […], S. 161: „Unweit von hier fähet sich bey der Fornitz der sogenannte Drömling an, welches eine waldige Gegend im Wolfenbüttelischen ist, die sich auf etliche Meilen erstreckt, und sehr verwegene grundlose Bauern zu Bewohnern hat, welche denen Nieder-Lausitzern im Spreu-Walde gantz gleich, und im 30jährigen Religions-Krige viel hundert Soldaten caputiret, ja sich gar nicht gescheuet haben, etliche Regimenter in ihren Feld-Lagern anzugreifen: wie sie denn Anno 1639. denen Käyserischen bey Stendel [Stendal; BW] eingefallen, sie geschlagen, und ihnen 2. Feldstücken nebst andern Geschütze abgenommen: item Anno 1642. zwey starcke Schwedische Regimenter fast gar ruiniret etc. wovon die damahligen Relationen zeugen“. Der schwedische Resident in Zürich, Keller, meldete Grotius am 21.7.1643; GROOT, Briefwisseling Deel 14, S. 418: „In der Alten [Marck] [am 21.6. bei Lüchow; BW] haben sich newlich fast in 1000 bawren zusammen rottirt vnnd dem obrist leutenant Bähren [Hans Beer [Bähr, Behr]; BW] nicht allein den pass verwaigert, sondern auch gahr feindtlicher weise einfallen wollen. Ess hat aber dieser sie also empfangen, dass sie in die 300 todt- vnndt gefangener alss zeugen ihres frevelss, im stich lassen mussen“. Der Pfarrer Aegidius Henning [ca. 1630-1686] hält fest; BUS, Die Zeit der Verheerung, S. 215f. (nach MÜLLER, Aegidius Hennig, S. 96): „So wie die Soldaten den Herren Bauern übel mitspielen, wenn sie ihrer habhaft werden, so legen die Bauern manchen, der zurückbleibt, schlafen. Ich habe des Öfteren gehört, daß sie über den und jenen von ihnen gesagt haben: Er hat manchen schlafen gelegt ! Er hat da und dort einen Reiter niedergeschossen. Was ? Sie rühmen sich selbst ihrer Mord- und Diebestaten, und es tut ihnen leid, daß sie es nicht noch schlimmer machen können“.
[10] Ludwig Heinrich Graf v. Nassau-[Katzenelnbogen]Dillenburg [9.5.1594 Saarbrücken-12.7.1662 Dillenburg], ab 1.12.1631 schwedischer Obrist der Kavallerie. Nach dem Prager Frieden (1635) ab 3.8.1635 als Obrist u. Generalwachtmeister in kaiserlichen Diensten.
[11] Keller: Der Keller, oder auch „Kellner“ (von lat.: cellarius = Kellermeister), war zunächst ein mittelalterlicher Ministerialer, der in einem ihm zugewiesenen Verwaltungsbereich im Auftrag des Lehns- oder Grundherren für die Verwaltung, Gerichtsbarkeit u. Steuern verantwortlich war, insbesondere für die Eintreibung und Verwaltung der Geld- u. Naturalabgaben an den Grundherren. Er hatte damit eine ähnliche Funktion wie der Rentmeister. In der Frühneuzeit wurde dieses Amt zunehmend nicht mehr v. Niederadligen u. Edelfreien, sondern auch v. Bürgerlichen ausgeübt.
[12] Montabaur [LK Westerwaldkreis]; HHSD V, S. 239f.
[13] Plünderung: Trotz der Gebote in den Kriegsartikeln auch neben der Erstürmung v. Festungen u. Städten, die nach dem Sturm für eine gewisse Zeit zur Plünderung freigegeben wurden, als das „legitime“ Recht eines Soldaten betrachtet. Vgl. JANSSEN, Bellum iustum, S. 137: „Sei der Krieg als Mittel zur Erhaltung der Gerechtigkeit unter den Menschen gestattet, so sei auch das Beutemachen in einem gerechten Krieg als ein legitimes Mittel, den Gegner zur Aufgabe zu zwingen oder von der Führung eines ungerechten Krieges abzuschrecken, gerechtfertigt. Daß dem Feind alle Güter, die ihm zur Schädigung der gerechten Sache dienen, entwendet werden dürften, liegt, so Grotius, auf der Hand. Des weiteren gäbe es drei schwerwiegende Gründe, aus denen es gerecht erscheine, die Güter des Feindes in Besitz zu nehmen. 1. Als Ausgleich für die Güter, die der gegner sich entweder vor oder während des Krieges widerrechtlich angeeignet hat; 2. Als Entschädigung für die Kriegskosten, die dem gerecht Kriegführenden entstanden sind; 3. Als abschreckende Strafe für den Übeltäter. Sich den Besitz des ungerechten Feindes aus Habgier anzueignen, sei jedoch nicht zulässig. Der gerechte Krieg rechtfertige nicht die Plünderung des Gegners“. Vgl. die Rechtfertigung der Plünderungen bei dem ehemaligen hessischen Feldprediger, Professor für Ethik in Gießen u. Ulmer Superintendenten Conrad Dieterich, dass „man in einem rechtmässigen Krieg seinem Feind mit rauben vnd plündern Schaden vnd Abbruch / an allen seinen Haab vnd Güttern / liegenden vnd fahrenden / thun könne vnd solle / wie vnd welchere Mittel man jmmermehr nur vermöge. […] Was in Natürlichen / Göttlichen / vnd Weltlichen Rechten zugelassen ist / das kann nicht vnrecht / noch Sünde seyn. Nun ist aber das Rechtmessige Rauben / Beutten vnd Plündern in rechtmessigen Kriegen / in Natürlichen / Göttlichen vnnd Weltlichen Rechten zugelassen“. DIETERICH, D. Konrad Dieterich, S. 6, 19. Vgl. BRAUN, Marktredwitz, S. 37 (1634): „Welcher Teil ehe[r] kam, der plünderte. [Wir] wurden von beiden Teilen für Feind[e] und Rebellen gehalten. Ein Teil plünderte und schalt uns für Rebellen darumb, dass wir lutherisch, der andere Teil, plünderte darumb, dass wir kaiserisch waren. Da wollte nichts helfen – wir sind gut kaiserisch, noch viel weniger beim andern Teil; wir sind gut lutherisch – es war alles vergebens, sondern es ging also: ‚Gebt nur her, was ihr habt, ihr mögt zugehören und glauben wem und was ihr wollt’ “. Dazu kamen noch die vielen Beutezüge durch Marodeure, darunter auch von ihren eigenen Soldaten als solche bezeichnete Offiziere, die durch ihr grausames u. ausbeuterisches Verhalten auffielen, die von ihrem Kriegsherrn geschützt wurden. Vgl. BOCKHORST, Westfälische Adlige, S. 16f.; KROENER, Kriegsgurgeln; STEGER, Jetzt ist die Flucht angangen, S. 32f. bzw. die Abbildungen bei LIEBE, Soldat, Abb. 77, 79, 85, 98; das Patent Ludwigs I. v. Anhalt-Köthen: „Von Gottes gnaden“ (1635). Vgl. den Befehl Banérs vom 30.5.1639; THEATRUM EUROPAEUM 4. Bd., S. 101f. Vielfach wurden die Plünderungen aber auch aus Not verübt, da die Versorgung der Soldaten bereits vor 1630 unter das Existenzminimum gesunken war. KROENER, Soldat oder Soldateska, S. 113; DINGES, Soldatenkörper. II. zum Teil bei Ausschreitungen der Bevölkerung, die sich an den Gütern der Flüchtlinge bereicherte, so z. B. 1629 in Havelberg: „Im Tempel war viel Gut in Kasten und Kisten, wovon die rechtmäßigen Besitzer das Wenigste wiederbekamen. Das meiste wurde den königlichen [Dänen], die während des Brandes darüber hergefallen waren, die Kirche zu plündern, und später den kaiserlichen Soldaten zuteil. Auch einigen Einwohnern und Benachtbarten, die keine Rechte daran hatten. Summa: Ihrer viele wurden arm; etliche mit unrechtem Gut reich“. VELTEN, Kirchliche Aufzeichnungen, S. 76-79, bzw. BRAUN, Marktredwitz, S. 84f., über die auch anderweitig übliche Plünderungsökonomie: „Hingegen ihre Herbergsleute, die sich vor diesem als Tagelöhner bei ihnen erhalten, die haben sich jetzt sehr wohl befunden; denn diese hatten keine Güter, daher gaben sie auch keine Kontribution. Und ein solcher Gesell hat allezeit so viel gestohlen, daß er sich [hat] erhalten können. Wie er ein paar Taler zusammengebracht, hat er gesehen, daß er von den Soldaten eine Kuh [hat] erkaufen können. Oder aber, er hat den Soldaten etwas verraten, do er dann von ihnen eine geschenkt und umsonst bekommen. Do [hat] er dann solche an einen anderen Ort getrieben und soviel daraus erlöst, daß er hernach 3 oder 4 von den Soldaten hat (er)kaufen können. Denn es ward so ein Handel daraus, daß man auch aller christlichen Liebe vergaß; vielweniger fragte man auch mehr nach Ehrbarkeit und Redlichkeit. Wie es dann auch soweit gekommen [ist], daß die Soldaten in einem Dorf das Vieh genommen und hinweg getrieben, und die Bauern als ihre Nach(t)barn in dem nächsten Dorf haben solches Vieh von den Soldaten erkauft und alsbald bei Nacht weiter getrieben und wieder verkauft. Und war schon fast ein allgemeines Gewerbe daraus. Ihrer viel[e] hatten sich auf diesen ehrbaren Handel gelegt, denn wenn ein Soldat eine Kuh gestohlen, wußte er schon seinen gewissen Kaufmann. Und wenn an manchem Ort eine Partei Soldaten mit einer geraubten Herd[e] Vieh ankam, da war bei etlichen gottlosen Menschen ein freudenreiches Zulaufen und Abkaufen, nit anders(t) als wenn zu Amsterdam in Holland eine indianische Flotte anlangte. Ein jeder wollte der nächste sein und die schönste Kuh er(kaufen); ungeachtet der armen Leute, denen das Vieh abgenommen worden, [die] allernächst auf der Seite mit jämmerlichen Gebärden standen und sich wegen der Soldaten nichts (ver)merken lassen durften“. Zum Teil plünderten Nachbarn die Hinterlassenschaft ihrer geflüchteten oder abgebrannten Mitbürger; KRAH, Südthüringen, S. 95: „So berichtete Suhl, daß ‚sich noch etliche volks- und ehrvergessene Leute allhier und anderswo gelüsten lassen, sich an der armen verbrannten Sachen, so nach der Plünderung und Brand in Kellern, Gewölben und sonderlich im Feld und in den Wäldern geflüchtet und übrig geblieben, zu vergreifen und dieblich zu entwenden. Wie dann etliche – auf frischer Tat allzu grob begriffen und darum zu gefänglicher Verhaftung gebracht‘ seien. Auch Benshausen erhielt seine Salvaguardia, um dem täglichen Plündern, nicht nur durch streifende Soldaten zu wehren !“ Auch eigene Einheiten fielen über andere Einheiten her, um sie auszuplündern, wie etwa 1634 in Leipheim; BROY, Leipheim, S. 146f.
[14] Niederneisen [Rhein-Lahn-Kreis].
[15] Doppelhaken: auch Hakenbüchse: Der Haken war ein bis ins 17. Jahrhundert gebräuchliches schweres Feuergewehr, mit einem senkreich nach unten vorstehenden Haken am Schaft, mit dem es auf einem dreibeinigen Gestell befestigt war oder auf die Brüstung aufgelegt wurde, um den enormen Rückstoß abzufangen. Diese Waffen wogen 7,5 bis 10 Kilo, nach anderen Angaben sogar mit bis zu 25 Kilogramm. Damit wurden Ladungen mit je 4 Lot Blei =1/8 Pfd., Doppelhaken bis 400 g, verschossen. Als man diese Hakenbüchsen später auch im offenen Feld verwendete, musste man sie in einer Gabel abstützen. Daher nannte man diese Waffe auch Gabelarkebuse. Die Treffgenauigkeit der Hakenbüchsen war so gering, so dass ihr Einsatz nur auf kurze Distanz oder massiert als Batterie sinnvoll war. Die Haken wurden ihrer Größe nach eingeteilt in Doppelhaken, ganze Haken und halbe Haken. Vgl. die ausführliche Beschreibung unter http://www.engerisser.de/Bewaffnung/Doppelhaken.html. Die Stadt Überlingen kaufte 1633 erbeutete Doppelhaken um kaum 3 fl. auf; SEMLER, Tagebücher, S. 27f.
[16] Frankfurt/M.; HHSD IV, S. 126ff.
[17] Koblenz; HHSD V, S. 178ff.
[18] Köln; HHSD III, S. 403ff.
[19] HECK, Naurath, S. 113f.
[20] Wilhelm II. Graf zu Solms-Greifenstein [9.8.1609 Greifenstein-19.7.1676 Wetzlar], kaiserlicher Rittmeister.
[21] Mengerskirchen [LK Limburg-Weilburg]; HHSD IV, S. 328f.
[22] Hadamar [LK Limburg-Weilburg]; HHSD IV, S. 194f.
[23] Kompanie [schwed. kompani, dän. kompany]: Eine Kompanie zu Fuß (kaiserlich, bayerisch u. schwedisch) umfasste v. der Soll-Stärke her 100 Mann, doch wurden Kranke u. Tote noch 6 Monate in den Listen weiter geführt, so dass ihre Ist-Stärke bei etwa 70-80 Mann lag. Eine Kompanie zu Pferd hatte bei den Bayerischen 200, den Kaiserlichen 60, den Schwedischen 80, manchmal bei 100-150, zum Teil allerdings auch nur ca. 30. Geführt wurde die Fußkompanie v. einem Hauptmann, die berittene Kompanie v. einem Rittmeister. Vgl. TROUPITZ, Kriegs-Kunst. Vgl. auch „Kornett“, „Fähnlein“, „Leibkompanie“. Die Kompanie führten ein Hauptmann, ein Leutnant, ein Fähnrich, ein Feldwebel, ein Sergeant, ein Rüstmeister, ein Musterschreiber, die Korporale u. Rottmeister.
[24] Regiment: Größte Einheit im Heer, aber mit höchst unterschiedlicher Stärke: Für die Aufstellung eines Regiments waren allein für Werbegelder, Laufgelder, den ersten Sold u. die Ausrüstung 1631 bereits ca. 135.000 fl. notwendig. Zum Teil wurden die Kosten dadurch aufgebracht, dass der Obrist Verträge mit Hauptleuten abschloss, die ihrerseits unter Androhung einer Geldstrafe eine bestimmte Anzahl v. Söldnern aufbringen mussten. Die Hauptleute warben daher Fähnriche, Kornetts u. Unteroffiziere an, die Söldner mitbrachten. Adlige Hauptleute oder Rittmeister brachten zudem Eigenleute v. ihren Besitzungen mit. Wegen der z. T. immensen Aufstellungskosten kam es vor, dass Obristen die Teilnahme an den Kämpfen mitten in der Schlacht verweigerten, um ihr Regiment nicht aufs Spiel zu setzen. Der jährliche Unterhalt eines Fußregiments v. 3.000 Mann Soll-Stärke wurde mit 400- 450.000 fl., eines Reiterregiments v. 1.200 Mann mit 260.-300.000 fl. angesetzt. Zu den Soldaufwendungen für die bayerischen Regimenter vgl. GOETZ, Kriegskosten Bayerns, S. 120ff.; KAPSER, Kriegsorganisation, S. 277ff. Ein Regiment zu Fuß umfasste de facto bei den Kaiserlichen zwischen 650 u. 1.100, ein Regiment zu Pferd zwischen 320 u. 440, bei den Schweden ein Regiment zu Fuß zwischen 480 u. 1.000 (offiziell 1.200 Mann), zu Pferd zwischen 400 und 580 Mann, bei den Bayerischen 1 Regiment zu Fuß zwischen 1.250 u. 2.350, 1 Regiment zu Roß zwischen 460 u. 875 Mann. Das Regiment wurde vom Obristen aufgestellt, vom Vorgänger übernommen u. oft v. seinem Obristleutnant geführt. Über die Ist-Stärke eines Regiments lassen sich selten genaue Angaben finden. Das kurbrandenburgische Regiment Carl Joachim v. Karberg [Kerberg] sollte 1638 sollte auf 600 Mann gebracht werden, es kam aber nie auf 200. Karberg wurde der Prozess gemacht, er wurde verhaftet u. kassiert; OELSNITZ, Geschichte, S. 64. Als 1644 der kaiserliche Generalwachtmeister Johann Wilhelm v. Hunolstein die Stärke der in Böhmen stehenden Regimenter feststellen sollte, zählte er 3.950 Mann, die Obristen hatten 6.685 Mann angegeben. REBITSCH, Gallas, S. 211; BOCKHORST, Westfälische Adlige.
[25] KELLER, Drangsale, S. 198.
[26] Streifpartei: I. Streifkorps; Reiterabteilung, die entweder zur Aufklärung oder zu überraschenden Handstreichen vom zuständigen Kommandeur ausgesandt wurde oder eine auf eigene Rechnung oder mit Wissen des an der Beute beteiligten Kommandeurs herumstreifende Abteilung, um Beute zu machen, Nahrung zu beschaffen oder die Bevölkerung zu terrorisieren. Am 9.5.1643 schrieb Ferdinand III. an Gallas: „auch die Streifparteien gehören bestrafft […], da sy die unterthanen unerhörter barbarischer weiß tractirn, denenselben wan sy nit gleich alles nach ihrem willen thuen, löcher durch die nasen bohren, strick dardurch ziehen und sie die [wie ?] unvernünfftigen thiere mit herumben ziehen, theils gar pulver in die nasenlöcher, auch mundt und ohren stecken und dasselbe anzünden, oder aber haisses bley hinein gießen, auch wohl ihre händt und fueß abhacken, ganze dörffer außplendern, und viel pferdt und viech mit weckh treiben“. REBITSCH, Gallas, S. 218f. II. Kriegspartei: reguläre Truppenabteilung. Vgl. KROENER, Kriegsgurgeln. III. Banden aus Deserteuren, Straftätern, vertriebenen Bauern, die z. T. in Stärke von 400 Mann bevorzugt Dörfer überfielen. LEHMANN, Kriegschronik, S. 105, zu einer Strafaktion: „Zue Crandorf hielte Sich auf Johans Lorentz, ein versuchter Churfürstlicher reuter, aber arger Mauser, der uff den Schwedenschlag an der Böhmischen gräntze großen schaden gethan. Den nahm Künemann, ein keyßerlicher Leutenandt und werber von den Platten mit 6 musquetiren des Nachts auß den bette, führeten ihn biß an Breittenbrunner Wiltzaun, schoßen in todt, zogen ihn auß und ließen ihn liegen, der den 25. April in einen Winckel auf den Gottesacker wurd begraben“. Vgl. auch das Edikt der Grafschaft Limburg (1627): „waß maßen vnd vielfeltiger Dagten Vorkommen [ist], dass sich in Vnser[er] Graffschafft Lymburg fast täglichen Partheyen vnd Soldaten vnd auch noch woll herrenloses Gesindling in Büschen, Bergen vnd Strauchen auffhalten, welche nicht allein Vnsern Vnderthanen, sondern auch der benachbarten Neutralen pressen, knebeln, fangen, stechen vnd sonsten übell tractieren […], welches allen Rechten, Erbarkeitt, guter Policey vnd gemeiner Wolfahrt, auch des Heiligen Reiches Landtfrieden vnd anderen Satzungen zuwiederläufft“. MARRA, Tod, S. 140. „Je länger der Krieg dauerte, um so ärger wurde es. Eine Beschwerde der anhaltischen Fürsten vom 22. Januar 1639 an den Kaiser schildert die Zustände im Lande wie folgt: ‚Die meisten Völker haben sich von der Armee abgetan und unser Fürstentum durch und durch gestreift, Dörfer und Städte, derunter Jeßnitz und Raguhn, ausgeplündert, Adlige und andere Standespersonen ermordet und verwundet, Dörfer in Brand gesteckt, teils ohne Not niedergerissen, Bauernkinder geschlachtet, den Weibern die Brüste abgeschnitten und gegessen, dazu das Land dermaßen verderbt, daß fast niemand sich auf dem Lande aufhalten und das Feld bestellen, noch die Reichsanlage abführen kann“. WÜRDIG; HEESE, Dessauer Chronik, S. 222. Im Juni 1647 ordnete der Kommandant v. Lippstadt, Rollin de St. André, an, dass alle herumstreifenden Soldaten ohne Ausweispapiere zu erschießen seien. CONRAD; TESKE, Sterbzeiten, S. 51. Vgl. THEATRUM EUROPAEUM 4. Bd., S. 617 (1641): „Vmb den Eingang Junii liesse sich ein Brandenburgischer Rittmeister gelüsten in Mechelnburg wider voriges Verbott zustreiffen / der auch dariñen geplündert hatte: Darwider Gen. Major Axel Lille vber einen / dem beschehenē Anbringen zu widerlauffenden actum, sich beklagte. Herr Statthalter Marggraffe Ernst liesse diesen Rittmeister einziehen / vnd im Kriegsrecht widerfahren / darumb er enthauptet / vnnd zehen seiner Gehülffen auffgehenckt worden“. Der vorderösterreichische Obrist entschuldigte gegenüber Erzherzogin Claudia v. Tirol 1633 seine Soldaten damit, dass diese „aus noth und hunger verursacht werden, zuweilen anderwerts was zu suchen“. SCHENNAT, Tiroler Landesverteidigung, S. 354.
[27] CHEMNITZ, Königl. Schwedischen [ … ] Kriegs 2. Teil, 1. Buch, 58. Kapitel, S. 265.
[28] Hammée: Verhau, Sicherung, besonders Schlagbäume und Ketten.
[29] Brustwehr: einfache Feldbefestigung zur Verteidigung v. Geländeabschnitten: Erdwall oder Aufwurf, der die Verteidiger vor Beschuss schützte, ihnen aber gleichzeitig erlaubte, darüber hinweg zu schießen.
[30] Staketen: Absperrung, Geschützverkleidung, Holzpfähle.
[31] schwedische Armee: Trotz des Anteils an ausländischen Söldnern (ca. 85 %; nach GEYSO, Beiträge II, S. 150, Anm., soll Banérs Armee 1625 bereits aus über 90 % Nichtschweden bestanden haben) als „schwedisch-finnische Armee“ bezeichnet. Die Unterscheidung zwischen der „Royal-Armee“, die v. Gustav II. Adolf selbst geführt wurde, u. den v. den Feldmarschällen seiner Konföderierten geführten „bastanten“ Armeen erscheint angesichts der Operationen der letzteren überflüssig. Nach LUNDKVIST, Kriegsfinanzierung, S. 384, betrug der Mannschaftsbestand (nach altem Stil) im Juni 1630 38.100, Sept. 1631 22.900, Dez. 1631 83.200, Febr./März 1632 108.500, Nov. 1632 149.200 Mann; das war die größte paneuropäische Armee vor Napoleon. 9/10 der Armee Banérs stellten deutsche Söldner; GONZENBACH, Der General Hans Ludwig von Erlach von Castelen II, S. 130. Schwedischstämmige stellten in dieser Armee einen nur geringen Anteil der Obristen. So waren z. B. unter den 67 Generälen und Obristen der im Juni 1637 bei Torgau liegenden Regimenter nur 12 Schweden; die anderen waren Deutsche, Finnen, Livländern, Böhmen, Schotten, Iren, Niederländern u. Wallonen; GENTZSCH, Der Dreißigjährige Krieg, S. 208. Vgl. die Unterredung eines Pastors mit einem einquartierten „schwedischen“ Kapitän, Mügeln (1642); FIEDLER, Müglische Ehren- und Gedachtnis-Seule, S. 208f.: „In dem nun bald dieses bald jenes geredet wird / spricht der Capitain zu mir: Herr Pastor, wie gefället euch der Schwedische Krieg ? Ich antwortet: Der Krieg möge Schwedisch / Türkisch oder Tartarisch seyn / so köndte er mir nicht sonderlich gefallen / ich für meine Person betete und hette zu beten / Gott gieb Fried in deinem Lande. Sind aber die Schweden nicht rechte Soldaten / sagte der Capitain / treten sie den Keyser und das ganze Römische Reich nicht recht auff die Füsse ? Habt ihr sie nicht anietzo im Lande ? Für Leipzig liegen sie / das werden sie bald einbekommen / wer wird hernach Herr im Lande seyn als die Schweden ? Ich fragte darauff den Capitain / ob er ein Schwede / oder aus welchem Lande er were ? Ich bin ein Märcker / sagte der Capitain. Ich fragte den andern Reuter / der war bey Dreßden her / der dritte bey Erffurt zu Hause / etc. und war keiner unter ihnen / der Schweden die Zeit ihres Lebens mit einem Auge gesehen hette. So haben die Schweden gut kriegen / sagte ich / wenn ihr Deutschen hierzu die Köpffe und die Fäuste her leihet / und lasset sie den Namen und die Herrschafft haben. Sie sahen einander an und schwiegen stille“. Vgl. auch das Streitgespräch zwischen einem kaiserlich u. einem schwedisch Gesinnten „Colloquium Politicum“ (1632). Zur Fehleinschätzung der schwedischen Armee (1642): FEIL, Die Schweden in Oesterreich, S. 355, zitiert [siehe VD17 12:191579K] den Jesuiten Anton Zeiler (1642): „Copey Antwort-Schreibens / So von Herrn Pater Antoni Zeylern Jesuiten zur Newstadt in under Oesterreich / an einen Land-Herrn auß Mähren / welcher deß Schwedischen Einfalls wegen / nach Wien entwichen / den 28 Junii An. 1642. ergangen : Darauß zu sehen: I. Wessen man sich bey diesem harten und langwürigen Krieg in Teutschland / vornemlich zutrösten habe / Insonderheit aber / und für das II. Was die rechte und gründliche Ursach seye / warumb man bißher zu keinem Frieden mehr gelangen können“. a. a. O.: „Es heisst: die Schweden bestünden bloss aus 5 bis 6000 zerrissenen Bettelbuben; denen sich 12 bis 15000 deutsche Rebellen beigesellt. Da sie aus Schweden selbst jährlich höchstens 2 bis 3000 Mann ‚mit Marter und Zwang’ erhalten, so gleiche diese Hilfe einem geharnischten Manne, der auf einem Krebs reitet. Im Ganzen sei es ein zusammengerafftes, loses Gesindel, ein ‚disreputirliches kahles Volk’, welches bei gutem Erfolge Gott lobe, beim schlimmen aber um sein Erbarmen flehe“. Im Mai 1645 beklagte Torstensson, dass er kaum noch 500 eigentliche Schweden bei sich habe, die er trotz Aufforderung nicht zurückschicken könne; DUDÍK, Schweden in Böhmen und Mähren, S. 160.
[32] Wilhelm v. Velbrück [Vellbrück] [ -13.10.1650], lothringischer Geheimrat, kaiserlicher Obrist, Kriegs- u. Kammerrat.
[33] Breisach am Rhein [LK Breisgau-Hochschwarzwald]; HHSD VI, S. 110ff.
[35] Mainz; HHSD V, S. 214ff.
[36] Bacharach [LK Mainz-Bingen]; HHSD V, S. 18ff.
[37] Bonn; HHSD III, S. 94ff.
[38] Niederlahnstein [Rhein-Lahn-Kreis]; HHSD V, S. 264.
[39] alert: wachsam.
[40] Trompeter: Eigener, mit 12 fl. monatlich – teilweise wurden in besetzten Städten 12 Rt. (18 fl.) herausgepresst; HEIMATMUSEUM SCHWEDT, Die Uckermark, S. 15); Nach Wallensteins Verpflegungsordnung (1629) standen ihm 16 Rt. monatlich zu; KRAUSE, Urkunden 1. Bd., S. 461 – wie der Trommelschläger recht gut bezahlter, aber auch risikoreicher Berufsstand innerhalb des Militärs u. bei Hof mit wichtigen Aufgaben, z. B. Verhandlungen mit belagerten Städten, Überbringung wichtiger Schriftstücke etc., beim Militär mit Aufstiegsmöglichkeit in die unteren Offiziersränge. Vgl. dazu etwa Siedeler in den „Miniaturen“.
[41] Schussgatter: Fallgitter.
[42] Sturmleiter: Eskaladieren (Eskalade, frz.: escalader, escalade) bedeutet mittels Sturmleitern ersteigen, also die Ersteigung von Mauern oder steilen Böschungen. Dieses Gerät war ein wichtiges mittelalterliches Kriegsgerät u. wurde in der Regel herangeführt. Häufig einholmig mit an der Spitze angebrachten Haken war es leicht u. gut zu händeln. So sollten die Sturmkolonnen den Wall der Burg oder Festung auf Sturmleitern ersteigen, versuchen sich dort festzusetzen u. das Tor v. innen öffnen, um den Reserven den Weg frei zu machen [Wikipedia].
[43] Gerhard Conrad Storck [Stårck, Storch] [ -16.12.1633 vor Andernach], schwedischer Obristleutnant.
[44] Rotes Regiment: nationalschwedisches Regiment, v. 1630-1635 geführt v. Gisebrecht [Giesbrecht] v. Hogendorp [Hogendorf, Hohndorf, Hohendorff, Horndorff] [ – ], schwedischer Obrist.
[45] CHEMNITZ, Königl. Schwedischen [ … ] Kriegs 1. Teil, 1. Buch, 58. Kapitel, S. 265.
[46] Liga: Die Liga war das Bündnis katholischer Reichsstände vom 10.7.1609 (vgl. ERNST; SCHINDLING, Union und Liga) zur Verteidigung des Landfriedens u. der katholischen Religion, 1619 neu formiert, maßgeblich unter Führung Maximilians I. v. Bayern zusammen mit spanischen u. österreichischen Habsburgern an der Phase des Dreißigjährigen Krieges bis zum Prager Frieden (1635) beteiligt, danach erfolgte formell die Auflösung. Das bayerische Heer wurde Teil der Reichsarmada. Zur Liga-Politik vgl. KAISER, Politik, S. 152ff.
[47] Hachenburg [LK Westerwaldkreis]; HHSD V, S. 124.
[48] Lothar Dietrich Freiherr v. Bönninghausen [ca. 1598 Apricke-13.12.1657 Schnellenberg], in ligistischen, kaiserlichen, spanischen u. französischen Diensten, zuletzt Feldmarschallleutnant. Vgl. LAHRKAMP, Bönninghausen.
[49] Altenwied, unter Neustadt [Wied)], Ortsteil Wied [LK Wied].
[50] KELLER, Drangsale, S. 204.
[51] Münster; HHSD III, S. 537ff.
[52] Burgsteinfurt [LK Steinfurt]; HHSD III, S. 135ff.
[53] Ruhrort, heute Stadtteil von Duisburg.
[54] LATOMUS, Relationis Historicæ Semestralis Continuatio (1634), S. 95.
Veröffentlicht unter Miniaturen
|
Verschlagwortet mit G
|
Wiederholt [Widerholt, Wederholt, Wiederhold, Wiederholdt] von Weidenhoven, Georg Reinhard [Reinhard]; Obrist [ -30.1.1648 (Homburg (Efze)] Wiederholt, Herr von Pouderojen, Obrist und Gouverneur von Boekholt,[1] stand 1644/1645 als Obristleutnant bzw. Obrist in hessen-kasselischen Diensten.
Er war 1645 als Nachfolger von Spreewitz in Kempen[2] stationiert.
Der katholische Chronist Wilmius aus Kempen berichtet: „Im Januar 1645, um das Fest der hl. Jungfrau Agnes, kam ein neuer Stadtkommandant nach Kempen mit Namen Reinhard Wederholt, ein anscheinend guter [überschrieben ‚böse‘ nequam] Mann. Er löste von Sprewitz ab, der, um eine Frau heimzuführen, nach Minden[3] reiste und nach seiner Rückkehr seinen Platz von einem andereren eingenommen fand“.[4]
„Im gleichen Monat [April] waren die Bürgerhäuser wieder mit Reitern und Fußtruppen überbelegt. Die meisten Bürger hatten zehn, achtzehn, ja sogar zwanzig zum Teil recht unverschämte Soldaten im Hause, denen sie reichlich Holz liefern mußten. Um dieselbe Zeit kam am Dienstag in der zweiten Karwoche der Kommissar der hessischen Streitmacht Bernard Becker von Neuß[5] nach Kempen. In diesen Tagen waren wir sonst sehr stark mit Beichthören beschäftigt. Aber eine Soldatenmusterung in der Kirche mit Trommelklang, Pfeifenspiel und viel Geschrei verursachte einen solchen Lärm, daß man meinen sollte, der Himmel fiele ein. Die Störung führte dazu, daß die Passion nicht gesungen und keine Beichte gehört werden konnte. Ein Preister, der während der Lesung der Frühmesse von dem Manöver überrascht wurde, konnte sie bei dem Lärm nur mit Mühe zu Ende lesen. Von einem Hauptmann Graff wurde er durch die dichte Menge des undisziplinierten Volkes zur Sakristei geleitet. Der Priester war Herr Jacob Mas aus Viersen.
Am Karsamstag bat mich der Stadtkommandant, der adelige Herr Georg Reinhard Wederholt von Weidenhoven, durch den Prädikanten, ich möchte eine Botschaft nach Bonn[6] an Seine Durchlaucht den Kurfürsten schicken und ihm für seine Gattin, die sich in Holland aufhielt und die Vorbereitungen für die Rückreise traf, einen Geleit- oder Sicherheitsbrief besorgen. Trotz des ungünstigen Zeitpunktes in Anbetracht der vielen kirchlichen Obliegenheiten vor dem Osterfest willigte ich ein, sandte einen besonderen Boten und erbat einen Geleitbrief. Ich erhielt ihn auch zum Nutzen für uns Katholiken, damit wir in Zukunft seine Gnade und Gunst geniessen könnten.
Ende April wuchs die Besatzung der Stadt so stark an, daß die Bürgerhäuser bis zum letzten Winkel mit Soldaten belegt waren. Einige Quartiere hatten zwanzig und mehr Mann zu beherbergen. Manche Frechheiten mußten sich die Bürger von den Soldaten bieten lassen und dazu noch zu ihrem großen Schaden ihnen Verpflegung und ihren Pferden Futter zu beschaffen“.[7]
„Um den ersten Juni verbreitete sich überall die Kunde von dem beachtenswerten Erfolg der Bayern über ihre Feinde [Schlacht bei Herbsthausen;[8] BW]. Unsere Besatzung geriet darob in Furcht und suchte wiederum nach Möglichkeiten, die Stadt zu befestigen. Schnell stellte man einige hundert Fuhrwerke und Wagen zusammen, fiel über einen Wald in Büttgen[9] her, schlug mehrere tausend Eichen und schaffte sie heran zwecks Herstellung neuer Schanzpfähle. Mit Hilfe der Eingesessenen begannen sie nun, die Stadt mit einem Pallisadenring zu umschließen. Das wilde Abholzen hatte dem Aussehen des Waldes sehr geschadet und war für seinen Eigentümer ein großer Verlust“.[10]
„Am 8. September 1645 weckte eine furchtbare Feuersbrunst auf der Kuhstraße die Bürger mitten in der Nacht aus dem Schlaf. Mehrere Scheunen und Wohnhäuser wurden ein Raub der Flammen. Ein schwerer Verlust für die Bürger, die schon das ganze Getreide in ihren Scheunen hatten und somit ihre ganzen Vorräte verloren. Anfangs schien der Brand auf die ganze Stadt überzugreifen. Jeder glaubte, das Feuer sei nicht mehr zu löschen. Doch durch die Gnade Gottes und die Anstrengungen der Bürger wurden die Flammen zuguterletzt gelöscht, obwohl an Löschgeräten wie Leitern, Krügen, Leder- und Metalleimern großer Mangel war, die in den Notzeiten dieses Krieges verloren gegangen oder verdorben waren. Zu diesen Schwierigkeiten kam noch das Übel, daß die Leute ihre Häuser zum Löschen eines Brandes kaum verlassen durften, wollten sie nicht Gefahr laufen, von den einquartierten Soldaten während ihrer Abwesenheit bestohlen zu werden. So brachte draußen die Feuersbrunst die Bürger in Aufregung, und in ihren Häusern ließ ihnen die Gefahr eines Diebstahls keine Ruhe. Die natürliche Folge war, daß die Bürger weniger auf die Schäden ihrer Mitbewohner achten konnten.
Anfang Oktober kamen Kommissare der erlauchten Landgräfin von Hessen in die rheinischen Gefilde nach Neuß, Linn[11] und Kempen. Sie hießen Malsberg [Malsburg; BW], Gunterod [Hans Heinrich v. Günterode; BW] und Ludwig Pauls. Den Schwierigkeiten unserer Vaterstadt Rechnung tragend, wollten sie bessere Verhältnisse schaffen. In der Tat brachten sie unserer Stadt auch einige Erleichterung, die durch die willkürlichen und unerträglichen Kriegslasten bis aufs Mark ausgesogen war. Vor allem machten sie uns große Hoffnung auf größere Verständigungsbereitschaft. Leider blieben die Großsprechereien leere Worte, und die Bürger blieben in der Stampfmühle der Erpressungen und Abgaben wie bisher.
Im November 1645 wurden plötzlich drei Kompanien unserer Besatzungssoldaten mit ihrem Troß abkommandiert. Die Bürger atmeten auf, konnten allerdings nicht in Erfahrung bringen, wohin sie marschierten und ob neue Soldaten nachrückten.
Am 2. Dezember kam ein Schreiben Seiner Durchlaucht des Kurfürsten, wir sollten an die Hessen keinesfalls mehr die bisher üblichen Kontributionen leisten, sondern diese Gelder im Laufe der einzelnen Monate für Seine Durchlaucht zurückhalten. In einem Übereinkommen zwischen dem durchlauchtigen Kurfürsten und der Landgräfin war diese finanzielle Abmachung getroffen worden. Der Einspruch der hessischen Offiziere jedoch kehrte die wohlgemeinte Absicht ins Gegenteil. Die Belastung der Einge[se]ssenen wurde noch drückender und die Eintreibung des Geldes noch rücksichtsloser.
Im gleichen Monat drohte dem Kempener Klerus ein neues Damoklesschwert. Die hessischen Offiziere hatten nämlich den einheimischen, innerhalb der Mauern wohnenden Klerus, wie sie vorgaben, auf Anordnung des Kommissars Bernard Becker in den Kreis der Zahlungspflichtigen einbezogen. Die Anweisung verpflichtete sie zur monatlichen Zahlung von 61 Reichstalern Besatzungskosten, 50 Reichstalern für den Hauptmann Rosbach und 22 Reichstalern an einen anderen mir unbekannten Hauptmann. Die Aufforderung zur Zahlung des unserem Klerus auferlegten Geldes war nicht minder rigoros. Durch Boten ließen die Hauptleute bekanntmachen, daß das Geld bereits am nächsten Tag erhoben und im Weigerungsfalle auf dem Wege militärischer Zwangsmaßnahmen eingetrieben würde. Diese Drohung vor Augen reisten der Herr Pastor und ich am dritten Adventssonntag auf einem geliehenen Lastwagen nach Neuß, da wir keinen anderen Ausweg mehr sahen. In Willich[12] erfuhren wir aber von einem uns aus Kempen nachgesandten Boten, daß der Kommissar nach Kempen gekommen sei. Wir änderten unsere Marschroute und kehrten nach Hause zurück mit dem festen Vorsatz, ein Gespräch beim Kommissar zu erreichen. Wir begaben uns zu seinem Quartier, meinem Elternhaus, das nach dem Offizial benannt ist, und bekamen nach einstündigem Warten eine Audienz. Die ungeheure Belastung vor Augen redete ich ihm ernsthaft zu. Wir legten ihm die Unmöglichkeit einer Beschaffung der uns auferlegten Lasten dar und baten um ihre Aufhebung, bis der Kurfürst unterrichtet sei und eine Entscheidung getroffen habe, was wir in unserer großen Not tun oder beschliessen sollten. Anfangs machte er Schwierigkeiten und wollte uns nur einen Aufschub von einer Woche zugestehen. Doch unser Hinweis auf die Festtage hier wie in Bonn aus Anlaß des bevorstehenden Weihnachtsfestes, wo keine Audienz gewährt würde, hatte den Erfolg, daß wir mit Mühe und Not einen Aufschub von einem Monat erhielten. Nach diesem Erfolg übertrugen wir in Briefen nach Bonn und Münster,[13] die an Seine Durchlaucht den Kurfürsten, an den hochwürdigsten erlauchten Fürstbischof von Osnabrück[14] [Wartenberg; BW] und schließlich an Seine Durchlaucht den Apostolischen Nuntius [Chigi; BW] gerichtet waren, den Schutz und die Wahrnehmung unserer Sache der ebendort tagenden Versammlung der Reichsfürsten. […]
Am Ende des Jahres 1645 wurden wieder einmal die Priester schwer unter Druck gesetzt. Es wurde uns eine Kontribution von 130 Reichstalern angesagt. Natürlich konnten wir diese Summe nicht beibringen und wandten uns deshalb an den Kommissar Becker. Wir erreichten einen Aufschub von einem Monat, während wir nachweisen mußten, daß wir früher von jeder Kontribution befreit waren. Wir nahmen unsere Zuflucht nach Bonn und wollten zwei Priester hinschicken. Leider gab der Kommandant keine Ausreisegenehmigung. So nahmen wir einen Boten, der einen Brief von mir zu Seiner Durchlaucht bringen sollte. Da uns vom Kommissar nun einmal die Kontribution auferlegt war, drohte der Hauptmann Rosbach, der mich täglich belästigte, mit der Eintreibung durch seine Leute, ohne Rücksicht auf die uns gewährte Monatsfrist.
Am vorletzten Dezember wurde ich in meinem Hause von den Soldaten in schwere Bedrängnis gebracht. Sie verhöhnten mich wegen der Kontribution, woran ich doch nicht Schuld hatte, und trafen Anstalten, sie von mir zu erpressen. Deshalb begaben wir uns, der Herr Pastor und ich, zum Kommandanten und baten um seinen Schutz. Zum Dank für seine Zusage schickten wir ihm eine Karre mit 6 Malter Hafer, die er bereitwilligst in Empfang nahm.
Im Januar 1646, um das Fest des hl. Antonius, bekam ich ein Schreiben Seiner kurfürstlichen Durchlaucht. Es enthielt eine Mitteilung an den Kommissar Becker, die bezeugte, daß wir Kempener Priester zu der neuen Auflage für den Klerus nicht herangezogen werden dürften. Mit einem Begleitschreiben von mir schickte ich den Brief nach Neuß an den Kommissar. Seine Antwort befreite uns von der uns angedrohten Last von monatlich 130 Reichstalern. Zugleich schickte er mir einen Brief zum Lesen, der in unserer Angelegenheit unter fliegendem Siegel an den Kommandanten Wederholt gerichtet war. Nach Kenntnisnahme habe ich den Brief verschlossen und durch einen Kaplan am Tage vor St. Antonius an den Kommandanten weitergegeben. […]
Zur selben Zeit [März 1646; BW] durchsuchte unser Kommandant Wederholt in seiner unersättlichen Geldgier alle Winkel und Verstecke der von ihm bewohnten Burg in der Hoffnung, einen Schatz zu finden. Dabei stieß er auf einen Punkt der Kapelle neben dem kurfürstlichen Gemach, der ihm verdächtig vorkam. Er drang dort ein und fand ein gläsernes Gefäß, das mit einigen in ein feines leinenes Tuch eingehüllten Reliquien und heiligen Gebeinen gefüllt war. Das Gefäß hatte ein Wachssiegel, auf dem in alten fremdländischen Buchstaben ein Name eingezeichnet war. In seinem Staunen fragte er sich verwundert, was das wohl wäre und ließ es dem Herrn Wilmius bringen. Der Bedienstete brachte es versehentlich zu meinem Neffen Ägidius, den er besser kannte als mich. Der betrachtete es genau und begehrte es gegen einen Geldbetrag zu erwerben. Doch ohne Erfolg ! Am nächsten Tag gab er das Wachssiegel meinem Neffen, der es mir brachte. […]
Am Osterdienstag drang einer von den Offizieren unserer Besatzung betrunken und hoch zu Roß ohne jedes Schamgefühl und ohne jede Pietät in scharfem Trab in die Franziskanerkirche ein. Während seines wilden Ritts durch die Kirche legte er das Gewehr in Schlag und bedrohte die Leute, die hier ihre Andacht verrichteten. Um noch größeren Schrecken zu verbreiten, schoß er auf die, welche sich auf dem Chor befanden. Gottlob trafen die Kugeln nur das Gewölbe der Kirche. Ich halte diesen Frevel für erwähnenswert, um klar zu machen, welche furchtbaren Gewalttätigkeiten die Katholiken erdulden mußten und mit welcher Willkür und Frechheit die Hessen jede religiöse Toleranz mißachteten. […] Im gleichen Monat [April 1646; BW] versuchten die Hessen, Klerus und Adel mit militärischen Druckmitteln zur Abgabe von 600 Malter Roggen zu zwingen. Notgedrungen reiste ich zum Kommissar Bernard Becker nach Neuß und legte ihm die Unmöglichkeit auseinander, daß der Adel geschweige der Klerus soviel Roggen zusammenbringen können. Diese Repressalie war als Gegenmaßnahme gegen die Kontributionen des kaiserlichen Generals Melander [Holzappel; BW] anzusehen, der in Hessen die gleichen Forderungen stellte. Die Hessen wollten mit diesen Auflagen erreichen, daß wir uns mit unseren Klagen an Seine Durchlaucht den Kurfürsten wendeten. Er solle auf den Melander einwirken, die Beitreibung der Kontributionen in dieser Form einzustellen. Eine Besserung in Hessen würde eine Milderung der eigenen Forderungen in der Diözese Köln zur Folge haben“.[15]
„Im Monat Juni, am Tage des Apostels Barnabas, forderte der Proviantmeister beim Pfarrer 100 Malter Roggen vom Kempener Klerus und den Bewohnern des Amtes Kempen. Er stieß aber auf Widerstand, da diese Menge nicht aufzubringen war. Trotzdem gab er nicht kleinmütig bei, sondern kam im Vertrauen auf den Brief des Kommissars Becker, der diese Abgabe mit militärischem Druck gefordert hatte, zu mir und dem Herrn Pastor Andreas Bischoff. Die Soldaten schickte er ins Haus. Diese verrohten Gesellen stellten bei mir das Unterste zu oberst und unterließen nichts, was meinen Zorn erregen konnte. Sie stürzten sich wie die Tiere auf Speise und Trank, daß sie wie ein Hund zu ihrem eigenen Erbrochenen zurückkehrten und von neuem ihren Bauch füllten. Diese Völlerei begleiteten sie mit Schimpfworten, Gotteslästerungen und Beleidigungen gegen den Klerus. Ich konnte die Horde nur durch das Versprechen loswerden, am Abend noch 30 Malter zu liefern, während wir für den Rest in Neuß um Befreiung bitten wollten. Als sie gegen Abend auf Befehl des Proviantmeisters das Haus verlassen wollten, forderten sie noch Gebühren. Ich kam nicht umhin, einem jeden für seine Belästigungen und Beleidigungen und für alles vertrunkene Bier noch zusätzlich 40 Albus zu geben.
In derselben Woche wurde der Proviantmeister, der mit einem Trupp Soldaten im Herzogtum Jülich eine Exekution gegen die Priester unternahm und sie gefangen abführen wollte, durch einen unvorhergesehenen Zufall in Viersen von einer Kugel durchbohrt und als Leiche nach Kempen gebracht. Es war ein geheimnisvolles und gerechtes Gericht Gottes. Jetzt wird er Rechenschaft ablegen müssen über seine Ausschreitungen gegen den Klerus vor Gott, der gesagt hat: ‚Wer Euch anrührt, rührt an meinen Augapfel‘. So endete ein Verfolger der Priester wie sein Vorgänger, der ebenfalls als Leiche nach Kempen zurückgebracht und nach Sitte der Hessen in unserer Kirche, die er verfolgt hatte, begraben wurde“.[16]
Dass Rabenhaupt, der Nachfolger Ebersteins, jedoch auch Klagen der Kempener Gehör schenkte, zeigt Wilmius ebenfalls: „Nach dem Neujahrstag 1647 wandten sich die Kempener mit Klagen und Bitten an den Generalwachtmeister Rabenhaupt, den Befehlshaber der hessischen Streitkräfte in diesen Gebieten, wegen der Tyrannei, Bosheit und unersättlichen Geldgier der Besatzungssoldaten. Sie erlangten eine gnädige Audienz mit dem Erfolg, daß der bisherige Stadtkommandant Wederholt gedemütigt und ehrlos zur großen Genugtuung der Stadt seines Amtes enthoben wurde. Rabenhaupt selbst kam nach Kempen und setzte im Januar einen anderen Kommandanten persönlich ein“.[17]
[1] TIMARETEN, Verzameling, S. 84.
[2] Kempen [LK Kempen-Krefeld]; HHSD III, S. 384ff.
[3] Minden [LK Minden]; HHSD III, S. 517ff.
[4] WILMIUS, Chronicon, S. 149.
[5] Neuss; HHSD III, S. 556ff.
[6] Bonn; HHSD III, S. 94ff.
[7] WILMIUS, Chronicon, S. 149f.
[8] Herbsthausen [Bad Mergentheim, Main-Tauber-Kreis]; HHSD VI, S. 330.
[9] Büttgen [LK Grevenbroich]; HHSD III, S. 139f.
[10] WILMIUS, Chronicon, S. 150.
[11] Linn [Stadtkr. Krefeld]; HHSD III, S. 468f.
[12] Willich [LK Viersen].
[13] Münster; HHSD III, S. 537ff.
[14] Osnabrück; HHSD II, S. 364ff.
[15] WILMIUS, Chronicon, S. 151ff.
[16] WILMIUS, Chronicon, S. 156.
[17] WILMIUS, Chronicon, S. 160.
Veröffentlicht unter Miniaturen
|
Verschlagwortet mit W
|
Hessen-Kassel, Christian Landgraf von [5.2.1622 Kassel-14.11.1640 Bückeburg]
 Christian war ein Sohn des Landgrafen Moritz V. von Hessen-Kassel. Er stand als Hauptmann in schwedischen Diensten, als er einem Giftanschlag zum Opfer fiel.
Christian war ein Sohn des Landgrafen Moritz V. von Hessen-Kassel. Er stand als Hauptmann in schwedischen Diensten, als er einem Giftanschlag zum Opfer fiel.
In Hildesheim[1] war es im November 1640 zu einem gewaltigen Trinkgelage gekommen, wohin sich viele höhere Offiziere begeben hatten, um an einer von Banér einberufenen Konferenz teilzunehmen. Der Hildesheimer Arzt und Chronist Dr. Jordan berichtet unter dem 30.10./9.11.: „General Johann Banner kompt herein und wurde zweimahl 2 Schwedische Salve vom Hohen Rundel mit Stücken gegeben. Aus 2 Stücken umb 2 Uhr da kamen erstlich die Weymarschen. Er, Banner, kam umb 7 Uhr zur Nacht, – da auch 2 Stücke mehr gelöset wurden – , hatte bey sich Obristwachtmeister Pfuhl [Pfuel; BW], Wittenbergk, Schleng [Slange; BW] (und) Königsmarck, die Obristen Herr von Tzerotin [Bernard ze Žerotína; BW], ein Mährischer Freiher, Zabellitz [Zabeltitz; BW], den jungen Wrangel, Hake, Mortaigne, Hoikhing [Heuking; BW], Steinbock [Steenbock; BW], Bellingkhusen [Bellinghausen; BW], Gregersohn [Andeflycht; BW]. It. Ein Markgraf [Friedrich VI.; BW] von Durlach, des Banners Schwager. Von der Heßischen Armee war Obrist von Gundroth, von Braunschweig Bohn; von Zelle D. Langerbeck.
Von der Weimarschen Armee (die) Directoris Obrist Comte de Guebrian, Otto Wilhelm, Graf von Nassaw, Oheimb. It. Mons. Glocsi, Gral.-Intendant Extraordinari.
Ferner Herzog Philipp Ludwig von Holstein, Rittmeister, Landgraf Christian von Hessen, Caßelscher Linie Maximiliani Filius,[2] Graf Otto von Schomburg [Schaumburg; BW]. Diese letzten beiden nebst den Herrn Tzerotin starben über ein wenig Tagen innerhalb 24 Stunden“.[3]
In der Hannover’schen[4] Chronik heißt es dazu: „Den 1., 2., 3. und 4. Nov. [1640] ist zu Hildesheim die schädliche Gasterey gehalten, da I. F. G. Herzog Georg den Bannier und andere Schwedische Officirer zu Gaste gehabt, und weidlich banquetiret. Der junge Graf von Schaumburg, der letzte dieser Familie, ist gestorben, weiln er den Dingen zu viel gethan auf dieser Gasterey, der junge Graf von der Lippe hat auch eine harte Krankheit ausgestanden, der Schwedische Commandant in Erfurt[5] ist gestorben, wie auch Herzog Georg und Bannier selbst widerfahren, non sine suspicione veneni“.[6] Schon der Zeitgenosse Dr. Jordan, der auch Tilly und Anholt behandelt hatte, hatte statt einer Alkholvergiftung sogar Giftmord vermutet: „ihnen war ein vergifteter Wein von einem französischen Mönch zubereitet worden, darbey die Catholiken ihre Freude nicht wohl verbergen kunten […] der Landgraf von Heßen Christian und der Graf von Schaumburg, welche reichlich davon getrunken, sind gleich des Todtes geblieben. Herzog Georg und Baner, denen es am ersten gelten sollte, waren etwas mäßiger und also verzog sich das Unglück mit ihnen bis auf den künftigen Frühling“.[7]
[1] Hildesheim; HHSD II, S. 228ff.
[2] Mauritii Filius.
[3] SCHLOTTER, Acta, S. 327.
[4] Hannover; HHSD II, S. 197ff.
[5] Erfurt; HHSD IX, S. 100ff.
[6] JÜRGENS, Chronik, S. 537f.
[7] SCHLOTTER, Acta, S. 328. „Hessen-Kassel, Christian Landgraf von“, in: Hessische Biografie <https://www.lagis-hessen.de/pnd/138135576> (Stand: 13.11.2019).
Veröffentlicht unter Miniaturen
|
Verschlagwortet mit H
|